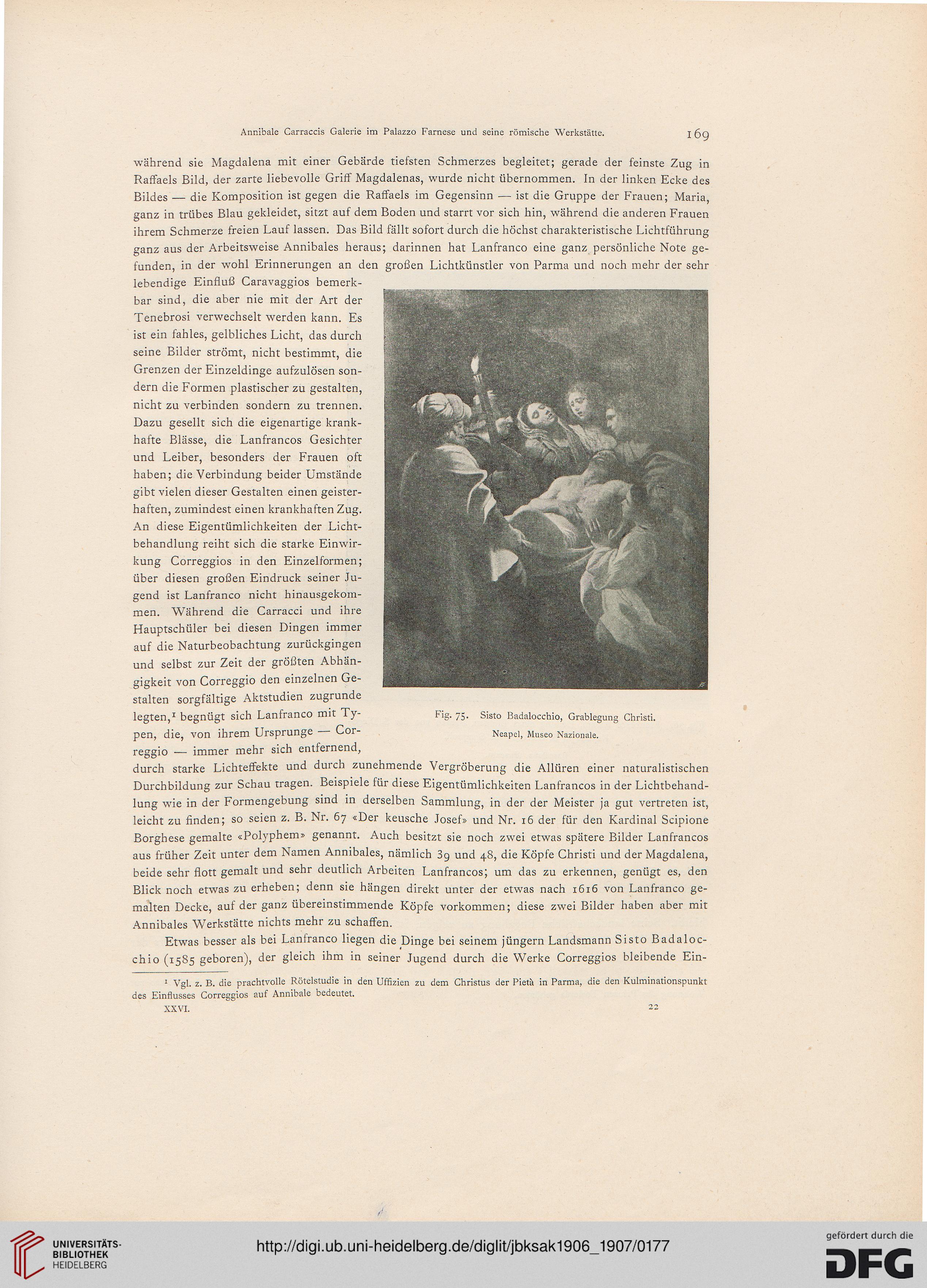Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.
I69
während sie Magdalena mit einer Gebärde tiefsten Schmerzes begleitet; gerade der feinste Zug in
Raffaels Bild, der zarte liebevolle Griff Magdalenas, wurde nicht übernommen. In der linken Ecke des
Bildes — die Komposition ist gegen die Raffaels im Gegensinn — ist die Gruppe der Frauen; Maria,
ganz in trübes Blau gekleidet, sitzt auf dem Boden und starrt vor sich hin, während die anderen Frauen
ihrem Schmerze freien Lauf lassen. Das Bild fällt sofort durch die höchst charakteristische Lichtführung
ganz aus der Arbeitsweise Annibales heraus; darinnen hat Lanfranco eine ganz persönliche Note ge-
funden, in der wohl Erinnerungen an den großen Lichtkünstler von Parma und noch mehr der sehr
lebendige Einfluß Caravaggios bemerk- _
bar sind, die aber nie mit der Art der
Tenebrosi verwechselt werden kann. Es
ist ein fahles, gelbliches Licht, das durch
seine Bilder strömt, nicht bestimmt, die
Grenzen der Einzeldinge aufzulösen son-
dern die Formen plastischer zu gestalten,
nicht zu verbinden sondern zu trennen.
Dazu gesellt sich die eigenartige krank-
hafte Blässe, die Lanfrancos Gesichter
und Leiber, besonders der Frauen oft
haben; die Verbindung beider Umstände
gibt vielen dieser Gestalten einen geister-
haften, zumindest einen krankhaften Zug.
An diese Eigentümlichkeiten der Licht-
behandlung reiht sich die starke Einwir-
kung Correggios in den Einzelformen;
über diesen großen Eindruck seiner Ju-
gend ist Lanfranco nicht hinausgekom-
men. Während die Carracci und ihre
Hauptschüler bei diesen Dingen immer
auf die Naturbeobachtung zurückgingen
und selbst zur Zeit der größten Abhän-
gigkeit von Correggio den einzelnen Ge-
stalten sorgfältige Aktstudien zugrunde
legten,1 begnügt sich Lanfranco mit Ty-
pen, die, von ihrem Ursprünge — Cor-
reggio — immer mehr sich entfernend,
durch starke Lichteffekte und durch zunehmende Vergröberung die Allüren einer naturalistischen
Durchbildung zur Schau tragen. Beispiele für diese Eigentümlichkeiten Lanfrancos in der Lichtbehand-
lung wie in der Formengebung sind in derselben Sammlung, in der der Meister ja gut vertreten ist,
leicht zu finden; so seien z. B. Nr. 67 «Der keusche Josef» und Nr. 16 der für den Kardinal Scipione
Borghese gemalte «Polyphem» genannt. Auch besitzt sie noch zwei etwas spätere Bilder Lanfrancos
aus früher Zeit unter dem Namen Annibales, nämlich 3g und 48, die Köpfe Christi und der Magdalena,
beide sehr flott gemalt und sehr deutlich Arbeiten Lanfrancos; um das zu erkennen, genügt es, den
Blick noch etwas zu erheben; denn sie hängen direkt unter der etwas nach 1616 von Lanfranco ge-
malten Decke, auf der ganz übereinstimmende Köpfe vorkommen; diese zwei Bilder haben aber mit
Annibales Werkstätte nichts mehr zu schaffen.
Etwas besser als bei Lanfranco liegen die Dinge bei seinem jüngern Landsmann Sisto Badaloc-
chio (1585 geboren), der gleich ihm in seiner Jugend durch die Werke Correggios bleibende Ein-
1 Vgl. z. B. die prachtvolle Rötclstudie in den Uffizien zu dem Christus der Pietä in Parma, die den Kulminationspunkt
des Einflusses Correggios auf Annibale bedeutet.
XXVI. 22
Kig.
Sisto Badalocchio, Grablegung Christi.
Neapel, Museo Nazionale.
I69
während sie Magdalena mit einer Gebärde tiefsten Schmerzes begleitet; gerade der feinste Zug in
Raffaels Bild, der zarte liebevolle Griff Magdalenas, wurde nicht übernommen. In der linken Ecke des
Bildes — die Komposition ist gegen die Raffaels im Gegensinn — ist die Gruppe der Frauen; Maria,
ganz in trübes Blau gekleidet, sitzt auf dem Boden und starrt vor sich hin, während die anderen Frauen
ihrem Schmerze freien Lauf lassen. Das Bild fällt sofort durch die höchst charakteristische Lichtführung
ganz aus der Arbeitsweise Annibales heraus; darinnen hat Lanfranco eine ganz persönliche Note ge-
funden, in der wohl Erinnerungen an den großen Lichtkünstler von Parma und noch mehr der sehr
lebendige Einfluß Caravaggios bemerk- _
bar sind, die aber nie mit der Art der
Tenebrosi verwechselt werden kann. Es
ist ein fahles, gelbliches Licht, das durch
seine Bilder strömt, nicht bestimmt, die
Grenzen der Einzeldinge aufzulösen son-
dern die Formen plastischer zu gestalten,
nicht zu verbinden sondern zu trennen.
Dazu gesellt sich die eigenartige krank-
hafte Blässe, die Lanfrancos Gesichter
und Leiber, besonders der Frauen oft
haben; die Verbindung beider Umstände
gibt vielen dieser Gestalten einen geister-
haften, zumindest einen krankhaften Zug.
An diese Eigentümlichkeiten der Licht-
behandlung reiht sich die starke Einwir-
kung Correggios in den Einzelformen;
über diesen großen Eindruck seiner Ju-
gend ist Lanfranco nicht hinausgekom-
men. Während die Carracci und ihre
Hauptschüler bei diesen Dingen immer
auf die Naturbeobachtung zurückgingen
und selbst zur Zeit der größten Abhän-
gigkeit von Correggio den einzelnen Ge-
stalten sorgfältige Aktstudien zugrunde
legten,1 begnügt sich Lanfranco mit Ty-
pen, die, von ihrem Ursprünge — Cor-
reggio — immer mehr sich entfernend,
durch starke Lichteffekte und durch zunehmende Vergröberung die Allüren einer naturalistischen
Durchbildung zur Schau tragen. Beispiele für diese Eigentümlichkeiten Lanfrancos in der Lichtbehand-
lung wie in der Formengebung sind in derselben Sammlung, in der der Meister ja gut vertreten ist,
leicht zu finden; so seien z. B. Nr. 67 «Der keusche Josef» und Nr. 16 der für den Kardinal Scipione
Borghese gemalte «Polyphem» genannt. Auch besitzt sie noch zwei etwas spätere Bilder Lanfrancos
aus früher Zeit unter dem Namen Annibales, nämlich 3g und 48, die Köpfe Christi und der Magdalena,
beide sehr flott gemalt und sehr deutlich Arbeiten Lanfrancos; um das zu erkennen, genügt es, den
Blick noch etwas zu erheben; denn sie hängen direkt unter der etwas nach 1616 von Lanfranco ge-
malten Decke, auf der ganz übereinstimmende Köpfe vorkommen; diese zwei Bilder haben aber mit
Annibales Werkstätte nichts mehr zu schaffen.
Etwas besser als bei Lanfranco liegen die Dinge bei seinem jüngern Landsmann Sisto Badaloc-
chio (1585 geboren), der gleich ihm in seiner Jugend durch die Werke Correggios bleibende Ein-
1 Vgl. z. B. die prachtvolle Rötclstudie in den Uffizien zu dem Christus der Pietä in Parma, die den Kulminationspunkt
des Einflusses Correggios auf Annibale bedeutet.
XXVI. 22
Kig.
Sisto Badalocchio, Grablegung Christi.
Neapel, Museo Nazionale.