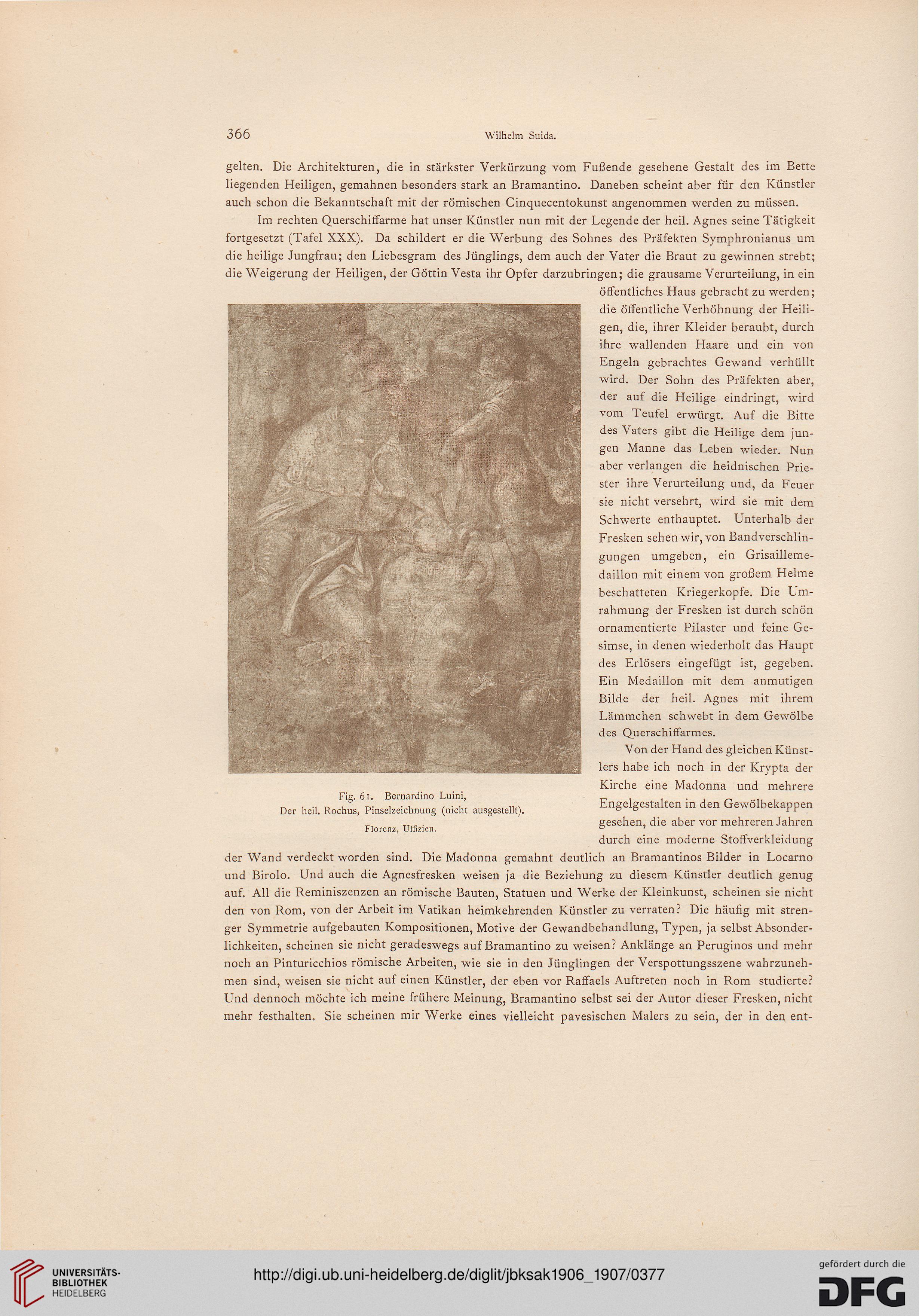366
Wilhelm Suida.
gelten. Die Architekturen, die in stärkster Verkürzung vom Fußende gesehene Gestalt des im Bette
liegenden Heiligen, gemahnen besonders stark an Bramantino. Daneben scheint aber für den Künstler
auch schon die Bekanntschaft mit der römischen Cinquecentokunst angenommen werden zu müssen.
Im rechten Querschiffarme hat unser Künstler nun mit der Legende der heil. Agnes seine Tätigkeit
fortgesetzt (Tafel XXX). Da schildert er die Werbung des Sohnes des Präfekten Symphronianus um
die heilige Jungfrau; den Liebesgram des Jünglings, dem auch der Vater die Braut zu gewinnen strebt;
die Weigerung der Heiligen, der Göttin Vesta ihr Opfer darzubringen; die grausame Verurteilung, in ein
öffentliches Haus gebracht zu werden;
die öffentliche Verhöhnung der Heili-
gen, die, ihrer Kleider beraubt, durch
ihre wallenden Haare und ein von
Engeln gebrachtes Gewand verhüllt
wird. Der Sohn des Präfekten aber,
der auf die Heilige eindringt, wird
vom Teufel erwürgt. Auf die Bitte
des Vaters gibt die Heilige dem jun-
gen Manne das Leben wieder. Nun
aber verlangen die heidnischen Prie-
ster ihre Verurteilung und, da Feuer
sie nicht versehrt, wird sie mit dem
Schwerte enthauptet. Unterhalb der
Fresken sehen wir, von Bandverschlin-
gungen umgeben, ein Grisailleme-
daillon mit einem von großem Helme
beschatteten Kriegerkopfe. Die Um-
rahmung der Fresken ist durch schön
ornamentierte Pilaster und feine Ge-
simse, in denen wiederholt das Haupt
des Erlösers eingefügt ist, gegeben.
Ein Medaillon mit dem anmutigen
Bilde der heil. Agnes mit ihrem
Lämmchen schwebt in dem Gewölbe
des Querschiffarmes.
Von der Hand des gleichen Künst-
lers habe ich noch in der Krypta der
Kirche eine Madonna und mehrere
Engelgestalten in den Gewölbekappen
gesehen, die aber vor mehreren Jahren
durch eine moderne Stoffverkleidung
der Wand verdeckt worden sind. Die Madonna gemahnt deutlich an Bramantinos Bilder in Locarno
und Birolo. Und auch die Agnesfresken weisen ja die Beziehung zu diesem Künstler deutlich genug
auf. All die Reminiszenzen an römische Bauten, Statuen und Werke der Kleinkunst, scheinen sie nicht
den von Rom, von der Arbeit im Vatikan heimkehrenden Künstler zu verraten? Die häufig mit stren-
ger Symmetrie aufgebauten Kompositionen, Motive der Gewandbehandlung, Typen, ja selbst Absonder-
lichkeiten, scheinen sie nicht geradeswegs auf Bramantino zu weisen? Anklänge an Peruginos und mehr
noch an Pinturicchios römische Arbeiten, wie sie in den Jünglingen der Verspottungsszene wahrzuneh-
men sind, weisen sie nicht auf einen Künstler, der eben vor Raffaels Auftreten noch in Rom studierte?
Und dennoch möchte ich meine frühere Meinung, Bramantino selbst sei der Autor dieser Fresken, nicht
mehr festhalten. Sie scheinen mir Werke eines vielleicht pavesischen Malers zu sein, der in den ent-
Fig. 61. Bernardino Luini,
Der heil. Rochus, Pinselzeichnung (nicht ausgestellt).
Florenz, Uffizien.
Wilhelm Suida.
gelten. Die Architekturen, die in stärkster Verkürzung vom Fußende gesehene Gestalt des im Bette
liegenden Heiligen, gemahnen besonders stark an Bramantino. Daneben scheint aber für den Künstler
auch schon die Bekanntschaft mit der römischen Cinquecentokunst angenommen werden zu müssen.
Im rechten Querschiffarme hat unser Künstler nun mit der Legende der heil. Agnes seine Tätigkeit
fortgesetzt (Tafel XXX). Da schildert er die Werbung des Sohnes des Präfekten Symphronianus um
die heilige Jungfrau; den Liebesgram des Jünglings, dem auch der Vater die Braut zu gewinnen strebt;
die Weigerung der Heiligen, der Göttin Vesta ihr Opfer darzubringen; die grausame Verurteilung, in ein
öffentliches Haus gebracht zu werden;
die öffentliche Verhöhnung der Heili-
gen, die, ihrer Kleider beraubt, durch
ihre wallenden Haare und ein von
Engeln gebrachtes Gewand verhüllt
wird. Der Sohn des Präfekten aber,
der auf die Heilige eindringt, wird
vom Teufel erwürgt. Auf die Bitte
des Vaters gibt die Heilige dem jun-
gen Manne das Leben wieder. Nun
aber verlangen die heidnischen Prie-
ster ihre Verurteilung und, da Feuer
sie nicht versehrt, wird sie mit dem
Schwerte enthauptet. Unterhalb der
Fresken sehen wir, von Bandverschlin-
gungen umgeben, ein Grisailleme-
daillon mit einem von großem Helme
beschatteten Kriegerkopfe. Die Um-
rahmung der Fresken ist durch schön
ornamentierte Pilaster und feine Ge-
simse, in denen wiederholt das Haupt
des Erlösers eingefügt ist, gegeben.
Ein Medaillon mit dem anmutigen
Bilde der heil. Agnes mit ihrem
Lämmchen schwebt in dem Gewölbe
des Querschiffarmes.
Von der Hand des gleichen Künst-
lers habe ich noch in der Krypta der
Kirche eine Madonna und mehrere
Engelgestalten in den Gewölbekappen
gesehen, die aber vor mehreren Jahren
durch eine moderne Stoffverkleidung
der Wand verdeckt worden sind. Die Madonna gemahnt deutlich an Bramantinos Bilder in Locarno
und Birolo. Und auch die Agnesfresken weisen ja die Beziehung zu diesem Künstler deutlich genug
auf. All die Reminiszenzen an römische Bauten, Statuen und Werke der Kleinkunst, scheinen sie nicht
den von Rom, von der Arbeit im Vatikan heimkehrenden Künstler zu verraten? Die häufig mit stren-
ger Symmetrie aufgebauten Kompositionen, Motive der Gewandbehandlung, Typen, ja selbst Absonder-
lichkeiten, scheinen sie nicht geradeswegs auf Bramantino zu weisen? Anklänge an Peruginos und mehr
noch an Pinturicchios römische Arbeiten, wie sie in den Jünglingen der Verspottungsszene wahrzuneh-
men sind, weisen sie nicht auf einen Künstler, der eben vor Raffaels Auftreten noch in Rom studierte?
Und dennoch möchte ich meine frühere Meinung, Bramantino selbst sei der Autor dieser Fresken, nicht
mehr festhalten. Sie scheinen mir Werke eines vielleicht pavesischen Malers zu sein, der in den ent-
Fig. 61. Bernardino Luini,
Der heil. Rochus, Pinselzeichnung (nicht ausgestellt).
Florenz, Uffizien.