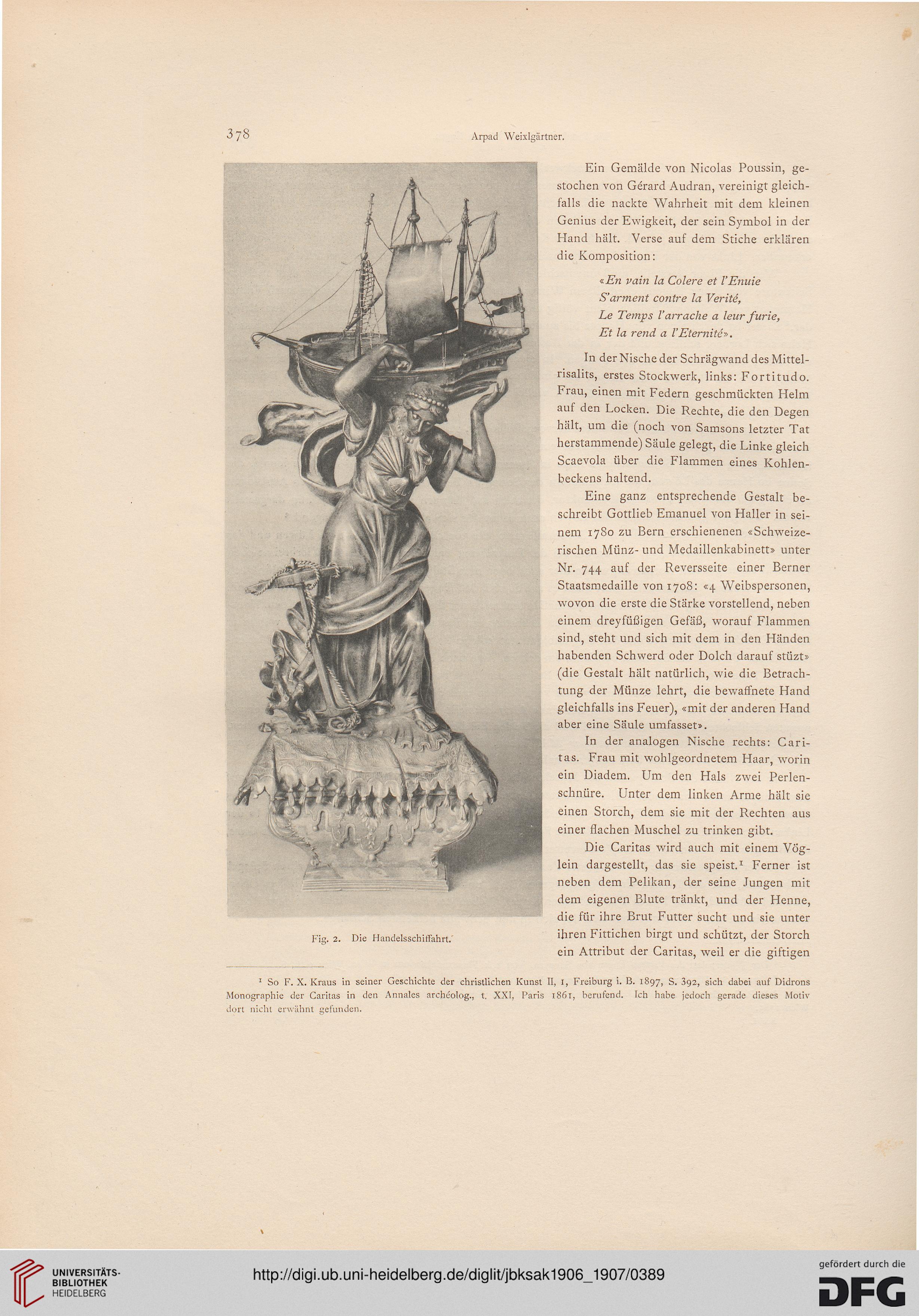378
Arpad Weixlgiirtner.
Fig. 2. Die Handelsschillahrt.
Ein Gemälde von Nicolas Poussin, ge-
stochen von Gerard Audran, vereinigt gleich-
falls die nackte Wahrheit mit dem kleinen
Genius der Ewigkeit, der sein Symbol in der
Hand hält. Verse auf dem Stiche erklären
die Komposition:
«En vain la Colere et VEnuie
S'arment contre la Verite,
Le Temps l'arrache a leur furie,
Et la rend a VEternites.
In der Nische der Schrägwand des Mittel-
risalits, erstes Stockwerk, links: Fortitudo.
Frau, einen mit Federn geschmückten Helm
auf den Locken. Die Rechte, die den Degen
hält, um die (noch von Samsons letzter Tat
herstammende) Säule gelegt, die Linke gleich
Scaevola über die Flammen eines Kohlen-
beckens haltend.
Eine ganz entsprechende Gestalt be-
schreibt Gottlieb Emanuel von Haller in sei-
nem 17S0 zu Bern erschienenen «Schweize-
rischen Münz- und Medaillenkabinett» unter
Nr. 744 auf der Reversseite einer Berner
Staatsmedaille von 1708: «4 Weibspersonen,
wovon die erste die Stärke vorstellend, neben
einem dreyfüßigen Gefäß, worauf Flammen
sind, steht und sich mit dem in den Händen
habenden Schwerd oder Dolch darauf stüzt»
(die Gestalt hält natürlich, wie die Betrach-
tung der Münze lehrt, die bewaffnete Hand
gleichfalls ins Feuer), «mit der anderen Hand
aber eine Säule umfasset».
In der analogen Nische rechts: Cari-
tas. Frau mit wohlgeordnetem Haar, worin
ein Diadem. Um den Hals zwei Perlen-
schnüre. Unter dem linken Arme hält sie
einen Storch, dem sie mit der Rechten aus
einer flachen Muschel zu trinken gibt.
Die Caritas wird auch mit einem Vög-
lein dargestellt, das sie speist.1 Ferner ist
neben dem Pelikan, der seine Jungen mit
dem eigenen Blute tränkt, und der Henne,
die für ihre Brut Futter sucht und sie unter
ihren Fittichen birgt und schützt, der Storch
ein Attribut der Caritas, weil er die giftigen
1 So F. X. Kraus in seiner Geschichte der christlichen Kunst II, I, Freiburg i. B. 1897, S. 392, sich dabei auf Didrons
Monographie der Caritas in den Annales archeolog., t. XXI, Paris 1861, berufend. Ich habe jedoch gerade dieses Motiv
dort nicht erwähnt gefunden.
Arpad Weixlgiirtner.
Fig. 2. Die Handelsschillahrt.
Ein Gemälde von Nicolas Poussin, ge-
stochen von Gerard Audran, vereinigt gleich-
falls die nackte Wahrheit mit dem kleinen
Genius der Ewigkeit, der sein Symbol in der
Hand hält. Verse auf dem Stiche erklären
die Komposition:
«En vain la Colere et VEnuie
S'arment contre la Verite,
Le Temps l'arrache a leur furie,
Et la rend a VEternites.
In der Nische der Schrägwand des Mittel-
risalits, erstes Stockwerk, links: Fortitudo.
Frau, einen mit Federn geschmückten Helm
auf den Locken. Die Rechte, die den Degen
hält, um die (noch von Samsons letzter Tat
herstammende) Säule gelegt, die Linke gleich
Scaevola über die Flammen eines Kohlen-
beckens haltend.
Eine ganz entsprechende Gestalt be-
schreibt Gottlieb Emanuel von Haller in sei-
nem 17S0 zu Bern erschienenen «Schweize-
rischen Münz- und Medaillenkabinett» unter
Nr. 744 auf der Reversseite einer Berner
Staatsmedaille von 1708: «4 Weibspersonen,
wovon die erste die Stärke vorstellend, neben
einem dreyfüßigen Gefäß, worauf Flammen
sind, steht und sich mit dem in den Händen
habenden Schwerd oder Dolch darauf stüzt»
(die Gestalt hält natürlich, wie die Betrach-
tung der Münze lehrt, die bewaffnete Hand
gleichfalls ins Feuer), «mit der anderen Hand
aber eine Säule umfasset».
In der analogen Nische rechts: Cari-
tas. Frau mit wohlgeordnetem Haar, worin
ein Diadem. Um den Hals zwei Perlen-
schnüre. Unter dem linken Arme hält sie
einen Storch, dem sie mit der Rechten aus
einer flachen Muschel zu trinken gibt.
Die Caritas wird auch mit einem Vög-
lein dargestellt, das sie speist.1 Ferner ist
neben dem Pelikan, der seine Jungen mit
dem eigenen Blute tränkt, und der Henne,
die für ihre Brut Futter sucht und sie unter
ihren Fittichen birgt und schützt, der Storch
ein Attribut der Caritas, weil er die giftigen
1 So F. X. Kraus in seiner Geschichte der christlichen Kunst II, I, Freiburg i. B. 1897, S. 392, sich dabei auf Didrons
Monographie der Caritas in den Annales archeolog., t. XXI, Paris 1861, berufend. Ich habe jedoch gerade dieses Motiv
dort nicht erwähnt gefunden.