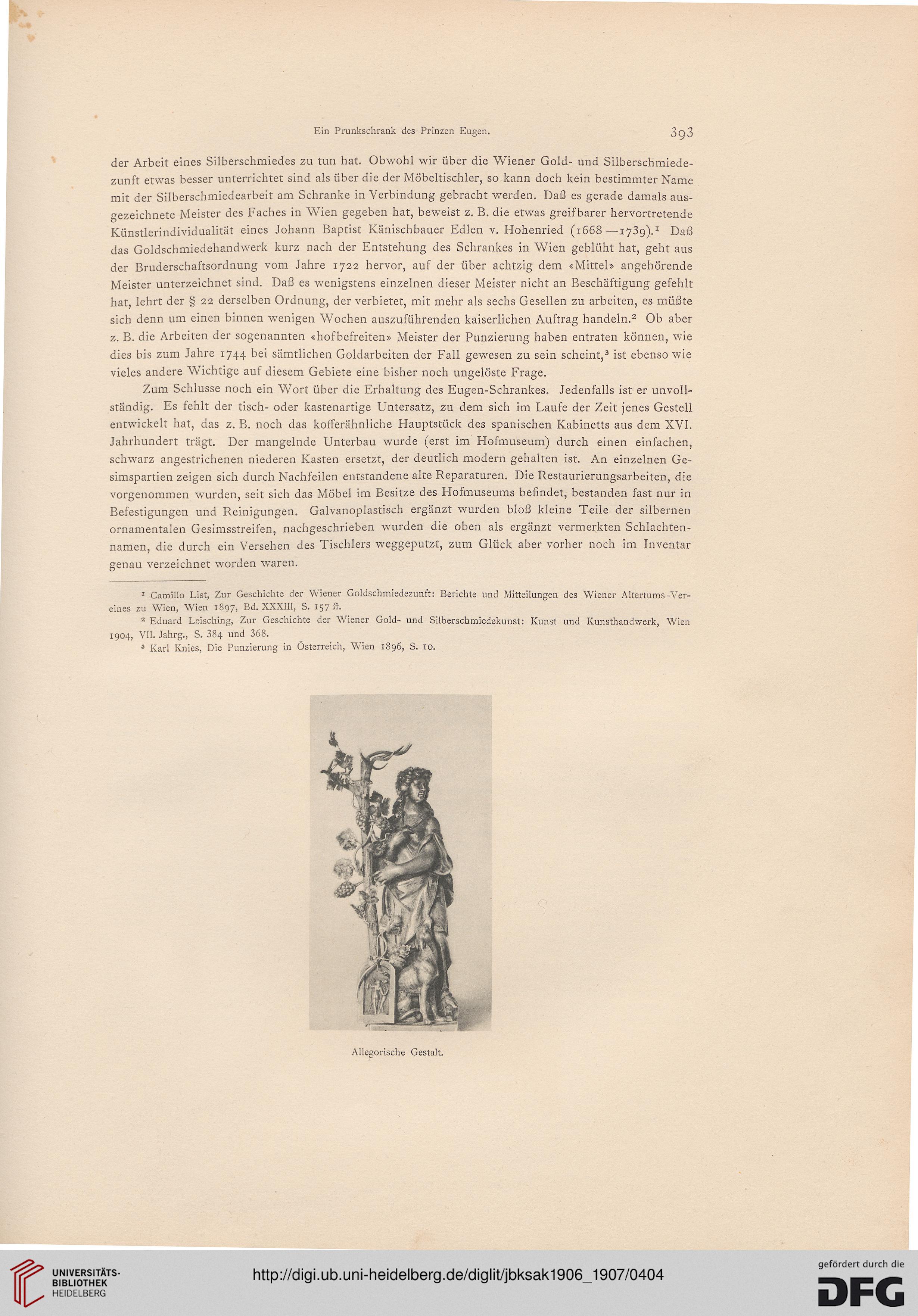Ein Prunkschrank des Prinzen Eugen.
3g3
der Arbeit eines Silberschmiedes zu tun hat. Obwohl wir über die Wiener Gold- und Silberschmiede-
zunft etwas besser unterrichtet sind als über die der Möbeltischler, so kann doch kein bestimmter Name
mit der Silberschmiedearbeit am Schranke in Verbindung gebracht werden. Daß es gerade damals aus-
gezeichnete Meister des Faches in Wien gegeben hat, beweist z. B. die etwas greifbarer hervortretende
Künstlerindividualität eines Johann Baptist Känischbauer Edlen v. Hohenried (1668—1739).1 Daß
das Goldschmiedehandwerk kurz nach der Entstehung des Schrankes in Wien geblüht hat, geht aus
der Bruderschaftsordnung vom Jahre 1722 hervor, auf der über achtzig dem «Mittel» angehörende
Meister unterzeichnet sind. Daß es wenigstens einzelnen dieser Meister nicht an Beschäftigung gefehlt
hat, lehrt der § 22 derselben Ordnung, der verbietet, mit mehr als sechs Gesellen zu arbeiten, es müßte
sich denn um einen binnen wenigen Wochen auszuführenden kaiserlichen Auftrag handeln.2 Ob aber
z. B. die Arbeiten der sogenannten «hof befreiten» Meister der Punzierung haben entraten können, wie
dies bis zum Jahre 1744 bei sämtlichen Goldarbeiten der Fall gewesen zu sein scheint,3 ist ebenso wie
vieles andere Wichtige auf diesem Gebiete eine bisher noch ungelöste Frage.
Zum Schlüsse noch ein Wort über die Erhaltung des Eugen-Schrankes. Jedenfalls ist er unvoll-
ständig. Es fehlt der tisch- oder kastenartige Untersatz, zu dem sich im Laufe der Zeit jenes Gestell
entwickelt hat, das z. B. noch das kofferähnliche Hauptstück des spanischen Kabinetts aus dem XVI.
Jahrhundert trägt. Der mangelnde Unterbau wurde (erst im Hofmuseum) durch einen einfachen,
schwarz angestrichenen niederen Kasten ersetzt, der deutlich modern gehalten ist. An einzelnen Ge-
simspartien zeigen sich durch Nachfeilen entstandene alte Reparaturen. Die Restaurierungsarbeiten, die
vorgenommen wurden, seit sich das Möbel im Besitze des Hofmuseums befindet, bestanden fast nur in
Befestigungen und Reinigungen. Galvanoplastisch ergänzt wurden bloß kleine Teile der silbernen
ornamentalen Gesimsstreifen, nachgeschrieben wurden die oben als ergänzt vermerkten Schlachten-
namen, die durch ein Versehen des Tischlers weggeputzt, zum Glück aber vorher noch im Inventar
genau verzeichnet worden waren.
1 Camillo List, Zur Geschichte der Wiener Goldschmiedezunft: Berichte und Mitteilungen des Wiener Altertums-Ver-
eines zu Wien, Wien 1897, Bd. XXXIII, S. 157 a.
2 Eduard Leisching, Zur Geschichte der Wiener Gold- und Silberschmiedekunst: Kunst und Kunsthandwerk, Wien
1904, VII. Jahrg., S. 384 und 368.
' Karl Knies, Die Punzierung in Österreich, Wien 1896, S. 10.
Allegorische Gestalt.
3g3
der Arbeit eines Silberschmiedes zu tun hat. Obwohl wir über die Wiener Gold- und Silberschmiede-
zunft etwas besser unterrichtet sind als über die der Möbeltischler, so kann doch kein bestimmter Name
mit der Silberschmiedearbeit am Schranke in Verbindung gebracht werden. Daß es gerade damals aus-
gezeichnete Meister des Faches in Wien gegeben hat, beweist z. B. die etwas greifbarer hervortretende
Künstlerindividualität eines Johann Baptist Känischbauer Edlen v. Hohenried (1668—1739).1 Daß
das Goldschmiedehandwerk kurz nach der Entstehung des Schrankes in Wien geblüht hat, geht aus
der Bruderschaftsordnung vom Jahre 1722 hervor, auf der über achtzig dem «Mittel» angehörende
Meister unterzeichnet sind. Daß es wenigstens einzelnen dieser Meister nicht an Beschäftigung gefehlt
hat, lehrt der § 22 derselben Ordnung, der verbietet, mit mehr als sechs Gesellen zu arbeiten, es müßte
sich denn um einen binnen wenigen Wochen auszuführenden kaiserlichen Auftrag handeln.2 Ob aber
z. B. die Arbeiten der sogenannten «hof befreiten» Meister der Punzierung haben entraten können, wie
dies bis zum Jahre 1744 bei sämtlichen Goldarbeiten der Fall gewesen zu sein scheint,3 ist ebenso wie
vieles andere Wichtige auf diesem Gebiete eine bisher noch ungelöste Frage.
Zum Schlüsse noch ein Wort über die Erhaltung des Eugen-Schrankes. Jedenfalls ist er unvoll-
ständig. Es fehlt der tisch- oder kastenartige Untersatz, zu dem sich im Laufe der Zeit jenes Gestell
entwickelt hat, das z. B. noch das kofferähnliche Hauptstück des spanischen Kabinetts aus dem XVI.
Jahrhundert trägt. Der mangelnde Unterbau wurde (erst im Hofmuseum) durch einen einfachen,
schwarz angestrichenen niederen Kasten ersetzt, der deutlich modern gehalten ist. An einzelnen Ge-
simspartien zeigen sich durch Nachfeilen entstandene alte Reparaturen. Die Restaurierungsarbeiten, die
vorgenommen wurden, seit sich das Möbel im Besitze des Hofmuseums befindet, bestanden fast nur in
Befestigungen und Reinigungen. Galvanoplastisch ergänzt wurden bloß kleine Teile der silbernen
ornamentalen Gesimsstreifen, nachgeschrieben wurden die oben als ergänzt vermerkten Schlachten-
namen, die durch ein Versehen des Tischlers weggeputzt, zum Glück aber vorher noch im Inventar
genau verzeichnet worden waren.
1 Camillo List, Zur Geschichte der Wiener Goldschmiedezunft: Berichte und Mitteilungen des Wiener Altertums-Ver-
eines zu Wien, Wien 1897, Bd. XXXIII, S. 157 a.
2 Eduard Leisching, Zur Geschichte der Wiener Gold- und Silberschmiedekunst: Kunst und Kunsthandwerk, Wien
1904, VII. Jahrg., S. 384 und 368.
' Karl Knies, Die Punzierung in Österreich, Wien 1896, S. 10.
Allegorische Gestalt.