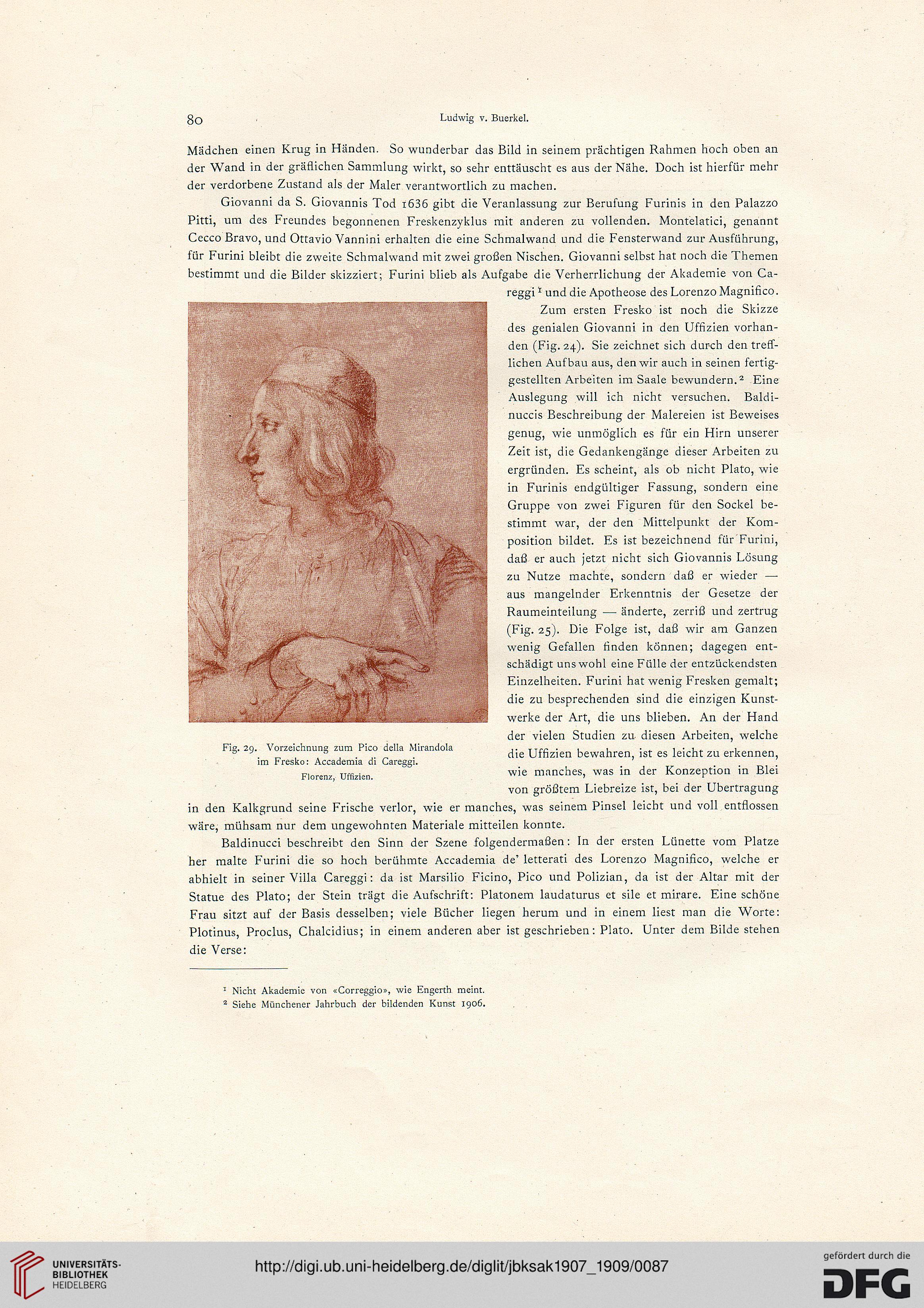8o
Ludwig v. Buerkel.
Mädchen einen Krug in Händen. So wunderbar das Bild in seinem prächtigen Rahmen hoch oben an
der Wand in der gräflichen Sammlung wirkt, so sehr enttäuscht es aus der Nähe. Doch ist hierfür mehr
der verdorbene Zustand als der Maler verantwortlich zu machen.
Giovanni da S. Giovannis Tod i636 gibt die Veranlassung zur Berufung Furinis in den Palazzo
Pitti, um des Freundes begonnenen Freskenzyklus mit anderen zu vollenden. Montelatici, genannt
Cecco Bravo, und Ottavio Vannini erhalten die eine Schmalwand und die Fensterwand zur Ausführung,
für Furini bleibt die zweite Schmalwand mit zwei großen Nischen. Giovanni selbst hat noch die Themen
bestimmt und die Bilder skizziert; Furini blieb als Aufgabe die Verherrlichung der Akademie von Ca-
reggi1 und die Apotheose des Lorenzo Magnifico.
Zum ersten Fresko ist noch die Skizze
des genialen Giovanni in den Uffizien vorhan-
den (Fig. 24). Sie zeichnet sich durch den treff-
lichen Aufbau aus, den wir auch in seinen fertig-
gestellten Arbeiten im Saale bewundern.2 Eine
Auslegung will ich nicht versuchen. Baldi-
nuccis Beschreibung der Malereien ist Beweises
genug, wie unmöglich es für ein Hirn unserer
Zeit ist, die Gedankengänge dieser Arbeiten zu
ergründen. Es scheint, als ob nicht Plato, wie
in Furinis endgültiger Fassung, sondern eine
Gruppe von zwei Figuren für den Sockel be-
stimmt war, der den Mittelpunkt der Kom-
position bildet. Es ist bezeichnend für Furini,
daß er auch jetzt nicht sich Giovannis Lösung
zu Nutze machte, sondern daß er wieder —
aus mangelnder Erkenntnis der Gesetze der
Raumeinteilung — änderte, zerriß und zertrug
(Fig. 25). Die Folge ist, daß wir am Ganzen
wenig Gefallen finden können; dagegen ent-
schädigt uns wohl eine Fülle der entzückendsten
Einzelheiten. Furini hat wenig Fresken gemalt;
die zu besprechenden sind die einzigen Kunst-
werke der Art, die uns blieben. An der Hand
der vielen Studien zu diesen Arbeiten, welche
die Uffizien bewahren, ist es leicht zu erkennen,
wie manches, was in der Konzeption in Blei
von größtem Liebreize ist, bei der Übertragung
in den Kalkgrund seine Frische verlor, wie er manches, was seinem Pinsel leicht und voll entflossen
wäre, mühsam nur dem ungewohnten Materiale mitteilen konnte.
Baldinucci beschreibt den Sinn der Szene folgendermaßen: In der ersten Lünette vom Platze
her malte F"urini die so hoch berühmte Accademia de' letterati des Lorenzo Magnifico, welche er
abhielt in seiner Villa Careggi: da ist Marsilio Ficino, Pico und Polizian, da ist der Altar mit der
Statue des Plato; der Stein trägt die Aufschrift: Platonem laudaturus et sile et mirare. Eine schöne
Frau sitzt auf der Basis desselben; viele Bücher liegen herum und in einem liest man die Worte:
Plotinus, Proclus, Chalcidius; in einem anderen aber ist geschrieben: Plato. Unter dem Bilde stehen
die Verse:
Fig. 29. Vorzeichnung zum Pico della Mirandola
im Fresko: Accademia di Careggi.
Florenz, Uffizien.
1 Nicht Akademie von «Correggio», wie Engerth meint.
2 Siehe Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1906.
Ludwig v. Buerkel.
Mädchen einen Krug in Händen. So wunderbar das Bild in seinem prächtigen Rahmen hoch oben an
der Wand in der gräflichen Sammlung wirkt, so sehr enttäuscht es aus der Nähe. Doch ist hierfür mehr
der verdorbene Zustand als der Maler verantwortlich zu machen.
Giovanni da S. Giovannis Tod i636 gibt die Veranlassung zur Berufung Furinis in den Palazzo
Pitti, um des Freundes begonnenen Freskenzyklus mit anderen zu vollenden. Montelatici, genannt
Cecco Bravo, und Ottavio Vannini erhalten die eine Schmalwand und die Fensterwand zur Ausführung,
für Furini bleibt die zweite Schmalwand mit zwei großen Nischen. Giovanni selbst hat noch die Themen
bestimmt und die Bilder skizziert; Furini blieb als Aufgabe die Verherrlichung der Akademie von Ca-
reggi1 und die Apotheose des Lorenzo Magnifico.
Zum ersten Fresko ist noch die Skizze
des genialen Giovanni in den Uffizien vorhan-
den (Fig. 24). Sie zeichnet sich durch den treff-
lichen Aufbau aus, den wir auch in seinen fertig-
gestellten Arbeiten im Saale bewundern.2 Eine
Auslegung will ich nicht versuchen. Baldi-
nuccis Beschreibung der Malereien ist Beweises
genug, wie unmöglich es für ein Hirn unserer
Zeit ist, die Gedankengänge dieser Arbeiten zu
ergründen. Es scheint, als ob nicht Plato, wie
in Furinis endgültiger Fassung, sondern eine
Gruppe von zwei Figuren für den Sockel be-
stimmt war, der den Mittelpunkt der Kom-
position bildet. Es ist bezeichnend für Furini,
daß er auch jetzt nicht sich Giovannis Lösung
zu Nutze machte, sondern daß er wieder —
aus mangelnder Erkenntnis der Gesetze der
Raumeinteilung — änderte, zerriß und zertrug
(Fig. 25). Die Folge ist, daß wir am Ganzen
wenig Gefallen finden können; dagegen ent-
schädigt uns wohl eine Fülle der entzückendsten
Einzelheiten. Furini hat wenig Fresken gemalt;
die zu besprechenden sind die einzigen Kunst-
werke der Art, die uns blieben. An der Hand
der vielen Studien zu diesen Arbeiten, welche
die Uffizien bewahren, ist es leicht zu erkennen,
wie manches, was in der Konzeption in Blei
von größtem Liebreize ist, bei der Übertragung
in den Kalkgrund seine Frische verlor, wie er manches, was seinem Pinsel leicht und voll entflossen
wäre, mühsam nur dem ungewohnten Materiale mitteilen konnte.
Baldinucci beschreibt den Sinn der Szene folgendermaßen: In der ersten Lünette vom Platze
her malte F"urini die so hoch berühmte Accademia de' letterati des Lorenzo Magnifico, welche er
abhielt in seiner Villa Careggi: da ist Marsilio Ficino, Pico und Polizian, da ist der Altar mit der
Statue des Plato; der Stein trägt die Aufschrift: Platonem laudaturus et sile et mirare. Eine schöne
Frau sitzt auf der Basis desselben; viele Bücher liegen herum und in einem liest man die Worte:
Plotinus, Proclus, Chalcidius; in einem anderen aber ist geschrieben: Plato. Unter dem Bilde stehen
die Verse:
Fig. 29. Vorzeichnung zum Pico della Mirandola
im Fresko: Accademia di Careggi.
Florenz, Uffizien.
1 Nicht Akademie von «Correggio», wie Engerth meint.
2 Siehe Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1906.