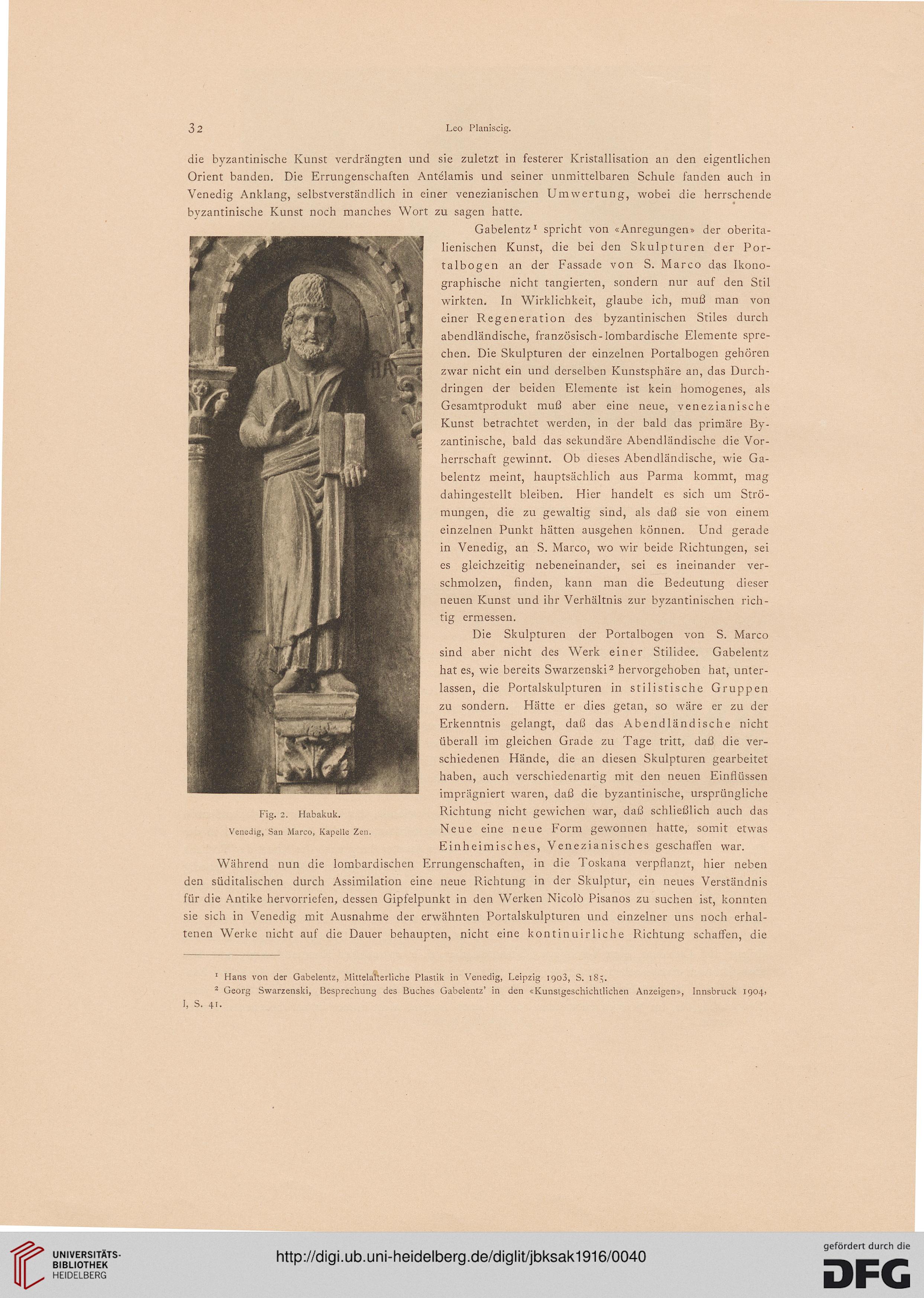32
Leo Planiscig.
die byzantinische Kunst verdrängten und sie zuletzt in festerer Kristallisation an den eigentlichen
Orient banden. Die Errungenschaften Antelamis und seiner unmittelbaren Schule fanden auch in
Venedig Anklang, selbstverständlich in einer venezianischen Umwertung, wobei die herrschende
byzantinische Kunst noch manches Wort zu sagen hatte.
Gabelentz1 spricht von «Anregungen» der oberita-
lienischen Kunst, die bei den Skulpturen der Por-
talbogen an der Fassade von S. Marco das Ikono-
graphische nicht tangierten, sondern nur auf den Stil
wirkten. In Wirklichkeit, glaube ich, muß man von
einer Regeneration des byzantinischen Stiles durch
abendländische, französisch-lombardische Elemente spre-
chen. Die Skulpturen der einzelnen Portalbogen gehören
zwar nicht ein und derselben Kunstsphäre an, das Durch-
dringen der beiden Elemente ist kein homogenes, als
Gesamtprodukt muß aber eine neue, venezianische
Kunst betrachtet werden, in der bald das primäre By-
zantinische, bald das sekundäre Abendländische die Vor-
herrschaft gewinnt. Ob dieses Abendländische, wie Ga-
belentz meint, hauptsächlich aus Parma kommt, mag
dahingestellt bleiben. Hier handelt es sich um Strö-
mungen, die zu gewaltig sind, als daß sie von einem
einzelnen Punkt hätten ausgehen können. Und gerade
in Venedig, an S. Marco, wo wir beide Richtungen, sei
es gleichzeitig nebeneinander, sei es ineinander ver-
schmolzen, finden, kann man die Bedeutung dieser
neuen Kunst und ihr Verhältnis zur byzantinischen rich-
tig ermessen.
Die Skulpturen der Portalbogen von S. Marco
sind aber nicht des Werk einer Stilidee. Gabelentz
hat es, wie bereits Swarzenski2 hervorgehoben hat, unter-
lassen, die Portalskulpturen in stilistische Gruppen
zu sondern. Hätte er dies getan, so wäre er zu der
Erkenntnis gelangt, daß das Abendländische nicht
überall im gleichen Grade zu Tage tritt, daß die ver-
schiedenen Hände, die an diesen Skulpturen gearbeitet
haben, auch verschiedenartig mit den neuen Einflüssen
imprägniert waren, daß die byzantinische, ursprüngliche
Richtung nicht gewichen war, daß schließlich auch das
Neue eine neue Form gewonnen hatte, somit etwas
Einheimisches, Venezianisches geschaffen war.
Während nun die lombardischen Errungenschaften, in die Toskana verpflanzt, hier neben
den süditalischen durch Assimilation eine neue Richtung in der Skulptur, ein neues Verständnis
für die Antike hervorriefen, dessen Gipfelpunkt in den Werken Nicolö Pisanos zu suchen ist, konnten
sie sich in Venedig mit Ausnahme der erwähnten Portalskulpturen und einzelner uns noch erhal-
tenen Werke nicht auf die Dauer behaupten, nicht eine kontinuirliche Richtung schaffen, die
Fig. 2. Habakuk.
Venedig, San Marco, Kapelle Zen.
1 Hans von der Gabelentz, Mittelatterliche Plastik in Venedig, Leipzig igo3, S. 18;.
2 Georg Swarzenski, Besprechung des Buches Gabelentz' in den «Kunstgeschichtlichen Anzeigen», Innsbruck 1904.1
I, S. 41.
Leo Planiscig.
die byzantinische Kunst verdrängten und sie zuletzt in festerer Kristallisation an den eigentlichen
Orient banden. Die Errungenschaften Antelamis und seiner unmittelbaren Schule fanden auch in
Venedig Anklang, selbstverständlich in einer venezianischen Umwertung, wobei die herrschende
byzantinische Kunst noch manches Wort zu sagen hatte.
Gabelentz1 spricht von «Anregungen» der oberita-
lienischen Kunst, die bei den Skulpturen der Por-
talbogen an der Fassade von S. Marco das Ikono-
graphische nicht tangierten, sondern nur auf den Stil
wirkten. In Wirklichkeit, glaube ich, muß man von
einer Regeneration des byzantinischen Stiles durch
abendländische, französisch-lombardische Elemente spre-
chen. Die Skulpturen der einzelnen Portalbogen gehören
zwar nicht ein und derselben Kunstsphäre an, das Durch-
dringen der beiden Elemente ist kein homogenes, als
Gesamtprodukt muß aber eine neue, venezianische
Kunst betrachtet werden, in der bald das primäre By-
zantinische, bald das sekundäre Abendländische die Vor-
herrschaft gewinnt. Ob dieses Abendländische, wie Ga-
belentz meint, hauptsächlich aus Parma kommt, mag
dahingestellt bleiben. Hier handelt es sich um Strö-
mungen, die zu gewaltig sind, als daß sie von einem
einzelnen Punkt hätten ausgehen können. Und gerade
in Venedig, an S. Marco, wo wir beide Richtungen, sei
es gleichzeitig nebeneinander, sei es ineinander ver-
schmolzen, finden, kann man die Bedeutung dieser
neuen Kunst und ihr Verhältnis zur byzantinischen rich-
tig ermessen.
Die Skulpturen der Portalbogen von S. Marco
sind aber nicht des Werk einer Stilidee. Gabelentz
hat es, wie bereits Swarzenski2 hervorgehoben hat, unter-
lassen, die Portalskulpturen in stilistische Gruppen
zu sondern. Hätte er dies getan, so wäre er zu der
Erkenntnis gelangt, daß das Abendländische nicht
überall im gleichen Grade zu Tage tritt, daß die ver-
schiedenen Hände, die an diesen Skulpturen gearbeitet
haben, auch verschiedenartig mit den neuen Einflüssen
imprägniert waren, daß die byzantinische, ursprüngliche
Richtung nicht gewichen war, daß schließlich auch das
Neue eine neue Form gewonnen hatte, somit etwas
Einheimisches, Venezianisches geschaffen war.
Während nun die lombardischen Errungenschaften, in die Toskana verpflanzt, hier neben
den süditalischen durch Assimilation eine neue Richtung in der Skulptur, ein neues Verständnis
für die Antike hervorriefen, dessen Gipfelpunkt in den Werken Nicolö Pisanos zu suchen ist, konnten
sie sich in Venedig mit Ausnahme der erwähnten Portalskulpturen und einzelner uns noch erhal-
tenen Werke nicht auf die Dauer behaupten, nicht eine kontinuirliche Richtung schaffen, die
Fig. 2. Habakuk.
Venedig, San Marco, Kapelle Zen.
1 Hans von der Gabelentz, Mittelatterliche Plastik in Venedig, Leipzig igo3, S. 18;.
2 Georg Swarzenski, Besprechung des Buches Gabelentz' in den «Kunstgeschichtlichen Anzeigen», Innsbruck 1904.1
I, S. 41.