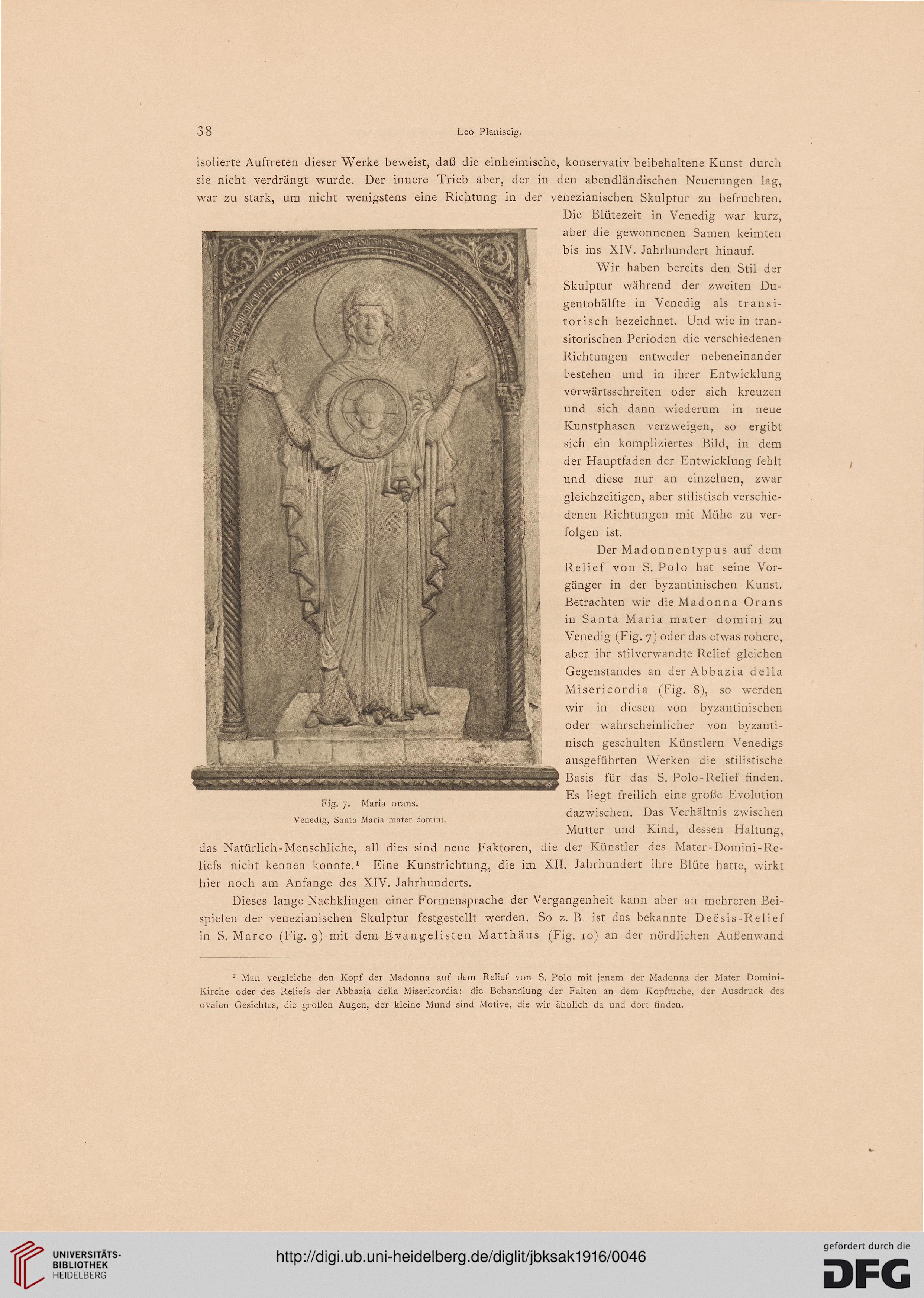38
Leo Planiscig.
isolierte Auftreten dieser Werke beweist, daß die einheimische, konservativ beibehaltene Kunst durch
sie nicht verdrängt wurde. Der innere Trieb aber, der in den abendländischen Neuerungen lag,
war zu stark, um nicht wenigstens eine Richtung in der venezianischen Skulptur zu befruchten.
Die Blütezeit in Venedig war kurz,
aber die gewonnenen Samen keimten
bis ins XIV. Jahrhundert hinauf.
Wir haben bereits den Stil der
Skulptur während der zweiten Du-
gentohälfte in Venedig als transi-
torisch bezeichnet. Und wie in tran-
sitorischen Perioden die verschiedenen
Richtungen entweder nebeneinander
bestehen und in ihrer Entwicklung
vorwärtsschreiten oder sich kreuzen
und sich dann wiederum in neue
Kunstphasen verzweigen, so ergibt
sich ein kompliziertes Bild, in dem
der Hauptfaden der Entwicklung fehlt
und diese nur an einzelnen, zwar
gleichzeitigen, aber stilistisch verschie-
denen Richtungen mit Mühe zu ver-
folgen ist.
Der Madonnentypus auf dem
Relief von S. Polo hat seine Vor-
gänger in der byzantinischen Kunst.
Betrachten wir die Madonna Orans
in Santa Maria mater domini zu
Venedig (Fig. 7) oder das etwas rohere,
aber ihr stilverwandte Relief gleichen
Gegenstandes an der Abbazia della
Misericordia (Fig. 8), so werden
wir in diesen von byzantinischen
oder wahrscheinlicher von bvzanti-
nisch geschulten Künstlern Venedigs
ausgeführten Werken die stilistische
Basis für das S. Polo-Relief finden.
Es liegt freilich eine grofJe Evolution
dazwischen. Das Verhältnis zwischen
Mutter und Kind, dessen Haltung,
das Natürlich-Menschliche, all dies sind neue Faktoren, die der Künstler des Mater-Domini-Re-
licfs nicht kennen konnte.1 Eine Kunstrichtung, die im XII. Jahrhundert ihre Blüte hatte, wirkt
hier noch am Anfange des XIV. Jahrhunderts.
Dieses lange Nachklingen einer Formensprache der Vergangenheit kann aber an mehreren Bei-
spielen der venezianischen Skulptur festgestellt werden. So z. B. ist das bekannte Deesis-Relief
in S. Marco (Fig. 9) mit dem Evangelisten Matthäus (Fig. 10) an der nördlichen Außenwand
Fig. 7. Maria orans.
Venedig, Santa Maria mater domini.
1 Man vergleiche den Kopf der Madonna auf dem Relief von S. Polo mit jenem der Madonna der Mater Domini-
Kirche oder des Reliefs der Abbazia della Misericordia: die Behandlung der Falten an dem Kopftuche, der Ausdruck des
ovalen Gesichtes, die großen Augen, der kleine Mund sind Motive, die wir ähnlich da und dort finden.
Leo Planiscig.
isolierte Auftreten dieser Werke beweist, daß die einheimische, konservativ beibehaltene Kunst durch
sie nicht verdrängt wurde. Der innere Trieb aber, der in den abendländischen Neuerungen lag,
war zu stark, um nicht wenigstens eine Richtung in der venezianischen Skulptur zu befruchten.
Die Blütezeit in Venedig war kurz,
aber die gewonnenen Samen keimten
bis ins XIV. Jahrhundert hinauf.
Wir haben bereits den Stil der
Skulptur während der zweiten Du-
gentohälfte in Venedig als transi-
torisch bezeichnet. Und wie in tran-
sitorischen Perioden die verschiedenen
Richtungen entweder nebeneinander
bestehen und in ihrer Entwicklung
vorwärtsschreiten oder sich kreuzen
und sich dann wiederum in neue
Kunstphasen verzweigen, so ergibt
sich ein kompliziertes Bild, in dem
der Hauptfaden der Entwicklung fehlt
und diese nur an einzelnen, zwar
gleichzeitigen, aber stilistisch verschie-
denen Richtungen mit Mühe zu ver-
folgen ist.
Der Madonnentypus auf dem
Relief von S. Polo hat seine Vor-
gänger in der byzantinischen Kunst.
Betrachten wir die Madonna Orans
in Santa Maria mater domini zu
Venedig (Fig. 7) oder das etwas rohere,
aber ihr stilverwandte Relief gleichen
Gegenstandes an der Abbazia della
Misericordia (Fig. 8), so werden
wir in diesen von byzantinischen
oder wahrscheinlicher von bvzanti-
nisch geschulten Künstlern Venedigs
ausgeführten Werken die stilistische
Basis für das S. Polo-Relief finden.
Es liegt freilich eine grofJe Evolution
dazwischen. Das Verhältnis zwischen
Mutter und Kind, dessen Haltung,
das Natürlich-Menschliche, all dies sind neue Faktoren, die der Künstler des Mater-Domini-Re-
licfs nicht kennen konnte.1 Eine Kunstrichtung, die im XII. Jahrhundert ihre Blüte hatte, wirkt
hier noch am Anfange des XIV. Jahrhunderts.
Dieses lange Nachklingen einer Formensprache der Vergangenheit kann aber an mehreren Bei-
spielen der venezianischen Skulptur festgestellt werden. So z. B. ist das bekannte Deesis-Relief
in S. Marco (Fig. 9) mit dem Evangelisten Matthäus (Fig. 10) an der nördlichen Außenwand
Fig. 7. Maria orans.
Venedig, Santa Maria mater domini.
1 Man vergleiche den Kopf der Madonna auf dem Relief von S. Polo mit jenem der Madonna der Mater Domini-
Kirche oder des Reliefs der Abbazia della Misericordia: die Behandlung der Falten an dem Kopftuche, der Ausdruck des
ovalen Gesichtes, die großen Augen, der kleine Mund sind Motive, die wir ähnlich da und dort finden.