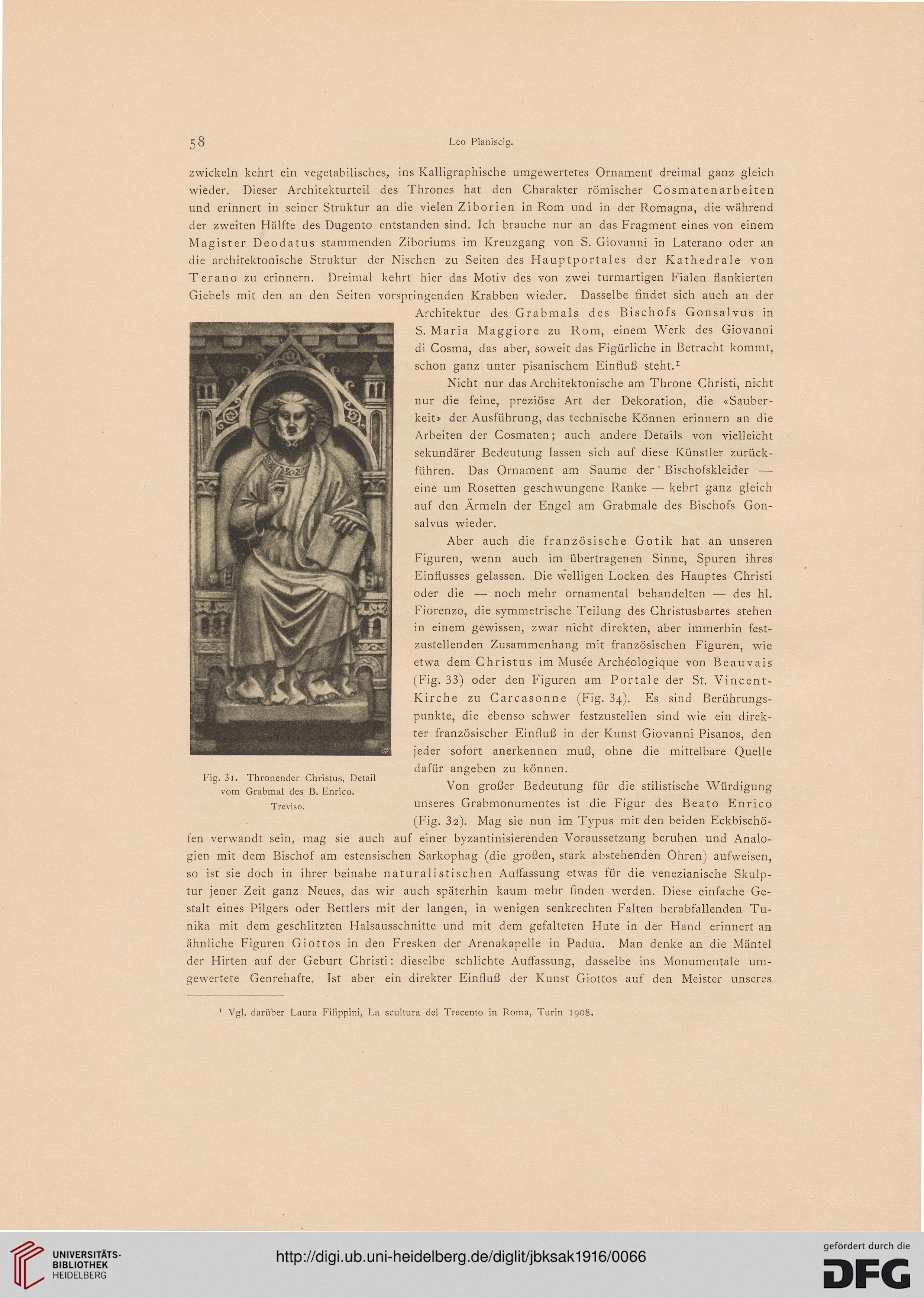58
Leo Planiscig.
zwickein kehrt ein vegetabilisches, ins Kalligraphische umgewertetes Ornament dreimal ganz gleich
wieder. Dieser Architekturteil des Thrones hat den Charakter römischer Cosmatenarbeiten
und erinnert in seiner Struktur an die vielen Ziborien in Rom und in der Romagna, die während
der zweiten Hälfte des Dugento entstanden sind. Ich brauche nur an das Fragment eines von einem
Magister Deodatus stammenden Ziboriums im Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano oder an
die architektonische Struktur der Nischen zu Seiten des Hauptportales der Kathedrale von
Terano zu erinnern. Dreimal kehrt hier das Motiv des von zwei turmartigen Fialen flankierten
Giebels mit den an den Seiten vorspringenden Krabben wieder. Dasselbe findet sich auch an der
Architektur des Grabmals des Bischofs Gonsalvus in
S. Maria Maggiore zu Rom, einem Werk des Giovanni
di Cosma, das aber, soweit das Figürliche in Betracht kommt,
schon ganz unter pisanischem Einfluß steht.1
Nicht nur das Architektonische am Throne Christi, nicht
nur die feine, preziöse Art der Dekoration, die «Sauber-
keit» der Ausführung, das technische Können erinnern an die
Arbeiten der Cosmaten; auch andere Details von vielleicht
sekundärer Bedeutung lassen sich auf diese Künstler zurück-
führen. Das Ornament am Saume der ' Bischofskleider —
eine um Rosetten geschwungene Ranke — kehrt ganz gleich
auf den Ärmeln der Engel am Grabmale des Bischofs Gon-
salvus wieder.
Aber auch die französische Gotik hat an unseren
Figuren, wenn auch im übertragenen Sinne, Spuren ihres
Einflusses gelassen. Die welligen Locken des Hauptes Christi
oder die — noch mehr ornamental behandelten — des hl.
Fiorenzo, die symmetrische Teilung des Christusbartes stehen
in einem gewissen, zwar nicht direkten, aber immerhin fest-
zustellenden Zusammenhang mit französischen Figuren, wie
etwa dem Christus im Musee Archeologique von Beauvais
(Fig. 33) oder den Figuren am Portale der St. Vincent-
Kirche zu Carcasonne (Fig. 34). Es sind Berührungs-
punkte, die ebenso schwer festzustellen sind wie ein direk-
ter französischer Einfluß in der Kunst Giovanni Pisanos, den
jeder sofort anerkennen muß, ohne die mittelbare Quelle
dafür angeben zu können.
Von großer Bedeutung für die stilistische Würdigung
unseres Grabmonumentes ist die Figur des Beato Enrico
(Fig. 32). Mag sie nun im Typus mit den beiden Eckbischö-
fen verwandt sein, mag sie auch auf einer byzantinisierenden Voraussetzung beruhen und Analo-
gien mit dem Bischof am estensischen Sarkophag (die großen, stark abstehenden Ohren) aufweisen,
so ist sie doch in ihrer beinahe naturalistischen Auffassung etwas für die venezianische Skulp-
tur jener Zeit ganz Neues, das wir auch späterhin kaum mehr finden werden. Diese einfache Ge-
stalt eines Pilgers oder Bettlers mit der langen, in wenigen senkrechten Falten herabfallenden Tu-
nika mit dem geschlitzten Halsausschnitte und mit dem gefalteten Hute in der Hand erinnert an
ähnliche Figuren Giottos in den Fresken der Arenakapelle in Padua. Man denke an die Mäntel
der Hirten auf der Geburt Christi: dieselbe schlichte Auffassung, dasselbe ins Monumentale um-
gewertete Genrehafte. Ist aber ein direkter Einfluß der Kunst Giottos auf den Meister unseres
Fig. 3i. Thronender Christus, Detail
vom Grabmal des B. Enrico.
Treviso.
1 Vgl. darüber Laura Filippini, La scultura dcl Trecento in Roma, Turin 1908.
Leo Planiscig.
zwickein kehrt ein vegetabilisches, ins Kalligraphische umgewertetes Ornament dreimal ganz gleich
wieder. Dieser Architekturteil des Thrones hat den Charakter römischer Cosmatenarbeiten
und erinnert in seiner Struktur an die vielen Ziborien in Rom und in der Romagna, die während
der zweiten Hälfte des Dugento entstanden sind. Ich brauche nur an das Fragment eines von einem
Magister Deodatus stammenden Ziboriums im Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano oder an
die architektonische Struktur der Nischen zu Seiten des Hauptportales der Kathedrale von
Terano zu erinnern. Dreimal kehrt hier das Motiv des von zwei turmartigen Fialen flankierten
Giebels mit den an den Seiten vorspringenden Krabben wieder. Dasselbe findet sich auch an der
Architektur des Grabmals des Bischofs Gonsalvus in
S. Maria Maggiore zu Rom, einem Werk des Giovanni
di Cosma, das aber, soweit das Figürliche in Betracht kommt,
schon ganz unter pisanischem Einfluß steht.1
Nicht nur das Architektonische am Throne Christi, nicht
nur die feine, preziöse Art der Dekoration, die «Sauber-
keit» der Ausführung, das technische Können erinnern an die
Arbeiten der Cosmaten; auch andere Details von vielleicht
sekundärer Bedeutung lassen sich auf diese Künstler zurück-
führen. Das Ornament am Saume der ' Bischofskleider —
eine um Rosetten geschwungene Ranke — kehrt ganz gleich
auf den Ärmeln der Engel am Grabmale des Bischofs Gon-
salvus wieder.
Aber auch die französische Gotik hat an unseren
Figuren, wenn auch im übertragenen Sinne, Spuren ihres
Einflusses gelassen. Die welligen Locken des Hauptes Christi
oder die — noch mehr ornamental behandelten — des hl.
Fiorenzo, die symmetrische Teilung des Christusbartes stehen
in einem gewissen, zwar nicht direkten, aber immerhin fest-
zustellenden Zusammenhang mit französischen Figuren, wie
etwa dem Christus im Musee Archeologique von Beauvais
(Fig. 33) oder den Figuren am Portale der St. Vincent-
Kirche zu Carcasonne (Fig. 34). Es sind Berührungs-
punkte, die ebenso schwer festzustellen sind wie ein direk-
ter französischer Einfluß in der Kunst Giovanni Pisanos, den
jeder sofort anerkennen muß, ohne die mittelbare Quelle
dafür angeben zu können.
Von großer Bedeutung für die stilistische Würdigung
unseres Grabmonumentes ist die Figur des Beato Enrico
(Fig. 32). Mag sie nun im Typus mit den beiden Eckbischö-
fen verwandt sein, mag sie auch auf einer byzantinisierenden Voraussetzung beruhen und Analo-
gien mit dem Bischof am estensischen Sarkophag (die großen, stark abstehenden Ohren) aufweisen,
so ist sie doch in ihrer beinahe naturalistischen Auffassung etwas für die venezianische Skulp-
tur jener Zeit ganz Neues, das wir auch späterhin kaum mehr finden werden. Diese einfache Ge-
stalt eines Pilgers oder Bettlers mit der langen, in wenigen senkrechten Falten herabfallenden Tu-
nika mit dem geschlitzten Halsausschnitte und mit dem gefalteten Hute in der Hand erinnert an
ähnliche Figuren Giottos in den Fresken der Arenakapelle in Padua. Man denke an die Mäntel
der Hirten auf der Geburt Christi: dieselbe schlichte Auffassung, dasselbe ins Monumentale um-
gewertete Genrehafte. Ist aber ein direkter Einfluß der Kunst Giottos auf den Meister unseres
Fig. 3i. Thronender Christus, Detail
vom Grabmal des B. Enrico.
Treviso.
1 Vgl. darüber Laura Filippini, La scultura dcl Trecento in Roma, Turin 1908.