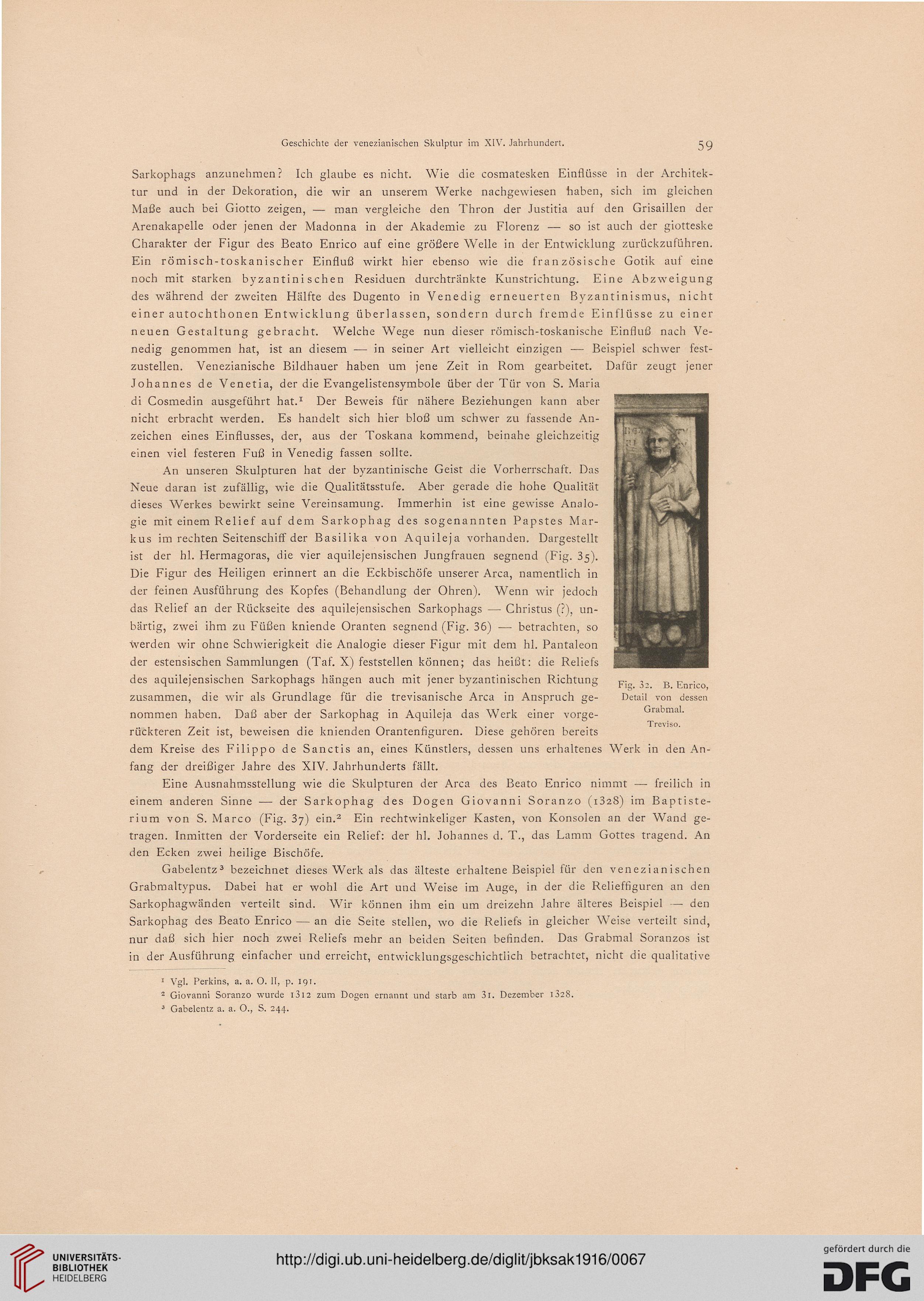Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.
59
Sarkophags anzunehmen? Ich glaube es nicht. Wie die cosmatesken Einflüsse in der Architek-
tur und in der Dekoration, die wir an unserem Werke nachgewiesen haben, sich im gleichen
Maße auch bei Giotto zeigen, — man vergleiche den Thron der Justitia auf den Grisaillen der
Arenakapelle oder jenen der Madonna in der Akademie zu Florenz — so ist auch der giotteske
Charakter der Figur des Beato Enrico auf eine größere Welle in der Entwicklung zurückzufuhren.
Ein römisch-toskanischer Einfluß wirkt hier ebenso wie die französische Gotik aut eine
noch mit starken byzantinischen Residuen durchtränkte Kunstrichtung. Eine Abzweigung
des während der zweiten Hälfte des Dugento in Venedig erneuerten Byzantinismus, nicht
einer autochthonen Entwicklung überlassen, sondern durch fremde Einflüsse zu einer
neuen Gestaltung gebracht. Welche Wege nun dieser römisch-toskanische Einfluß nach Ve-
nedig genommen hat, ist an diesem — in seiner Art vielleicht einzigen — Beispiel schwer fest-
zustellen. Venezianische Bildhauer haben um jene Zeit in Rom gearbeitet. Dafür zeugt jener
Johannes de Venetia, der die Evangelistensymbole über der Tür von S. Maria
di Cosmedin ausgeführt hat.1 Der Beweis für nähere Beziehungen kann aber
nicht erbracht werden. Es handelt sich hier bloß um schwer zu fassende An-
zeichen eines Einflusses, der, aus der Toskana kommend, beinahe gleichzeitig
einen viel festeren Fuß in Venedig fassen sollte.
An unseren Skulpturen hat der byzantinische Geist die Vorherrschaft. Das
Neue daran ist zufällig, wie die Qualitätsstufe. Aber gerade die hohe Qualität
dieses Werkes bewirkt seine Vereinsamung. Immerhin ist eine gewisse Analo-
gie mit einem Relief auf dem Sarkophag des sogenannten Papstes Mar-
kus im rechten Seitenschiff der Basilika von Aquileja vorhanden. Dargestellt
ist der hl. Hermagoras, die vier aquilejensischen Jungfrauen segnend (Fig. 35).
Die Figur des Heiligen erinnert an die Eckbischöfe unserer Area, namentlich in
der feinen Ausführung des Kopfes (Behandlung der Ohren). Wenn wir jedoch
das Relief an der Rückseite des aquilejensischen Sarkophags — Christus (?), un-
bärtig, zwei ihm zu Füßen kniende Oranten segnend (Fig. 36) — betrachten, so
werden wir ohne Schwierigkeit die Analogie dieser Figur mit dem hl. Pantaleon
der estensischen Sammlungen (Taf. X) feststellen können; das heißt: die Reliefs
des aquilejensischen Sarkophags hängen auch mit jener byzantinischen Richtung
zusammen, die wir als Grundlage für die trevisanische Area in Anspruch ge-
nommen haben. Daß aber der Sarkophag in Aquileja das Werk einer vorge-
rückteren Zeit ist, beweisen die knienden Orantenfiguren. Diese gehören bereits
dem Kreise des Filippo de Sanctis an, eines Künstlers, dessen uns erhaltenes Werk in den An-
fang der dreißiger Jahre des XIV. Jahrhunderts fällt.
Eine Ausnahmsstellung wie die Skulpturen der Area des Beato Enrico nimmt — freilich in
einem anderen Sinne — der Sarkophag des Dogen Giovanni Soranzo (1328) im Baptiste-
rium von S. Marco (Fig. 37) ein.2 Ein rechtwinkeliger Kasten, von Konsolen an der Wand ge-
tragen. Inmitten der Vorderseite ein Relief: der hl. Johannes d. T., das Lamm Gottes tragend. An
den Ecken zwei heilige Bischöfe.
Gabelentz3 bezeichnet dieses Werk als das älteste erhaltene Beispiel für den venezianischen
Grabmaltypus. Dabei hat er wohl die Art und Weise im Auge, in der die Reliefriguren an den
Sarkophagwänden verteilt sind. Wir können ihm ein um dreizehn Jahre älteres Beispiel — den
Sarkophag des Beato Enrico — an die Seite stellen, wo die Reliefs in gleicher Weise verteilt sind,
nur daß sich hier noch zwei Reliefs mehr an beiden Seiten befinden. Das Grabmal Soranzos ist
in der Ausführung einfacher und erreicht, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nicht die qualitative
1 Vgl. Perkins, a. a. O. II, p. 191.
2 Giovanni Soranzo wurde 1312 zum Dogen ernannt und starb am 3l. Dezember i328.
J Gabelentz a. a. O., S. 244.
Fig. 32. B. Enrico,
Detail von dessen
Grabmal.
Treviso.
59
Sarkophags anzunehmen? Ich glaube es nicht. Wie die cosmatesken Einflüsse in der Architek-
tur und in der Dekoration, die wir an unserem Werke nachgewiesen haben, sich im gleichen
Maße auch bei Giotto zeigen, — man vergleiche den Thron der Justitia auf den Grisaillen der
Arenakapelle oder jenen der Madonna in der Akademie zu Florenz — so ist auch der giotteske
Charakter der Figur des Beato Enrico auf eine größere Welle in der Entwicklung zurückzufuhren.
Ein römisch-toskanischer Einfluß wirkt hier ebenso wie die französische Gotik aut eine
noch mit starken byzantinischen Residuen durchtränkte Kunstrichtung. Eine Abzweigung
des während der zweiten Hälfte des Dugento in Venedig erneuerten Byzantinismus, nicht
einer autochthonen Entwicklung überlassen, sondern durch fremde Einflüsse zu einer
neuen Gestaltung gebracht. Welche Wege nun dieser römisch-toskanische Einfluß nach Ve-
nedig genommen hat, ist an diesem — in seiner Art vielleicht einzigen — Beispiel schwer fest-
zustellen. Venezianische Bildhauer haben um jene Zeit in Rom gearbeitet. Dafür zeugt jener
Johannes de Venetia, der die Evangelistensymbole über der Tür von S. Maria
di Cosmedin ausgeführt hat.1 Der Beweis für nähere Beziehungen kann aber
nicht erbracht werden. Es handelt sich hier bloß um schwer zu fassende An-
zeichen eines Einflusses, der, aus der Toskana kommend, beinahe gleichzeitig
einen viel festeren Fuß in Venedig fassen sollte.
An unseren Skulpturen hat der byzantinische Geist die Vorherrschaft. Das
Neue daran ist zufällig, wie die Qualitätsstufe. Aber gerade die hohe Qualität
dieses Werkes bewirkt seine Vereinsamung. Immerhin ist eine gewisse Analo-
gie mit einem Relief auf dem Sarkophag des sogenannten Papstes Mar-
kus im rechten Seitenschiff der Basilika von Aquileja vorhanden. Dargestellt
ist der hl. Hermagoras, die vier aquilejensischen Jungfrauen segnend (Fig. 35).
Die Figur des Heiligen erinnert an die Eckbischöfe unserer Area, namentlich in
der feinen Ausführung des Kopfes (Behandlung der Ohren). Wenn wir jedoch
das Relief an der Rückseite des aquilejensischen Sarkophags — Christus (?), un-
bärtig, zwei ihm zu Füßen kniende Oranten segnend (Fig. 36) — betrachten, so
werden wir ohne Schwierigkeit die Analogie dieser Figur mit dem hl. Pantaleon
der estensischen Sammlungen (Taf. X) feststellen können; das heißt: die Reliefs
des aquilejensischen Sarkophags hängen auch mit jener byzantinischen Richtung
zusammen, die wir als Grundlage für die trevisanische Area in Anspruch ge-
nommen haben. Daß aber der Sarkophag in Aquileja das Werk einer vorge-
rückteren Zeit ist, beweisen die knienden Orantenfiguren. Diese gehören bereits
dem Kreise des Filippo de Sanctis an, eines Künstlers, dessen uns erhaltenes Werk in den An-
fang der dreißiger Jahre des XIV. Jahrhunderts fällt.
Eine Ausnahmsstellung wie die Skulpturen der Area des Beato Enrico nimmt — freilich in
einem anderen Sinne — der Sarkophag des Dogen Giovanni Soranzo (1328) im Baptiste-
rium von S. Marco (Fig. 37) ein.2 Ein rechtwinkeliger Kasten, von Konsolen an der Wand ge-
tragen. Inmitten der Vorderseite ein Relief: der hl. Johannes d. T., das Lamm Gottes tragend. An
den Ecken zwei heilige Bischöfe.
Gabelentz3 bezeichnet dieses Werk als das älteste erhaltene Beispiel für den venezianischen
Grabmaltypus. Dabei hat er wohl die Art und Weise im Auge, in der die Reliefriguren an den
Sarkophagwänden verteilt sind. Wir können ihm ein um dreizehn Jahre älteres Beispiel — den
Sarkophag des Beato Enrico — an die Seite stellen, wo die Reliefs in gleicher Weise verteilt sind,
nur daß sich hier noch zwei Reliefs mehr an beiden Seiten befinden. Das Grabmal Soranzos ist
in der Ausführung einfacher und erreicht, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nicht die qualitative
1 Vgl. Perkins, a. a. O. II, p. 191.
2 Giovanni Soranzo wurde 1312 zum Dogen ernannt und starb am 3l. Dezember i328.
J Gabelentz a. a. O., S. 244.
Fig. 32. B. Enrico,
Detail von dessen
Grabmal.
Treviso.