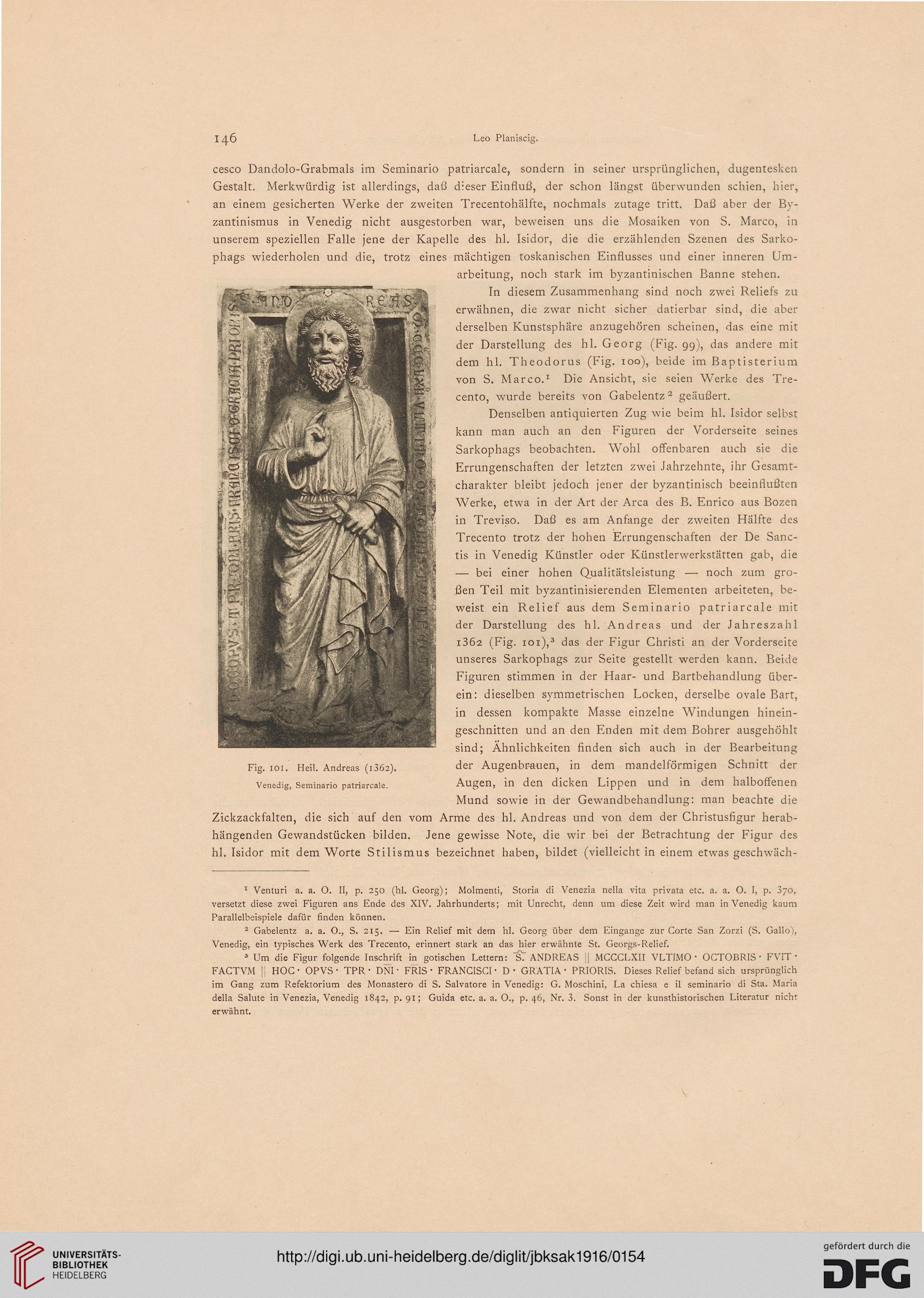146
Leo Planiscig.
cesco Dandolo-Grabmals im Seminario patriarcale, sondern in seiner ursprunglichen, dugentesken
Gestalt. Merkwürdig ist allerdings, daß dieser Einfluß, der schon längst überwunden schien, hier,
an einem gesicherten Werke der zweiten Trecentohälfte, nochmals zutage tritt. Daß aber der By-
zantinismus in Venedig nicht ausgestorben war, beweisen uns die Mosaiken von S. Marco, in
unserem speziellen Falle jene der Kapelle des hl. Isidor, die die erzählenden Szenen des Sarko-
phags wiederholen und die, trotz eines mächtigen toskanischen Einflusses und einer inneren Um-
arbeitung, noch stark im byzantinischen Banne stehen.
In diesem Zusammenhang sind noch zwei Reliefs zu
erwähnen, die zwar nicht sicher datierbar sind, die aber
derselben Kunstsphäre anzugehören scheinen, das eine mit
der Darstellung des hl. Georg (Fig. 99), das andere mit
dem hl. Theodorus (Fig. 100), beide im Baptisterium
von S. Marco.1 Die Ansicht, sie seien Werke des Tre-
cento, wurde bereits von Gabelentz2 geäußert.
Denselben antiquierten Zug wie beim hl. Isidor selbst
kann man auch an den Figuren der Vorderseite seines
Sarkophags beobachten. Wohl offenbaren auch sie die
Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte, ihr Gesamt-
charakter bleibt jedoch jener der byzantinisch beeinflußten
Werke, etwa in der Art der Area des B. Enrico aus Bozen
in Treviso. Daß es am Anfange der zweiten Hälfte des
Trecento trotz der hohen Errungenschaften der De Sanc-
tis in Venedig Künstler oder Künstlerwerkstätten gab, die
— bei einer hohen Qualitätsleistung — noch zum gro-
ßen Teil mit byzantinisierenden Elementen arbeiteten, be-
weist ein Relief aus dem Seminario patriarcale mit
der Darstellung des hl. Andreas und der Jahreszahl
i362 (Fig. 101),3 das der Figur Christi an der Vorderseite
unseres Sarkophags zur Seite gestellt werden kann. Beide
Figuren stimmen in der Haar- und Bartbehandlung über-
ein: dieselben symmetrischen Locken, derselbe ovale Bart,
in dessen kompakte Masse einzelne Windungen hinein-
geschnitten und an den Enden mit dem Bohrer ausgehöhlt
sind; Ähnlichkeiten finden sich auch in der Bearbeitung
Fig. 101. Heil. Andreas (i362). der Augenbrauen, in dem mandelförmigen Schnitt der
Venedig, Seminario patriarcale. Augen, in den dicken Lippen und in dem halboffenen
Mund sowie in der Gewandbehandlung: man beachte die
Zickzackfalten, die sich auf den vom Arme des hl. Andreas und von dem der Christusfigur herab-
hängenden Gewandstücken bilden. Jene gewisse Note, die wir bei der Betrachtung der Figur des
hl. Isidor mit dem Worte Stilismus bezeichnet haben, bildet (vielleicht in einem etwas geschwäch-
1 Venturi a. a. 0. II, p. 250 (hl. Georg); Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata etc. a. a. O. I, p. 370.
versetzt diese zwei Figuren ans Ende des XIV. Jahrhunderts; mit Unrecht, denn um diese Zeit wird man in Venedig kaum
Parallelheispiele dafür finden können.
2 Gabelentz a. a. O., S. 215. ■—■ Ein Relief mit dem hl. Georg über dem Eingange zur Corte San Zorzi (S. Gallo),
Venedig, ein typisches Werk des Trecento, erinnert stark an das hier erwähnte St. Georgs-Relief.
3 Um die Figur folgende Inschrift in gotischen Lettern: ~ST ANDREAS || MCCCLXII VLTIMO • OCTOBRIS • FVIT •
FACTVM [| HOC - OPVS • TPR • DNI • FR1S • FRANCISCI ■ D • GRATIA - PRIORIS. Dieses Relief befand sich ursprünglich
im Gang zum Refektorium des Monastero di S. Salvatore in Venedig: G. Moschini, La chiesa e il seminario di Sta. Maria
della Salute in Venezia, Venedig 1842, p. gl; Guida etc. a. a. C1., p. 46, Nr. 3. Sonst in der kunsthistorischen Literatur nicht
erwähnt.
Leo Planiscig.
cesco Dandolo-Grabmals im Seminario patriarcale, sondern in seiner ursprunglichen, dugentesken
Gestalt. Merkwürdig ist allerdings, daß dieser Einfluß, der schon längst überwunden schien, hier,
an einem gesicherten Werke der zweiten Trecentohälfte, nochmals zutage tritt. Daß aber der By-
zantinismus in Venedig nicht ausgestorben war, beweisen uns die Mosaiken von S. Marco, in
unserem speziellen Falle jene der Kapelle des hl. Isidor, die die erzählenden Szenen des Sarko-
phags wiederholen und die, trotz eines mächtigen toskanischen Einflusses und einer inneren Um-
arbeitung, noch stark im byzantinischen Banne stehen.
In diesem Zusammenhang sind noch zwei Reliefs zu
erwähnen, die zwar nicht sicher datierbar sind, die aber
derselben Kunstsphäre anzugehören scheinen, das eine mit
der Darstellung des hl. Georg (Fig. 99), das andere mit
dem hl. Theodorus (Fig. 100), beide im Baptisterium
von S. Marco.1 Die Ansicht, sie seien Werke des Tre-
cento, wurde bereits von Gabelentz2 geäußert.
Denselben antiquierten Zug wie beim hl. Isidor selbst
kann man auch an den Figuren der Vorderseite seines
Sarkophags beobachten. Wohl offenbaren auch sie die
Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte, ihr Gesamt-
charakter bleibt jedoch jener der byzantinisch beeinflußten
Werke, etwa in der Art der Area des B. Enrico aus Bozen
in Treviso. Daß es am Anfange der zweiten Hälfte des
Trecento trotz der hohen Errungenschaften der De Sanc-
tis in Venedig Künstler oder Künstlerwerkstätten gab, die
— bei einer hohen Qualitätsleistung — noch zum gro-
ßen Teil mit byzantinisierenden Elementen arbeiteten, be-
weist ein Relief aus dem Seminario patriarcale mit
der Darstellung des hl. Andreas und der Jahreszahl
i362 (Fig. 101),3 das der Figur Christi an der Vorderseite
unseres Sarkophags zur Seite gestellt werden kann. Beide
Figuren stimmen in der Haar- und Bartbehandlung über-
ein: dieselben symmetrischen Locken, derselbe ovale Bart,
in dessen kompakte Masse einzelne Windungen hinein-
geschnitten und an den Enden mit dem Bohrer ausgehöhlt
sind; Ähnlichkeiten finden sich auch in der Bearbeitung
Fig. 101. Heil. Andreas (i362). der Augenbrauen, in dem mandelförmigen Schnitt der
Venedig, Seminario patriarcale. Augen, in den dicken Lippen und in dem halboffenen
Mund sowie in der Gewandbehandlung: man beachte die
Zickzackfalten, die sich auf den vom Arme des hl. Andreas und von dem der Christusfigur herab-
hängenden Gewandstücken bilden. Jene gewisse Note, die wir bei der Betrachtung der Figur des
hl. Isidor mit dem Worte Stilismus bezeichnet haben, bildet (vielleicht in einem etwas geschwäch-
1 Venturi a. a. 0. II, p. 250 (hl. Georg); Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata etc. a. a. O. I, p. 370.
versetzt diese zwei Figuren ans Ende des XIV. Jahrhunderts; mit Unrecht, denn um diese Zeit wird man in Venedig kaum
Parallelheispiele dafür finden können.
2 Gabelentz a. a. O., S. 215. ■—■ Ein Relief mit dem hl. Georg über dem Eingange zur Corte San Zorzi (S. Gallo),
Venedig, ein typisches Werk des Trecento, erinnert stark an das hier erwähnte St. Georgs-Relief.
3 Um die Figur folgende Inschrift in gotischen Lettern: ~ST ANDREAS || MCCCLXII VLTIMO • OCTOBRIS • FVIT •
FACTVM [| HOC - OPVS • TPR • DNI • FR1S • FRANCISCI ■ D • GRATIA - PRIORIS. Dieses Relief befand sich ursprünglich
im Gang zum Refektorium des Monastero di S. Salvatore in Venedig: G. Moschini, La chiesa e il seminario di Sta. Maria
della Salute in Venezia, Venedig 1842, p. gl; Guida etc. a. a. C1., p. 46, Nr. 3. Sonst in der kunsthistorischen Literatur nicht
erwähnt.