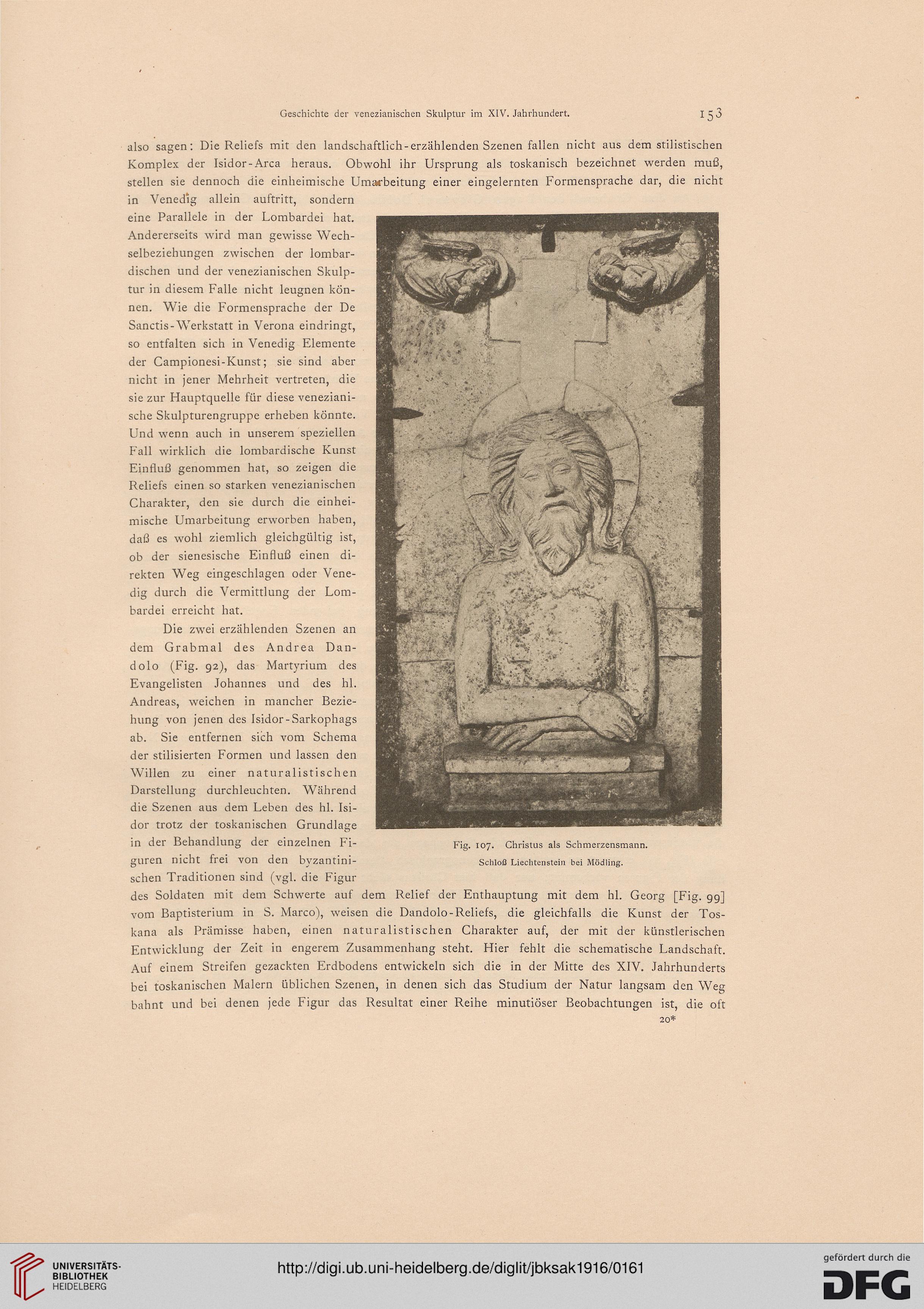Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.
153
also sagen: Die Reliefs mit den landschaftlich-erzählenden Szenen fallen nicht aus dem stilistischen
Komplex der Isidor-Area heraus. Obwohl ihr Ursprung als toskanisch bezeichnet werden muß,
stellen sie dennoch die einheimische Umarbeitung einer eingelernten Formensprache dar, die nicht
in Venedig allein auftritt, sondern
eine Parallele in der Lombardei hat.
Andererseits wird man gewisse Wech-
selbeziehungen zwischen der lombar-
dischen und der venezianischen Skulp-
tur in diesem Falle nicht leugnen kön-
nen. Wie die Formensprache der De
Sanctis-Werkstatt in Verona eindringt,
so entfalten sich in Venedig Elemente
der Campionesi-Kunst; sie sind aber
nicht in jener Mehrheit vertreten, die
sie zur Hauptquelle für diese veneziani-
sche Skulpturengruppe erheben könnte.
Und wenn auch in unserem speziellen
Fall wirklich die lombardische Kunst
Einfluß genommen hat, so zeigen die
Reliefs einen so starken venezianischen
Charakter, den sie durch die einhei-
mische Umarbeitung erworben haben,
daß es wohl ziemlich gleichgültig ist,
ob der sienesische Einfluß einen di-
rekten Weg eingeschlagen oder Vene-
dig durch die Vermittlung der Lom-
bardei erreicht hat.
Die zwei erzählenden Szenen an
dem Grabmal des Andrea Dan-
dolo (Fig. 92), das Martyrium des
Evangelisten Johannes und des hl.
Andreas, weichen in mancher Bezie-
hung von jenen des Isidor-Sarkophags
ab. Sie entfernen sich vom Schema
der stilisierten Formen und lassen den
Willen zu einer naturalistischen
Darstellung durchleuchten. Während
die Szenen aus dem Leben des hl. Isi-
dor trotz der toskanischen Grundlage
in der Behandlung der einzelnen Fi-
guren nicht frei von den byzantini-
schen Traditionen sind (vgl. die Figur
des Soldaten mit dem Schwerte auf dem Relief der Enthauptung mit dem hl. Georg [Fig. 99]
vom Baptisterium in S. Marco), weisen die Dandolo-Reliefs, die gleichfalls die Kunst der Tos-
kana als Prämisse haben, einen naturalistischen Charakter auf, der mit der künstlerischen
Entwicklung der Zeit in engerem Zusammenhang steht. Hier fehlt die schematische Landschaft.
Auf einem Streifen gezackten Erdbodens entwickeln sich die in der Mitte des XIV. Jahrhunderts
bei toskanischen Malern üblichen Szenen, in denen sich das Studium der Natur langsam den Weg
bahnt und bei denen jede Figur das Resultat einer Reihe minutiöser Beobachtungen ist, die oft
20*
Fig. 107. Christus als Schmerzensmann.
Schloß Liechtenstein bei Mödling.
153
also sagen: Die Reliefs mit den landschaftlich-erzählenden Szenen fallen nicht aus dem stilistischen
Komplex der Isidor-Area heraus. Obwohl ihr Ursprung als toskanisch bezeichnet werden muß,
stellen sie dennoch die einheimische Umarbeitung einer eingelernten Formensprache dar, die nicht
in Venedig allein auftritt, sondern
eine Parallele in der Lombardei hat.
Andererseits wird man gewisse Wech-
selbeziehungen zwischen der lombar-
dischen und der venezianischen Skulp-
tur in diesem Falle nicht leugnen kön-
nen. Wie die Formensprache der De
Sanctis-Werkstatt in Verona eindringt,
so entfalten sich in Venedig Elemente
der Campionesi-Kunst; sie sind aber
nicht in jener Mehrheit vertreten, die
sie zur Hauptquelle für diese veneziani-
sche Skulpturengruppe erheben könnte.
Und wenn auch in unserem speziellen
Fall wirklich die lombardische Kunst
Einfluß genommen hat, so zeigen die
Reliefs einen so starken venezianischen
Charakter, den sie durch die einhei-
mische Umarbeitung erworben haben,
daß es wohl ziemlich gleichgültig ist,
ob der sienesische Einfluß einen di-
rekten Weg eingeschlagen oder Vene-
dig durch die Vermittlung der Lom-
bardei erreicht hat.
Die zwei erzählenden Szenen an
dem Grabmal des Andrea Dan-
dolo (Fig. 92), das Martyrium des
Evangelisten Johannes und des hl.
Andreas, weichen in mancher Bezie-
hung von jenen des Isidor-Sarkophags
ab. Sie entfernen sich vom Schema
der stilisierten Formen und lassen den
Willen zu einer naturalistischen
Darstellung durchleuchten. Während
die Szenen aus dem Leben des hl. Isi-
dor trotz der toskanischen Grundlage
in der Behandlung der einzelnen Fi-
guren nicht frei von den byzantini-
schen Traditionen sind (vgl. die Figur
des Soldaten mit dem Schwerte auf dem Relief der Enthauptung mit dem hl. Georg [Fig. 99]
vom Baptisterium in S. Marco), weisen die Dandolo-Reliefs, die gleichfalls die Kunst der Tos-
kana als Prämisse haben, einen naturalistischen Charakter auf, der mit der künstlerischen
Entwicklung der Zeit in engerem Zusammenhang steht. Hier fehlt die schematische Landschaft.
Auf einem Streifen gezackten Erdbodens entwickeln sich die in der Mitte des XIV. Jahrhunderts
bei toskanischen Malern üblichen Szenen, in denen sich das Studium der Natur langsam den Weg
bahnt und bei denen jede Figur das Resultat einer Reihe minutiöser Beobachtungen ist, die oft
20*
Fig. 107. Christus als Schmerzensmann.
Schloß Liechtenstein bei Mödling.