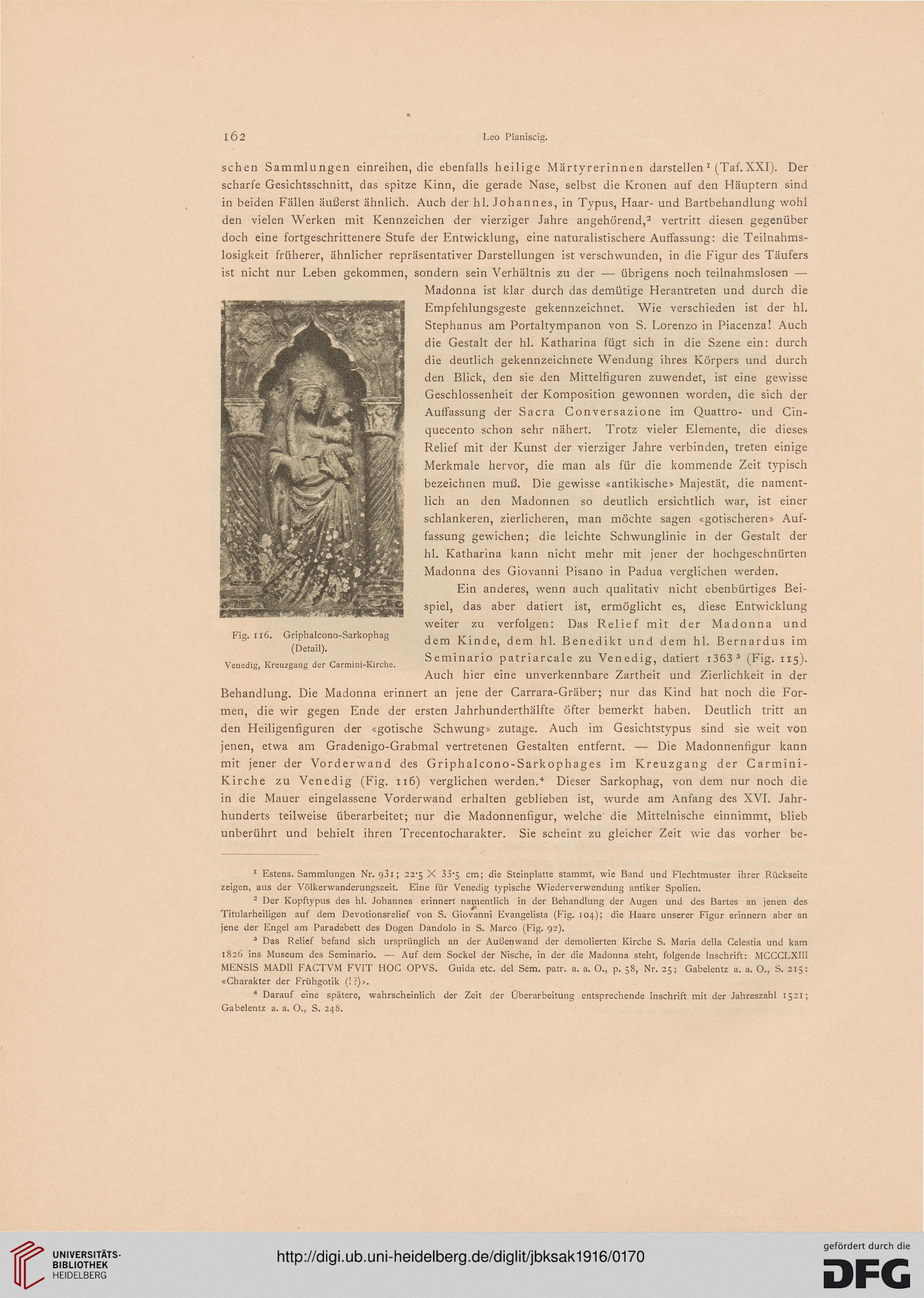IÖ2
Leo Planiscig.
sehen Sammlungen einreihen, die ebenfalls heilige Märtyrerinnen darstellen 1 (Taf.XXI). Der
scharfe Gesichtsschnitt, das spitze Kinn, die gerade Nase, selbst die Kronen auf den Häuptern sind
in beiden Fällen äußerst ähnlich. Auch der hl. Johannes, in Typus, Haar- und Bartbehandlung wohl
den vielen Werken mit Kennzeichen der vierziger Jahre angehörend,2 vertritt diesen gegenüber
doch eine fortgeschrittenere Stufe der Entwicklung, eine naturalistischere Auffassung: die Teilnahms-
losigkeit früherer, ähnlicher repräsentativer Darstellungen ist verschwunden, in die Figur des Täufers
ist nicht nur Leben gekommen, sondern sein Verhältnis zu der — übrigens noch teilnahmslosen —
Madonna ist klar durch das demütige Herantreten und durch die
Empfehlungsgeste gekennzeichnet. Wie verschieden ist der hl.
Stephanus am Portaltympanon von S. Lorenzo in Piacenza! Auch
die Gestalt der hl. Katharina fügt sich in die Szene ein: durch
die deutlich gekennzeichnete Wendung ihres Körpers und durch
den Blick, den sie den Mittelfiguren zuwendet, ist eine gewisse
Geschlossenheit der Komposition gewonnen worden, die sich der
Auffassung der Sacra Conversazione im Quattro- und Cin-
quecento schon sehr nähert. Trotz vieler Elemente, die dieses
Relief mit der Kunst der vierziger Jahre verbinden, treten einige
Merkmale hervor, die man als für die kommende Zeit typisch
bezeichnen muß. Die gewisse «antikische» Majestät, die nament-
lich an den Madonnen so deutlich ersichtlich war, ist einer
schlankeren, zierlicheren, man möchte sagen «gotischeren» Auf-
fassung gewichen; die leichte Schwunglinie in der Gestalt der
hl. Katharina kann nicht mehr mit jener der hochgeschnürten
Madonna des Giovanni Pisano in Padua verglichen werden.
Ein anderes, wenn auch qualitativ nicht ebenbürtiges Bei-
spiel, das aber datiert ist, ermöglicht es, diese Entwicklung
weiter zu verfolgen: Das Relief mit der Madonna und
dem Kinde, dem hl. Benedikt und dem hl. Bernardus im
Seminario patriarcale zu Venedig, datiert i363 3 (Fig. 115).
Auch hier eine unverkennbare Zartheit und Zierlichkeit in der
Behandlung. Die Madonna erinnert an jene der Carrara-Gräber; nur das Kind hat noch die For-
men, die wir gegen Ende der ersten Jahrhunderthälfte öfter bemerkt haben. Deutlich tritt an
den Heiligenfiguren der «gotische Schwung» zutage. Auch im Gesichtstypus sind sie weit von
jenen, etwa am Gradenigo-Grabmal vertretenen Gestalten entfernt. — Die Madonnenfigur kann
mit jener der Vorderwand des Griphalcono-Sarkophages im Kreuzgang der Carmini-
Kirche zu Venedig (Fig. 116) verglichen werden.4 Dieser Sarkophag, von dem nur noch die
in die Mauer eingelassene Vorderwand erhalten geblieben ist, wurde am Anfang des XVI. Jahr-
hunderts teilweise überarbeitet; nur die Madonnenfigur, welche die Mittelnische einnimmt, blieb
Sie scheint zu gleicher Zeit wie das vorher be-
Fig. Il6. Griphalcono-Sarkophag
(Detail).
Venedig, Kreuzgang der Carmiui-Kirche.
unberührt und behielt ihren Trecentocharakter.
1 Estens. Sammlungen Nr. 931; 22-5 X 33-$ cm; die Steinplatte stammt, wie Band und Flechtmuster ihrer Rückseite
zeigen, aus der Völkerwanderungszeit. Eine für Venedig typische Wiederverwendung antiker Spolien.
2 Der Kopftypus des hl. Johannes erinnert namentlich in der Behandlung der Augen und des Bartes an jenen des
Titularhciligen auf dem Devotionsrelief von S. Giovanni Evangelista (Fig. 104); die Haare unserer Figur erinnern aber an
jene der Engel am Paradebett des Dogen Dandolo in S. Marco (Fig. 92).
3 Das Relief befand sich ursprünglich an der Außenwand der demolierten Kirche S. Maria della Celestia und kam
1826 ins Museum des Seminario. — Auf dem Sockel der Nische, in der die Madonna steht, folgende Inschrift: MCCCLXII1
MENSIS MADII FACTVM FVIT HOC OPVS. Guida etc. del Sem. patr. a. a. O., p. 58, Nr. 25; Gabelentz a. a. O., S. 215:
«Charakter der Frühgotik (!?)».
4 Darauf eine spätere, wahrscheinlich der Zeit der Überarbeitung entsprechende Inschrift mit der Jahreszahl 1521;
Gabelentz a. a. O., S. 248.
Leo Planiscig.
sehen Sammlungen einreihen, die ebenfalls heilige Märtyrerinnen darstellen 1 (Taf.XXI). Der
scharfe Gesichtsschnitt, das spitze Kinn, die gerade Nase, selbst die Kronen auf den Häuptern sind
in beiden Fällen äußerst ähnlich. Auch der hl. Johannes, in Typus, Haar- und Bartbehandlung wohl
den vielen Werken mit Kennzeichen der vierziger Jahre angehörend,2 vertritt diesen gegenüber
doch eine fortgeschrittenere Stufe der Entwicklung, eine naturalistischere Auffassung: die Teilnahms-
losigkeit früherer, ähnlicher repräsentativer Darstellungen ist verschwunden, in die Figur des Täufers
ist nicht nur Leben gekommen, sondern sein Verhältnis zu der — übrigens noch teilnahmslosen —
Madonna ist klar durch das demütige Herantreten und durch die
Empfehlungsgeste gekennzeichnet. Wie verschieden ist der hl.
Stephanus am Portaltympanon von S. Lorenzo in Piacenza! Auch
die Gestalt der hl. Katharina fügt sich in die Szene ein: durch
die deutlich gekennzeichnete Wendung ihres Körpers und durch
den Blick, den sie den Mittelfiguren zuwendet, ist eine gewisse
Geschlossenheit der Komposition gewonnen worden, die sich der
Auffassung der Sacra Conversazione im Quattro- und Cin-
quecento schon sehr nähert. Trotz vieler Elemente, die dieses
Relief mit der Kunst der vierziger Jahre verbinden, treten einige
Merkmale hervor, die man als für die kommende Zeit typisch
bezeichnen muß. Die gewisse «antikische» Majestät, die nament-
lich an den Madonnen so deutlich ersichtlich war, ist einer
schlankeren, zierlicheren, man möchte sagen «gotischeren» Auf-
fassung gewichen; die leichte Schwunglinie in der Gestalt der
hl. Katharina kann nicht mehr mit jener der hochgeschnürten
Madonna des Giovanni Pisano in Padua verglichen werden.
Ein anderes, wenn auch qualitativ nicht ebenbürtiges Bei-
spiel, das aber datiert ist, ermöglicht es, diese Entwicklung
weiter zu verfolgen: Das Relief mit der Madonna und
dem Kinde, dem hl. Benedikt und dem hl. Bernardus im
Seminario patriarcale zu Venedig, datiert i363 3 (Fig. 115).
Auch hier eine unverkennbare Zartheit und Zierlichkeit in der
Behandlung. Die Madonna erinnert an jene der Carrara-Gräber; nur das Kind hat noch die For-
men, die wir gegen Ende der ersten Jahrhunderthälfte öfter bemerkt haben. Deutlich tritt an
den Heiligenfiguren der «gotische Schwung» zutage. Auch im Gesichtstypus sind sie weit von
jenen, etwa am Gradenigo-Grabmal vertretenen Gestalten entfernt. — Die Madonnenfigur kann
mit jener der Vorderwand des Griphalcono-Sarkophages im Kreuzgang der Carmini-
Kirche zu Venedig (Fig. 116) verglichen werden.4 Dieser Sarkophag, von dem nur noch die
in die Mauer eingelassene Vorderwand erhalten geblieben ist, wurde am Anfang des XVI. Jahr-
hunderts teilweise überarbeitet; nur die Madonnenfigur, welche die Mittelnische einnimmt, blieb
Sie scheint zu gleicher Zeit wie das vorher be-
Fig. Il6. Griphalcono-Sarkophag
(Detail).
Venedig, Kreuzgang der Carmiui-Kirche.
unberührt und behielt ihren Trecentocharakter.
1 Estens. Sammlungen Nr. 931; 22-5 X 33-$ cm; die Steinplatte stammt, wie Band und Flechtmuster ihrer Rückseite
zeigen, aus der Völkerwanderungszeit. Eine für Venedig typische Wiederverwendung antiker Spolien.
2 Der Kopftypus des hl. Johannes erinnert namentlich in der Behandlung der Augen und des Bartes an jenen des
Titularhciligen auf dem Devotionsrelief von S. Giovanni Evangelista (Fig. 104); die Haare unserer Figur erinnern aber an
jene der Engel am Paradebett des Dogen Dandolo in S. Marco (Fig. 92).
3 Das Relief befand sich ursprünglich an der Außenwand der demolierten Kirche S. Maria della Celestia und kam
1826 ins Museum des Seminario. — Auf dem Sockel der Nische, in der die Madonna steht, folgende Inschrift: MCCCLXII1
MENSIS MADII FACTVM FVIT HOC OPVS. Guida etc. del Sem. patr. a. a. O., p. 58, Nr. 25; Gabelentz a. a. O., S. 215:
«Charakter der Frühgotik (!?)».
4 Darauf eine spätere, wahrscheinlich der Zeit der Überarbeitung entsprechende Inschrift mit der Jahreszahl 1521;
Gabelentz a. a. O., S. 248.