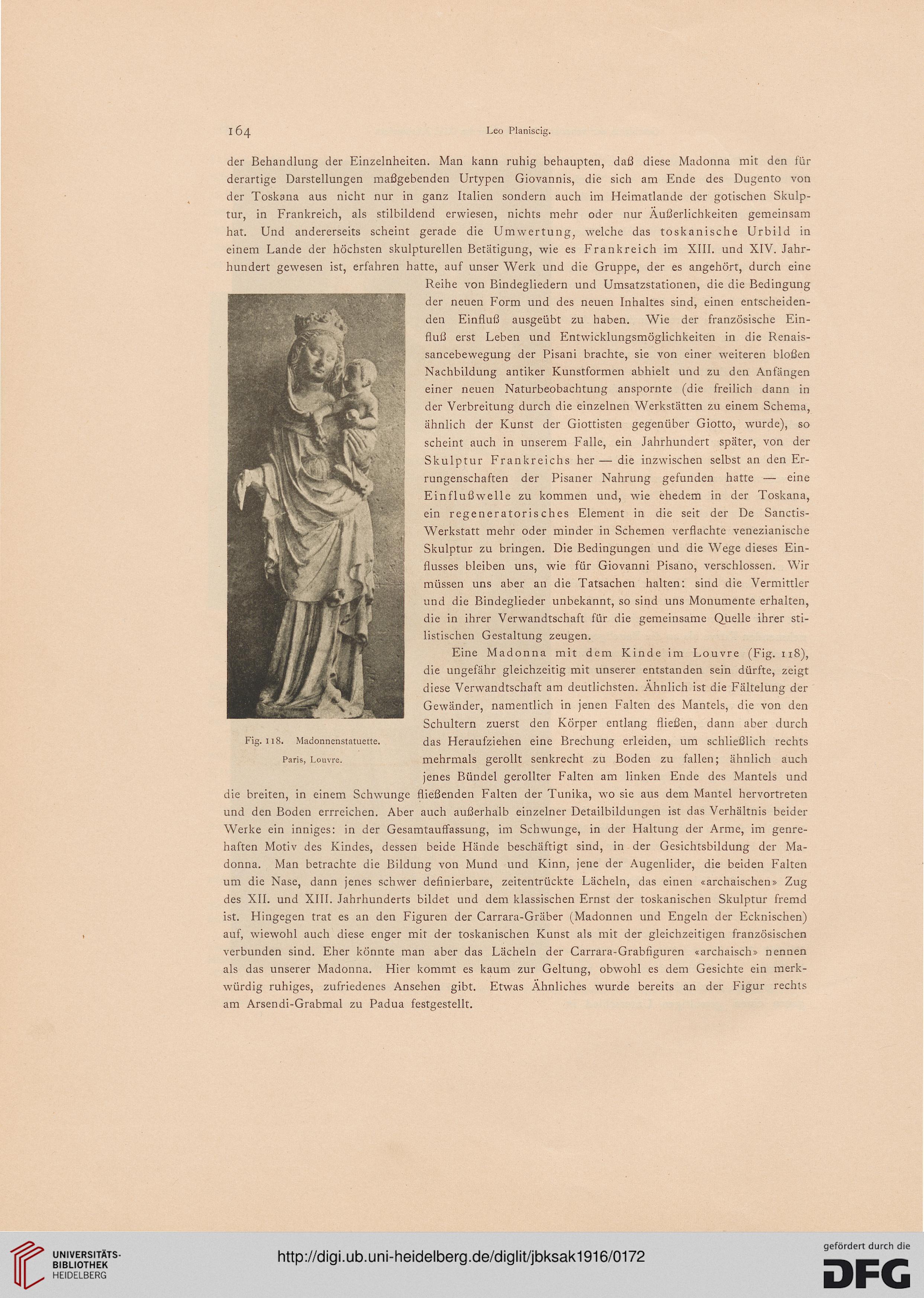164
Leo Planiscig.
der Behandlung der Einzelnheiten. Man kann ruhig behaupten, daß diese Madonna mit den für
derartige Darstellungen maßgebenden Urtypen Giovannis, die sich am Ende des Dugento von
der Toskana aus nicht nur in ganz Italien sondern auch im Heimatlande der gotischen Skulp-
tur, in Frankreich, als stilbildend erwiesen, nichts mehr oder nur Äußerlichkeiten gemeinsam
hat. Und andererseits scheint gerade die Umwertung, welche das toskanische Urbild in
einem Lande der höchsten skulpturellen Betätigung, wie es Frankreich im XIII. und XIV. Jahr-
hundert gewesen ist, erfahren hatte, auf unser Werk und die Gruppe, der es angehört, durch eine
Reihe von Bindegliedern und Umsatzstationen, die die Bedingung
der neuen Form und des neuen Inhaltes sind, einen entscheiden-
den Einfluß ausgeübt zu haben. Wie der französische Ein-
fluß erst Leben und Entwicklungsmöglichkeiten in die Renais-
sancebewegung der Pisani brachte, sie von einer weiteren bloßen
Nachbildung antiker Kunstformen abhielt und zu den Anfängen
einer neuen Naturbeobachtung anspornte (die freilich dann in
der Verbreitung durch die einzelnen Werkstätten zu einem Schema,
ähnlich der Kunst der Giottisten gegenüber Giotto, wurde), so
scheint auch in unserem Falle, ein Jahrhundert später, von der
Skulptur Frankreichs her — die inzwischen selbst an den Er-
rungenschaften der Pisaner Nahrung gefunden hatte — eine
Einflußwelle zu kommen und, wie ehedem in der Toskana,
ein regeneratorisches Element in die seit der De Sanctis-
Werkstatt mehr oder minder in Schemen verflachte venezianische
Skulptur zu bringen. Die Bedingungen und die Wege dieses Ein-
flusses bleiben uns, wie für Giovanni Pisano, verschlossen. Wir
müssen uns aber an die Tatsachen halten: sind die Vermittler
und die Bindeglieder unbekannt, so sind uns Monumente erhalten,
die in ihrer Verwandtschaft für die gemeinsame Quelle ihrer sti-
listischen Gestaltung zeugen.
Eine Madonna mit dem Kinde im Louvre (Fig. 118),
die ungefähr gleichzeitig mit unserer entstanden sein dürfte, zeigt
diese Verwandtschaft am deutlichsten. Ahnlich ist die Fältelung der
Gewänder, namentlich in jenen Falten des Mantels, die von den
Schultern zuerst den Körper entlang fließen, dann aber durch
das Heraufziehen eine Brechung erleiden, um schließlich rechts
mehrmals gerollt senkrecht zu Boden zu fallen; ähnlich auch
jenes Bündel gerollter Falten am linken Ende des Mantels und
die breiten, in einem Schwünge fließenden Falten der Tunika, wo sie aus dem Mantel hervortreten
und den Boden errreichen. Aber auch außerhalb einzelner Detailbildungen ist das Verhältnis beider
Werke ein inniges: in der Gesamtauffassung, im Schwünge, in der Haltung der Arme, im genre-
haften Motiv des Kindes, dessen beide Hände beschäftigt sind, in der Gesichtsbildung der Ma-
donna. Man betrachte die Bildung von Mund und Kinn, jene der Augenlider, die beiden Falten
um die Nase, dann jenes schwer definierbare, zeitentrückte Lächeln, das einen «archaischen» Zug
des XII. und XIII. Jahrhunderts bildet und dem klassischen Ernst der toskanischen Skulptur fremd
ist. Hingegen trat es an den Figuren der Carrara-Gräber (Madonnen und Engeln der Ecknischen)
auf, wiewohl auch diese enger mit der toskanischen Kunst als mit der gleichzeitigen französischen
verbunden sind. Eher könnte man aber das Lächeln der Carrara-Grabfiguren «archaisch» nennen
als das unserer Madonna. Hier kommt es kaum zur Geltung, obwohl es dem Gesichte ein merk-
würdig ruhiges, zufriedenes Ansehen gibt. Etwas Ahnliches wurde bereits an der Figur rechts
am Arsendi-Grabmal zu Padua festgestellt.
Fig. Ii8. Madonnenstatuette.
Paris, Louvre.
Leo Planiscig.
der Behandlung der Einzelnheiten. Man kann ruhig behaupten, daß diese Madonna mit den für
derartige Darstellungen maßgebenden Urtypen Giovannis, die sich am Ende des Dugento von
der Toskana aus nicht nur in ganz Italien sondern auch im Heimatlande der gotischen Skulp-
tur, in Frankreich, als stilbildend erwiesen, nichts mehr oder nur Äußerlichkeiten gemeinsam
hat. Und andererseits scheint gerade die Umwertung, welche das toskanische Urbild in
einem Lande der höchsten skulpturellen Betätigung, wie es Frankreich im XIII. und XIV. Jahr-
hundert gewesen ist, erfahren hatte, auf unser Werk und die Gruppe, der es angehört, durch eine
Reihe von Bindegliedern und Umsatzstationen, die die Bedingung
der neuen Form und des neuen Inhaltes sind, einen entscheiden-
den Einfluß ausgeübt zu haben. Wie der französische Ein-
fluß erst Leben und Entwicklungsmöglichkeiten in die Renais-
sancebewegung der Pisani brachte, sie von einer weiteren bloßen
Nachbildung antiker Kunstformen abhielt und zu den Anfängen
einer neuen Naturbeobachtung anspornte (die freilich dann in
der Verbreitung durch die einzelnen Werkstätten zu einem Schema,
ähnlich der Kunst der Giottisten gegenüber Giotto, wurde), so
scheint auch in unserem Falle, ein Jahrhundert später, von der
Skulptur Frankreichs her — die inzwischen selbst an den Er-
rungenschaften der Pisaner Nahrung gefunden hatte — eine
Einflußwelle zu kommen und, wie ehedem in der Toskana,
ein regeneratorisches Element in die seit der De Sanctis-
Werkstatt mehr oder minder in Schemen verflachte venezianische
Skulptur zu bringen. Die Bedingungen und die Wege dieses Ein-
flusses bleiben uns, wie für Giovanni Pisano, verschlossen. Wir
müssen uns aber an die Tatsachen halten: sind die Vermittler
und die Bindeglieder unbekannt, so sind uns Monumente erhalten,
die in ihrer Verwandtschaft für die gemeinsame Quelle ihrer sti-
listischen Gestaltung zeugen.
Eine Madonna mit dem Kinde im Louvre (Fig. 118),
die ungefähr gleichzeitig mit unserer entstanden sein dürfte, zeigt
diese Verwandtschaft am deutlichsten. Ahnlich ist die Fältelung der
Gewänder, namentlich in jenen Falten des Mantels, die von den
Schultern zuerst den Körper entlang fließen, dann aber durch
das Heraufziehen eine Brechung erleiden, um schließlich rechts
mehrmals gerollt senkrecht zu Boden zu fallen; ähnlich auch
jenes Bündel gerollter Falten am linken Ende des Mantels und
die breiten, in einem Schwünge fließenden Falten der Tunika, wo sie aus dem Mantel hervortreten
und den Boden errreichen. Aber auch außerhalb einzelner Detailbildungen ist das Verhältnis beider
Werke ein inniges: in der Gesamtauffassung, im Schwünge, in der Haltung der Arme, im genre-
haften Motiv des Kindes, dessen beide Hände beschäftigt sind, in der Gesichtsbildung der Ma-
donna. Man betrachte die Bildung von Mund und Kinn, jene der Augenlider, die beiden Falten
um die Nase, dann jenes schwer definierbare, zeitentrückte Lächeln, das einen «archaischen» Zug
des XII. und XIII. Jahrhunderts bildet und dem klassischen Ernst der toskanischen Skulptur fremd
ist. Hingegen trat es an den Figuren der Carrara-Gräber (Madonnen und Engeln der Ecknischen)
auf, wiewohl auch diese enger mit der toskanischen Kunst als mit der gleichzeitigen französischen
verbunden sind. Eher könnte man aber das Lächeln der Carrara-Grabfiguren «archaisch» nennen
als das unserer Madonna. Hier kommt es kaum zur Geltung, obwohl es dem Gesichte ein merk-
würdig ruhiges, zufriedenes Ansehen gibt. Etwas Ahnliches wurde bereits an der Figur rechts
am Arsendi-Grabmal zu Padua festgestellt.
Fig. Ii8. Madonnenstatuette.
Paris, Louvre.