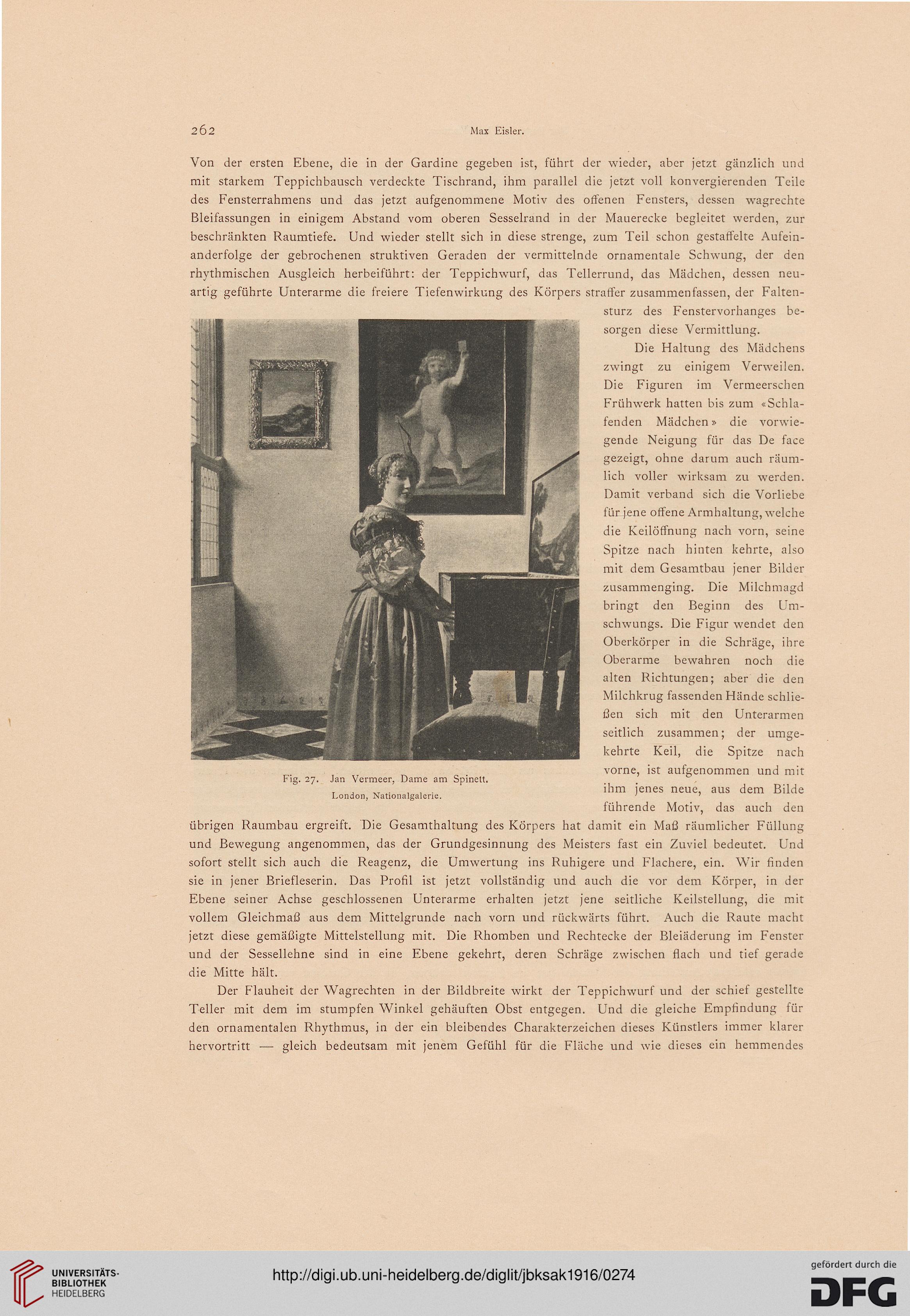2Ö2
Max Eisler.
Von der ersten Ebene, die in der Gardine gegeben ist, führt der wieder, aber jetzt gänzlich und
mit starkem Teppichbausch verdeckte Tischrand, ihm parallel die jetzt voll konvergierenden Teile
des Fensterrahmens und das jetzt aufgenommene Motiv des offenen Fensters, dessen wagrechte
Bleifassungen in einigem Abstand vom oberen Sesselrand in der Mauerecke begleitet werden, zur
beschränkten Raumtiefe. Und wieder stellt sich in diese strenge, zum Teil schon gestaffelte Aufein-
anderfolge der gebrochenen struktiven Geraden der vermittelnde ornamentale Schwung, der den
rhythmischen Ausgleich herbeifuhrt: der Teppichwurf, das Tellerrund, das Mädchen, dessen neu-
artig geführte Unterarme die freiere Tiefenwirkung des Körpers straffer zusammenfassen, der Falten-
sturz des Fenstervorhanges be-
sorgen diese Vermittlung.
Die Haltung des Mädchens
zwingt zu einigem Verweilen.
Die Figuren im Vermeerschen
Frühwerk hatten bis zum «Schla-
fenden Mädchen» die vorwie-
gende Neigung für das De face
gezeigt, ohne darum auch räum-
lich voller wirksam zu werden.
Damit verband sich die Vorliebe
für jene offene Armhaltung, welche
die Keilöffnung nach vorn, seine
Spitze nach hinten kehrte, also
mit dem Gesamtbau jener Bilder
zusammenging. Die Milchmagd
bringt den Beginn des Um-
schwungs. Die Figur wendet den
Oberkörper in die Schräge, ihre
Oberarme bewahren noch die
alten Richtungen; aber die den
Milchkrug fassenden Hände schlie-
ßen sich mit den Unterarmen
seitlich zusammen; der umge-
kehrte Keil, die Spitze nach
vorne, ist aufgenommen und mit
ihm jenes neue, aus dem Bilde
führende Motiv, das auch den
übrigen Raumbau ergreift. Die Gesamthaltung des Körpers hat damit ein Maß räumlicher Füllung
und Bewegung angenommen, das der Grundgesinnung des Meisters fast ein Zuviel bedeutet. Und
sofort stellt sich auch die Reagenz, die Umwertung ins Ruhigere und Flachere, ein. Wir finden
sie in jener Briefleserin. Das Profil ist jetzt vollständig und auch die vor dem Körper, in der
Ebene seiner Achse geschlossenen Unterarme erhalten jetzt jene seitliche Keilstellung, die mit
vollem Gleichmaß aus dem Mittelgrunde nach vorn und rückwärts führt. Auch die Raute macht
jetzt diese gemäßigte Mittelstellung mit. Die Rhomben und Rechtecke der Bleiäderung im Fenster
und der Sessellehne sind in eine Ebene gekehrt, deren Schräge zwischen flach und tief gerade
die Mitte hält.
Der Flauheit der Wagrechten in der Bildbreite wirkt der Teppichwurf und der schief gestellte
Teller mit dem im stumpfen Winkel gehäuften Obst entgegen. Und die gleiche Empfindung für
den ornamentalen Rhythmus, in der ein bleibendes Charakterzeichen dieses Künstlers immer klarer
hervortritt — gleich bedeutsam mit jenem Gefühl für die Fläche und wie dieses ein hemmendes
Fig. 27.
Jan Vermeer, Dame am Spinett.
London, Nationalgalcrie.
Max Eisler.
Von der ersten Ebene, die in der Gardine gegeben ist, führt der wieder, aber jetzt gänzlich und
mit starkem Teppichbausch verdeckte Tischrand, ihm parallel die jetzt voll konvergierenden Teile
des Fensterrahmens und das jetzt aufgenommene Motiv des offenen Fensters, dessen wagrechte
Bleifassungen in einigem Abstand vom oberen Sesselrand in der Mauerecke begleitet werden, zur
beschränkten Raumtiefe. Und wieder stellt sich in diese strenge, zum Teil schon gestaffelte Aufein-
anderfolge der gebrochenen struktiven Geraden der vermittelnde ornamentale Schwung, der den
rhythmischen Ausgleich herbeifuhrt: der Teppichwurf, das Tellerrund, das Mädchen, dessen neu-
artig geführte Unterarme die freiere Tiefenwirkung des Körpers straffer zusammenfassen, der Falten-
sturz des Fenstervorhanges be-
sorgen diese Vermittlung.
Die Haltung des Mädchens
zwingt zu einigem Verweilen.
Die Figuren im Vermeerschen
Frühwerk hatten bis zum «Schla-
fenden Mädchen» die vorwie-
gende Neigung für das De face
gezeigt, ohne darum auch räum-
lich voller wirksam zu werden.
Damit verband sich die Vorliebe
für jene offene Armhaltung, welche
die Keilöffnung nach vorn, seine
Spitze nach hinten kehrte, also
mit dem Gesamtbau jener Bilder
zusammenging. Die Milchmagd
bringt den Beginn des Um-
schwungs. Die Figur wendet den
Oberkörper in die Schräge, ihre
Oberarme bewahren noch die
alten Richtungen; aber die den
Milchkrug fassenden Hände schlie-
ßen sich mit den Unterarmen
seitlich zusammen; der umge-
kehrte Keil, die Spitze nach
vorne, ist aufgenommen und mit
ihm jenes neue, aus dem Bilde
führende Motiv, das auch den
übrigen Raumbau ergreift. Die Gesamthaltung des Körpers hat damit ein Maß räumlicher Füllung
und Bewegung angenommen, das der Grundgesinnung des Meisters fast ein Zuviel bedeutet. Und
sofort stellt sich auch die Reagenz, die Umwertung ins Ruhigere und Flachere, ein. Wir finden
sie in jener Briefleserin. Das Profil ist jetzt vollständig und auch die vor dem Körper, in der
Ebene seiner Achse geschlossenen Unterarme erhalten jetzt jene seitliche Keilstellung, die mit
vollem Gleichmaß aus dem Mittelgrunde nach vorn und rückwärts führt. Auch die Raute macht
jetzt diese gemäßigte Mittelstellung mit. Die Rhomben und Rechtecke der Bleiäderung im Fenster
und der Sessellehne sind in eine Ebene gekehrt, deren Schräge zwischen flach und tief gerade
die Mitte hält.
Der Flauheit der Wagrechten in der Bildbreite wirkt der Teppichwurf und der schief gestellte
Teller mit dem im stumpfen Winkel gehäuften Obst entgegen. Und die gleiche Empfindung für
den ornamentalen Rhythmus, in der ein bleibendes Charakterzeichen dieses Künstlers immer klarer
hervortritt — gleich bedeutsam mit jenem Gefühl für die Fläche und wie dieses ein hemmendes
Fig. 27.
Jan Vermeer, Dame am Spinett.
London, Nationalgalcrie.