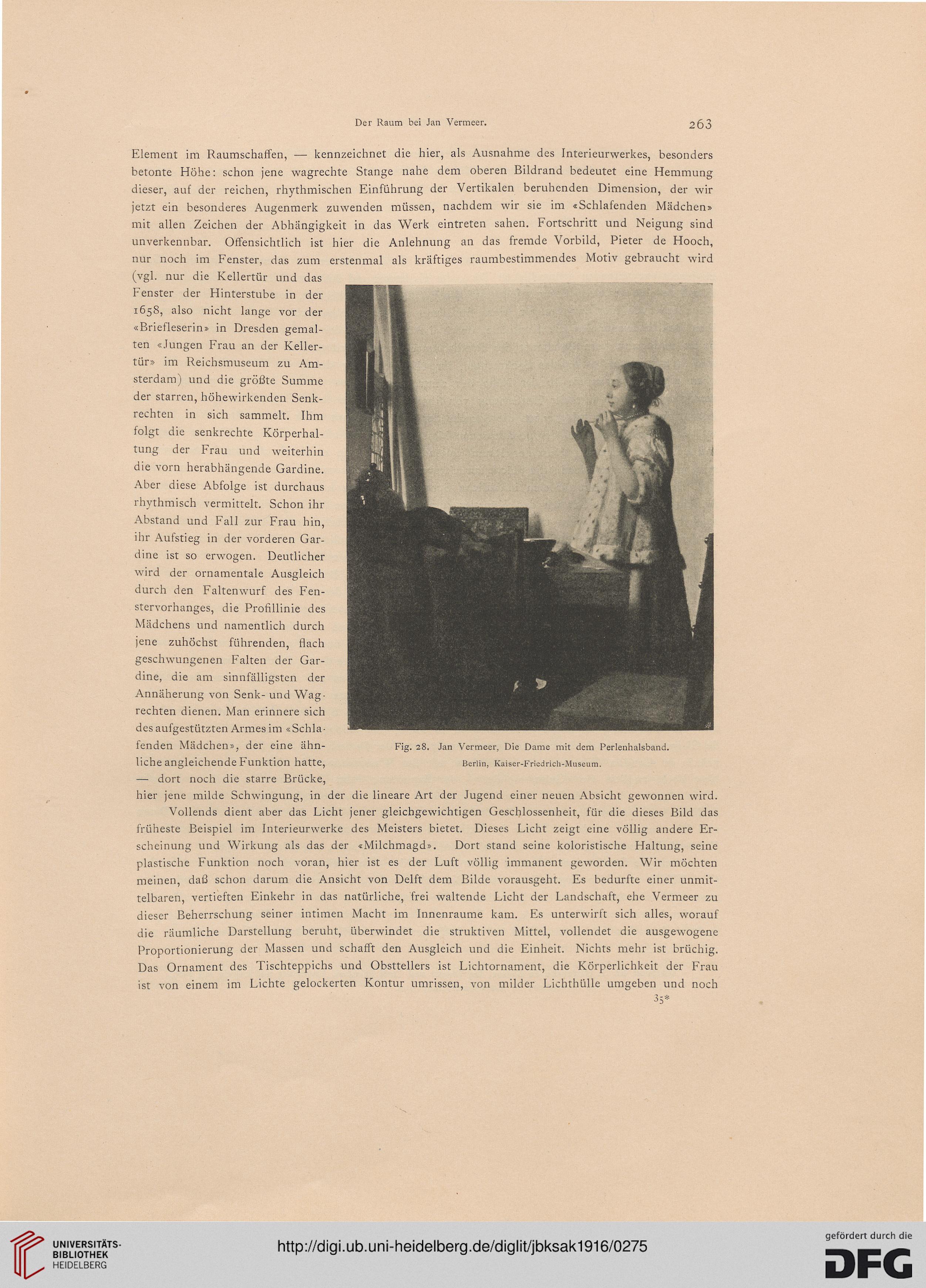Der Raum bei Jan Vermcer.
263
Element im Raumschaffen, — kennzeichnet die hier, als Ausnahme des Interieurwerkes, besonders
betonte Höhe: schon jene wagrechte Stange nahe dem oberen Bildrand bedeutet eine Hemmung
dieser, auf der reichen, rhythmischen Einfuhrung der Vertikalen beruhenden Dimension, der wir
jetzt ein besonderes Augenmerk zuwenden müssen, nachdem wir sie im «Schlafenden Mädchen»
mit allen Zeichen der Abhängigkeit in das Werk eintreten sahen. Fortschritt und Neigung sind
unverkennbar. Offensichtlich ist hier die Anlehnung an das fremde Vorbild, Pieter de Hooch,
nur noch im Fenster, das zum erstenmal als kräftiges raumbestimmendes Motiv gebraucht wird
(vgl. nur die Kellertür und das
Fenster der Hinterstube in der
1658, also nicht lange vor der
«Briefleserin» in Dresden gemal-
ten «Jungen Frau an der Keller-
tür» im Reichsmuseum zu Am-
sterdam) und die größte Summe
der starren, höhewirkenden Senk-
rechten in sich sammelt. Ihm
folgt die senkrechte Körperhal-
tung der Frau und weiterhin
die vorn herabhängende Gardine.
Aber diese Abfolge ist durchaus
rhythmisch vermittelt. Schon ihr
Abstand und Fall zur Frau hin,
ihr Aufstieg in der vorderen Gar-
dine ist so erwogen. Deutlicher
wird der ornamentale Ausgleich
durch den Faltenwurf des Fen-
stervorhanges, die Profillinie des
Mädchens und namentlich durch
jene zuhochst führenden, flach
geschwungenen Falten der Gar-
dine, die am sinnfälligsten der
Annäherung von Senk- und Wag-
rechten dienen. Man erinnere sich
des aufgestützten Armes im «Schla-
fenden Mädchen», der eine ähn-
liche angleichende Funktion hatte,
— dort noch die starre Brücke,
hier jene milde Schwingung, in der die lineare Art der Jugend einer neuen Absicht gewonnen wird.
Vollends dient aber das Licht jener gleichgewichtigen Geschlossenheit, für die dieses Bild das
früheste Beispiel im Interieurwerke des Meisters bietet. Dieses Licht zeigt eine völlig andere Er-
scheinung und Wirkung als das der «Milchmagd». Dort stand seine koloristische Haltung, seine
plastische Funktion noch voran, hier ist es der Luft völlig immanent geworden. Wir möchten
meinen, daß schon darum die Ansicht von Delft dem Bilde vorausgeht. Es bedurfte einer unmit-
telbaren, vertieften Einkehr in das natürliche, frei waltende Licht der Landschaft, ehe Vermeer zu
dieser Beherrschung seiner intimen Macht im Innenraume kam. Es unterwirft sich alles, worauf
die räumliche Darstellung beruht, überwindet die struktiven Mittel, vollendet die ausgewogene
Proportionierung der Massen und schafft den Ausgleich und die Einheit. Nichts mehr ist brüchig.
Das Ornament des Tischteppichs und Obsttellers ist Lichtornament, die Körperlichkeit der Frau
ist von einem im Lichte gelockerten Kontur umrissen, von milder Lichthülle umgeben und noch
Fig. 28. Jan Vermeer. Die Dame mit dem Perlenhalsband.
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.
263
Element im Raumschaffen, — kennzeichnet die hier, als Ausnahme des Interieurwerkes, besonders
betonte Höhe: schon jene wagrechte Stange nahe dem oberen Bildrand bedeutet eine Hemmung
dieser, auf der reichen, rhythmischen Einfuhrung der Vertikalen beruhenden Dimension, der wir
jetzt ein besonderes Augenmerk zuwenden müssen, nachdem wir sie im «Schlafenden Mädchen»
mit allen Zeichen der Abhängigkeit in das Werk eintreten sahen. Fortschritt und Neigung sind
unverkennbar. Offensichtlich ist hier die Anlehnung an das fremde Vorbild, Pieter de Hooch,
nur noch im Fenster, das zum erstenmal als kräftiges raumbestimmendes Motiv gebraucht wird
(vgl. nur die Kellertür und das
Fenster der Hinterstube in der
1658, also nicht lange vor der
«Briefleserin» in Dresden gemal-
ten «Jungen Frau an der Keller-
tür» im Reichsmuseum zu Am-
sterdam) und die größte Summe
der starren, höhewirkenden Senk-
rechten in sich sammelt. Ihm
folgt die senkrechte Körperhal-
tung der Frau und weiterhin
die vorn herabhängende Gardine.
Aber diese Abfolge ist durchaus
rhythmisch vermittelt. Schon ihr
Abstand und Fall zur Frau hin,
ihr Aufstieg in der vorderen Gar-
dine ist so erwogen. Deutlicher
wird der ornamentale Ausgleich
durch den Faltenwurf des Fen-
stervorhanges, die Profillinie des
Mädchens und namentlich durch
jene zuhochst führenden, flach
geschwungenen Falten der Gar-
dine, die am sinnfälligsten der
Annäherung von Senk- und Wag-
rechten dienen. Man erinnere sich
des aufgestützten Armes im «Schla-
fenden Mädchen», der eine ähn-
liche angleichende Funktion hatte,
— dort noch die starre Brücke,
hier jene milde Schwingung, in der die lineare Art der Jugend einer neuen Absicht gewonnen wird.
Vollends dient aber das Licht jener gleichgewichtigen Geschlossenheit, für die dieses Bild das
früheste Beispiel im Interieurwerke des Meisters bietet. Dieses Licht zeigt eine völlig andere Er-
scheinung und Wirkung als das der «Milchmagd». Dort stand seine koloristische Haltung, seine
plastische Funktion noch voran, hier ist es der Luft völlig immanent geworden. Wir möchten
meinen, daß schon darum die Ansicht von Delft dem Bilde vorausgeht. Es bedurfte einer unmit-
telbaren, vertieften Einkehr in das natürliche, frei waltende Licht der Landschaft, ehe Vermeer zu
dieser Beherrschung seiner intimen Macht im Innenraume kam. Es unterwirft sich alles, worauf
die räumliche Darstellung beruht, überwindet die struktiven Mittel, vollendet die ausgewogene
Proportionierung der Massen und schafft den Ausgleich und die Einheit. Nichts mehr ist brüchig.
Das Ornament des Tischteppichs und Obsttellers ist Lichtornament, die Körperlichkeit der Frau
ist von einem im Lichte gelockerten Kontur umrissen, von milder Lichthülle umgeben und noch
Fig. 28. Jan Vermeer. Die Dame mit dem Perlenhalsband.
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.