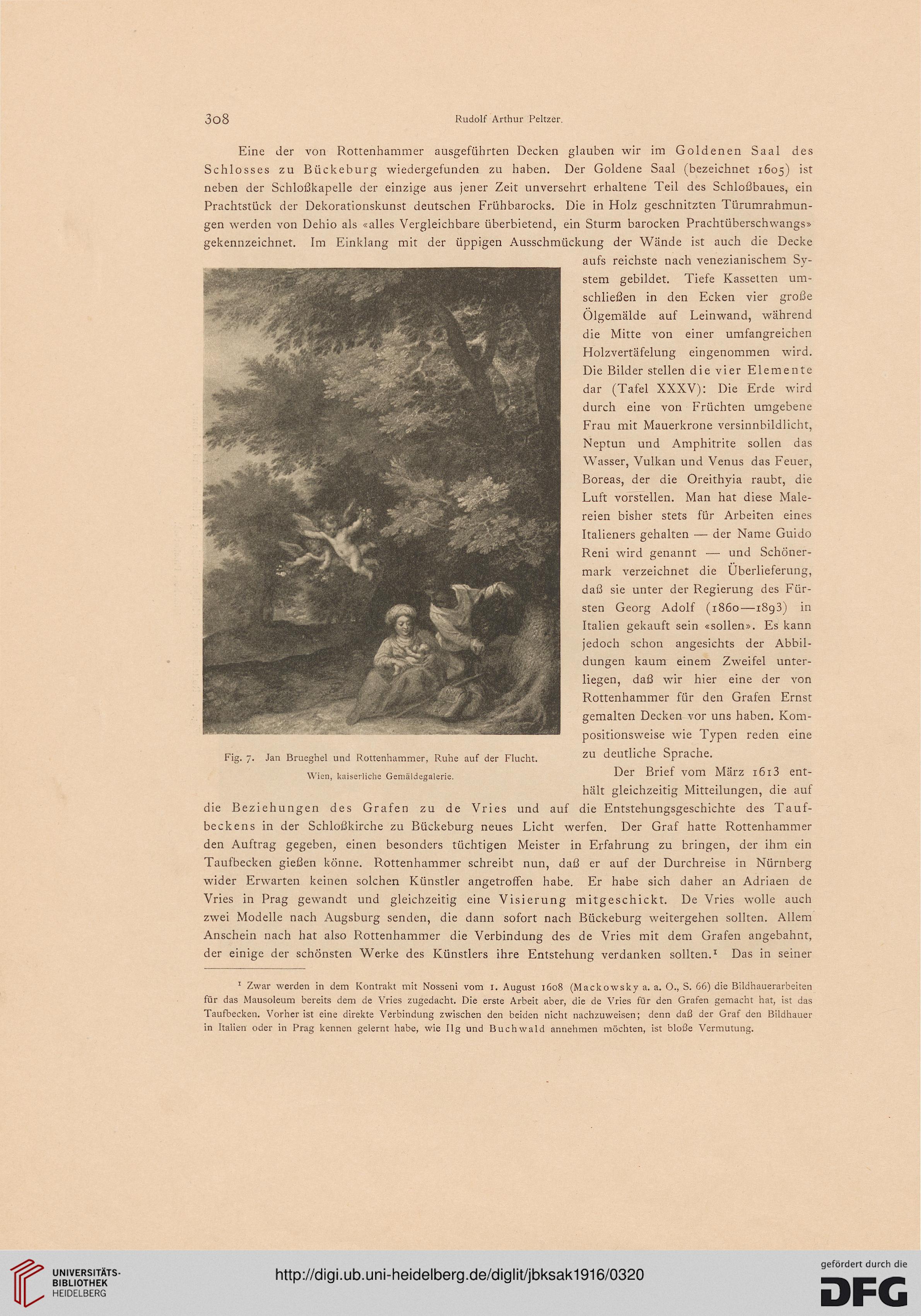3o8
Rudolf Arthur Peltzer.
Eine der von Rottenhammer ausgeführten Decken glauben wir im Goldenen Saal des
Schlosses zu Bückeburg wiedergefunden zu haben. Der Goldene Saal (bezeichnet 1605) ist
neben der Schloßkapelle der einzige aus jener Zeit unversehrt erhaltene Teil des Schloßbaues, ein
Prachtstück der Dekorationskunst deutschen Frühbarocks. Die in Holz geschnitzten Türumrahmun-
gen werden von Dehio als «alles Vergleichbare überbietend, ein Sturm barocken Prachtüberschwangs»
gekennzeichnet. Im Einklang mit der üppigen Ausschmückung der Wände ist auch die Decke
aufs reichste nach venezianischem Sy-
stem gebildet. Tiefe Kasselten um-
schließen in den Ecken vier große
Ölgemälde auf Leinwand, während
die Mitte von einer umfangreichen
Holzvertäfelung eingenommen wird.
Die Bilder stellen die vier Elemente
dar (Tafel XXXV): Die Erde wird
durch eine von Früchten umgebene
Frau mit Mauerkrone versinnbildlicht,
Neptun und Amphitrite sollen das
Wasser, Vulkan und Venus das Feuer,
Boreas, der die Oreithyia raubt, die
Luft vorstellen. Man hat diese Male-
reien bisher stets für Arbeiten eines
Italieners gehalten — der Name Guido
Reni wird genannt — und Schöner-
mark verzeichnet die Uberlieferung,
daß sie unter der Regierung des Für-
sten Georg Adolf (1860—i8g3) in
Italien gekauft sein «sollen». Es kann
jedoch schon angesichts der Abbil-
dungen kaum einem Zweifel unter-
liegen, daß wir hier eine der von
Rottenhammer für den Grafen Ernst
gemalten Decken vor uns haben. Kom-
positionsweise wie Typen reden eine
zu deutliche Sprache.
Der Brief vom März 1613 ent-
hält gleichzeitig Mitteilungen, die auf
die Beziehungen des Grafen zu de Vries und auf die Entstehungsgeschichte des Tauf-
beckens in der Schloßkirche zu Bückeburg neues Licht werfen. Der Graf hatte Rottenhammer
den Auftrag gegeben, einen besonders tüchtigen Meister in Erfahrung zu bringen, der ihm ein
Taufbecken gießen könne. Rottenhammer schreibt nun, daß er auf der Durchreise in Nürnberg
wider Erwarten keinen solchen Künstler angetroffen habe. Er habe sich daher an Adriaen de
Vries in Prag gewandt und gleichzeitig eine Visierung mitgeschickt. De Vries wolle auch
zwei Modelle nach Augsburg senden, die dann sofort nach Bückeburg weitergehen sollten. Allem
Anschein nach hat also Rottenhammer die Verbindung des de Vries mit dem Grafen angebahnt,
der einige der schönsten Werke des Künstlers ihre Entstehung verdanken sollten.1 Das in seiner
Jan Brueghel und Rottenhammer, Ruhe auf der Flucht.
Wien, kaiserliche Gemäldegalerie.
1 Zwar werden in dem Kontrakt mit Nosseni vom 1. August 1608 (Mackowsky a. a. O., S. 66) die Bildhauerarbeiten
für das Mausoleum bereits dem de Vries zugedacht. Die erste Arbeit aber, die de Vries für den Grafen gemacht hat, ist das
Taufbecken. Vorher ist eine direkte Verbindung zwischen den beiden nicht nachzuweisen; denn daß der Graf den Bildhauer
in Italien oder in Prag kennen gelernt habe, wie Ilg und Buchwald annehmen möchten, ist bloße Vermutung.
Rudolf Arthur Peltzer.
Eine der von Rottenhammer ausgeführten Decken glauben wir im Goldenen Saal des
Schlosses zu Bückeburg wiedergefunden zu haben. Der Goldene Saal (bezeichnet 1605) ist
neben der Schloßkapelle der einzige aus jener Zeit unversehrt erhaltene Teil des Schloßbaues, ein
Prachtstück der Dekorationskunst deutschen Frühbarocks. Die in Holz geschnitzten Türumrahmun-
gen werden von Dehio als «alles Vergleichbare überbietend, ein Sturm barocken Prachtüberschwangs»
gekennzeichnet. Im Einklang mit der üppigen Ausschmückung der Wände ist auch die Decke
aufs reichste nach venezianischem Sy-
stem gebildet. Tiefe Kasselten um-
schließen in den Ecken vier große
Ölgemälde auf Leinwand, während
die Mitte von einer umfangreichen
Holzvertäfelung eingenommen wird.
Die Bilder stellen die vier Elemente
dar (Tafel XXXV): Die Erde wird
durch eine von Früchten umgebene
Frau mit Mauerkrone versinnbildlicht,
Neptun und Amphitrite sollen das
Wasser, Vulkan und Venus das Feuer,
Boreas, der die Oreithyia raubt, die
Luft vorstellen. Man hat diese Male-
reien bisher stets für Arbeiten eines
Italieners gehalten — der Name Guido
Reni wird genannt — und Schöner-
mark verzeichnet die Uberlieferung,
daß sie unter der Regierung des Für-
sten Georg Adolf (1860—i8g3) in
Italien gekauft sein «sollen». Es kann
jedoch schon angesichts der Abbil-
dungen kaum einem Zweifel unter-
liegen, daß wir hier eine der von
Rottenhammer für den Grafen Ernst
gemalten Decken vor uns haben. Kom-
positionsweise wie Typen reden eine
zu deutliche Sprache.
Der Brief vom März 1613 ent-
hält gleichzeitig Mitteilungen, die auf
die Beziehungen des Grafen zu de Vries und auf die Entstehungsgeschichte des Tauf-
beckens in der Schloßkirche zu Bückeburg neues Licht werfen. Der Graf hatte Rottenhammer
den Auftrag gegeben, einen besonders tüchtigen Meister in Erfahrung zu bringen, der ihm ein
Taufbecken gießen könne. Rottenhammer schreibt nun, daß er auf der Durchreise in Nürnberg
wider Erwarten keinen solchen Künstler angetroffen habe. Er habe sich daher an Adriaen de
Vries in Prag gewandt und gleichzeitig eine Visierung mitgeschickt. De Vries wolle auch
zwei Modelle nach Augsburg senden, die dann sofort nach Bückeburg weitergehen sollten. Allem
Anschein nach hat also Rottenhammer die Verbindung des de Vries mit dem Grafen angebahnt,
der einige der schönsten Werke des Künstlers ihre Entstehung verdanken sollten.1 Das in seiner
Jan Brueghel und Rottenhammer, Ruhe auf der Flucht.
Wien, kaiserliche Gemäldegalerie.
1 Zwar werden in dem Kontrakt mit Nosseni vom 1. August 1608 (Mackowsky a. a. O., S. 66) die Bildhauerarbeiten
für das Mausoleum bereits dem de Vries zugedacht. Die erste Arbeit aber, die de Vries für den Grafen gemacht hat, ist das
Taufbecken. Vorher ist eine direkte Verbindung zwischen den beiden nicht nachzuweisen; denn daß der Graf den Bildhauer
in Italien oder in Prag kennen gelernt habe, wie Ilg und Buchwald annehmen möchten, ist bloße Vermutung.