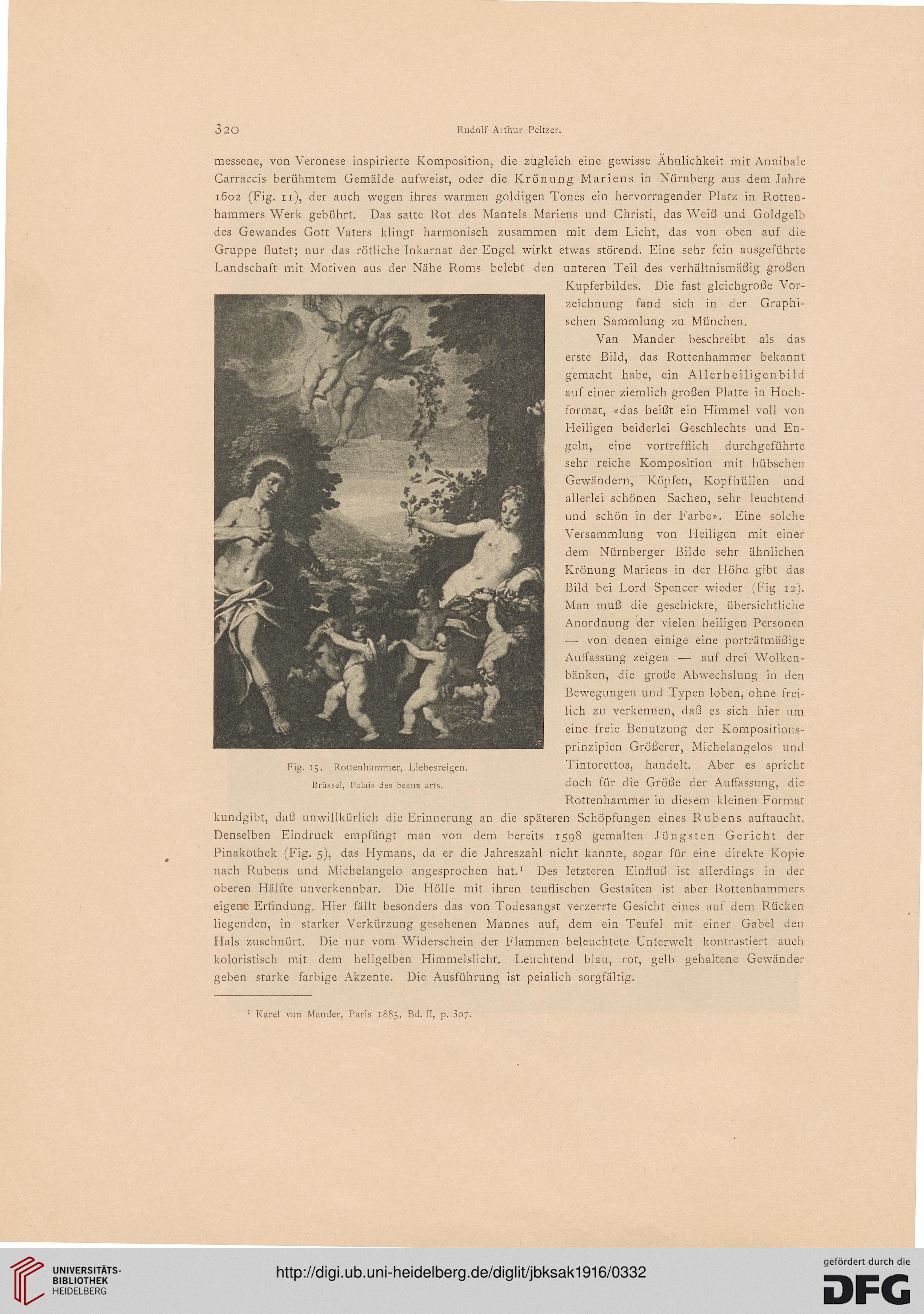320
Rudolf Arthur Peltzer.
messene, von Veronese inspirierte Komposition, die zugleich eine gewisse Ähnlichkeit mit Annibale
Carraccis berühmtem Gemälde aufweist, oder die Krönung Mariens in Nürnberg aus dem Jahre
1602 (Fig. 11), der auch wegen ihres warmen goldigen Tones ein hervorragender Platz in Rotten-
hammers Werk gebührt. Das satte Rot des Mantels Mariens und Christi, das Weiß und Goldgelb
des Gewandes Gott Vaters klingt harmonisch zusammen mit dem Licht, das von oben auf die
Gruppe flutet; nur das rötliche Inkarnat der Engel wirkt etwas störend. Eine sehr fein ausgeführte
Landschaft mit Motiven aus der Nähe Roms belebt den unteren Teil des verhältnismäßig großen
Kupferbildes. Die fast gleichgroße Vor-
zeichnung fand sich in der Graphi-
schen Sammlung zu München.
Van Mander beschreibt als das
erste Bild, das Rottenhammer bekannt
gemacht habe, ein Allerheiligenbild
auf einer ziemlich großen Platte in Hoch-
format, «das heißt ein Himmel voll von
Heiligen beiderlei Geschlechts und En-
geln, eine vortrefflich durchgeführte
sehr reiche Komposition mit hübschen
Gewändern, Köpfen, Kopfhüllen und
allerlei schönen Sachen, sehr leuchtend
und schön in der Farbe». Eine solche
Versammlung von Heiligen mit einer
dem Nürnberger Bilde sehr ähnlichen
Krönung Mariens in der Höhe gibt das
Bild bei Lord Spencer wieder (Fig 12).
Man muß die geschickte, übersichtliche
Anordnung der vielen heiligen Personen
— von denen einige eine porträtmäßige
Auffassung zeigen — auf drei Wolken-
bänken, die große Abwechslung in den
Bewegungen und Typen loben, ohne frei-
lich zu verkennen, daß es sich hier um
eine freie Benutzung der Kompositions-
prinzipien Größerer, Michelangelos und
Fig. 15. Rottenhammer, Liebesreigen. Tintorettos, handelt. Aber es spricht
Brüssel, Palais des beaux ans. doch für die Größe der Auffassung, die
Rottenhammer in diesem kleinen Format
kundgibt, daß unwillkürlich die Erinnerung an die späteren Schöpfungen eines Rubens auftaucht.
Denselben Eindruck empfängt man von dem bereits 1598 gemalten Jüngsten Gericht der
Pinakothek (Fig. 5), das Hymans, da er die Jahreszahl nicht kannte, sogar für eine direkte Kopie
nach Rubens und Michelangelo angesprochen hat.1 Des letzteren Einfluß ist allerdings in der
oberen Hälfte unverkennbar. Die Hölle mit ihren teuflischen Gestalten ist aber Rottenhammers
eigene Erfindung. Hier fällt besonders das von Todesangst verzerrte Gesicht eines auf dem Rücken
liegenden, in starker Verkürzung gesehenen Mannes auf, dem ein Teufel mit einer Gabel den
Hals zuschnürt. Die nur vom Widerschein der Flammen beleuchtete Unterwelt kontrastiert auch
koloristisch mit dem hellgelben Himmelslicht. Leuchtend blau, rot, gelb gehaltene Gewänder
geben starke farbige Akzente. Die Ausführung ist peinlich sorgfältig.
1 Karel van Mander, Paris 1885, Bd. II, p. 307.
Rudolf Arthur Peltzer.
messene, von Veronese inspirierte Komposition, die zugleich eine gewisse Ähnlichkeit mit Annibale
Carraccis berühmtem Gemälde aufweist, oder die Krönung Mariens in Nürnberg aus dem Jahre
1602 (Fig. 11), der auch wegen ihres warmen goldigen Tones ein hervorragender Platz in Rotten-
hammers Werk gebührt. Das satte Rot des Mantels Mariens und Christi, das Weiß und Goldgelb
des Gewandes Gott Vaters klingt harmonisch zusammen mit dem Licht, das von oben auf die
Gruppe flutet; nur das rötliche Inkarnat der Engel wirkt etwas störend. Eine sehr fein ausgeführte
Landschaft mit Motiven aus der Nähe Roms belebt den unteren Teil des verhältnismäßig großen
Kupferbildes. Die fast gleichgroße Vor-
zeichnung fand sich in der Graphi-
schen Sammlung zu München.
Van Mander beschreibt als das
erste Bild, das Rottenhammer bekannt
gemacht habe, ein Allerheiligenbild
auf einer ziemlich großen Platte in Hoch-
format, «das heißt ein Himmel voll von
Heiligen beiderlei Geschlechts und En-
geln, eine vortrefflich durchgeführte
sehr reiche Komposition mit hübschen
Gewändern, Köpfen, Kopfhüllen und
allerlei schönen Sachen, sehr leuchtend
und schön in der Farbe». Eine solche
Versammlung von Heiligen mit einer
dem Nürnberger Bilde sehr ähnlichen
Krönung Mariens in der Höhe gibt das
Bild bei Lord Spencer wieder (Fig 12).
Man muß die geschickte, übersichtliche
Anordnung der vielen heiligen Personen
— von denen einige eine porträtmäßige
Auffassung zeigen — auf drei Wolken-
bänken, die große Abwechslung in den
Bewegungen und Typen loben, ohne frei-
lich zu verkennen, daß es sich hier um
eine freie Benutzung der Kompositions-
prinzipien Größerer, Michelangelos und
Fig. 15. Rottenhammer, Liebesreigen. Tintorettos, handelt. Aber es spricht
Brüssel, Palais des beaux ans. doch für die Größe der Auffassung, die
Rottenhammer in diesem kleinen Format
kundgibt, daß unwillkürlich die Erinnerung an die späteren Schöpfungen eines Rubens auftaucht.
Denselben Eindruck empfängt man von dem bereits 1598 gemalten Jüngsten Gericht der
Pinakothek (Fig. 5), das Hymans, da er die Jahreszahl nicht kannte, sogar für eine direkte Kopie
nach Rubens und Michelangelo angesprochen hat.1 Des letzteren Einfluß ist allerdings in der
oberen Hälfte unverkennbar. Die Hölle mit ihren teuflischen Gestalten ist aber Rottenhammers
eigene Erfindung. Hier fällt besonders das von Todesangst verzerrte Gesicht eines auf dem Rücken
liegenden, in starker Verkürzung gesehenen Mannes auf, dem ein Teufel mit einer Gabel den
Hals zuschnürt. Die nur vom Widerschein der Flammen beleuchtete Unterwelt kontrastiert auch
koloristisch mit dem hellgelben Himmelslicht. Leuchtend blau, rot, gelb gehaltene Gewänder
geben starke farbige Akzente. Die Ausführung ist peinlich sorgfältig.
1 Karel van Mander, Paris 1885, Bd. II, p. 307.