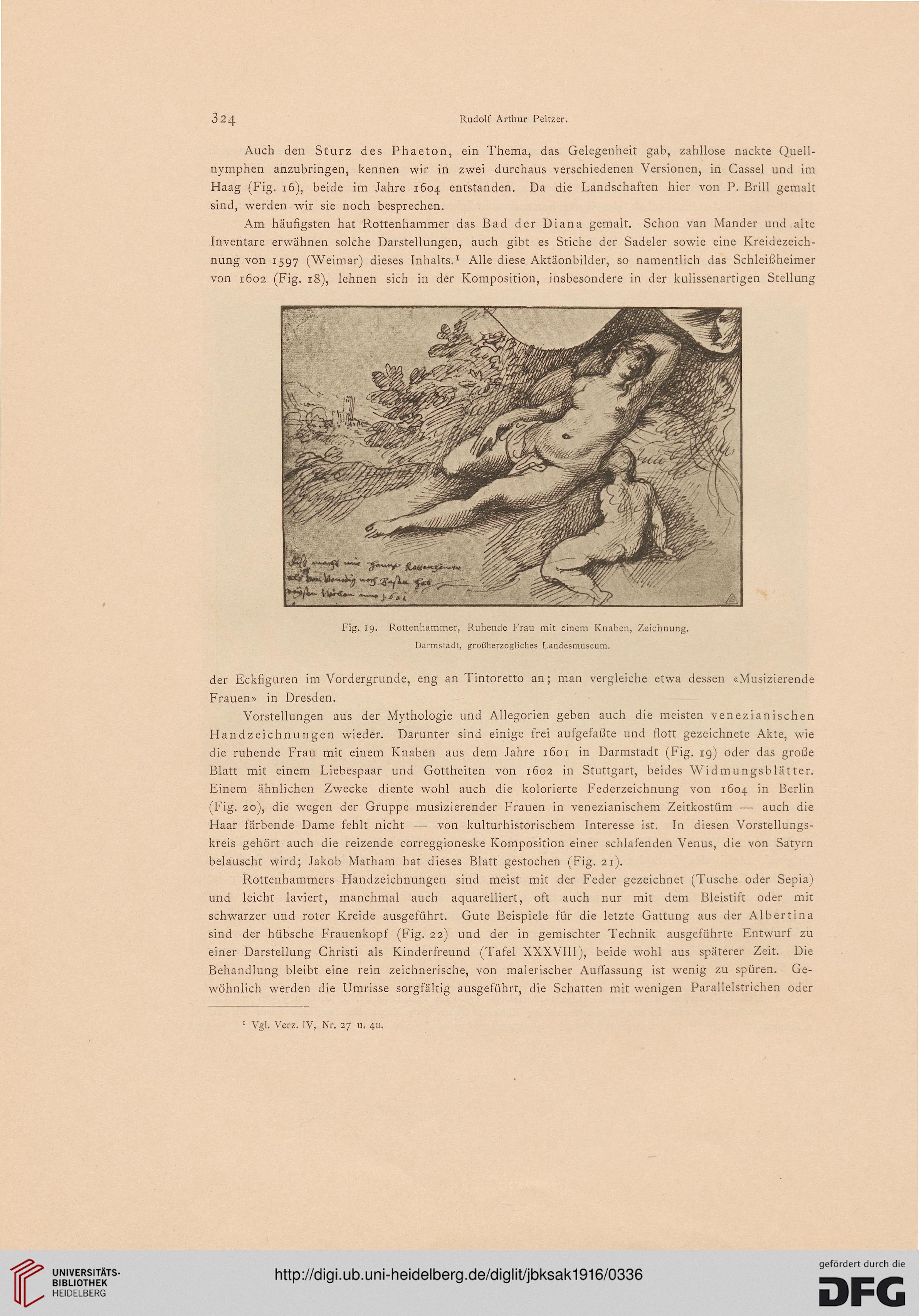324
Rudolf Arthur Peltzer.
Auch den Sturz des Phaeton, ein Thema, das Gelegenheit gab, zahllose nackte Quell-
nymphen anzubringen, kennen wir in zwei durchaus verschiedenen Versionen, in Cassel und im
Haag (Fig. 16), beide im Jahre 1604 entstanden. Da die Landschaften hier von P. Brill gemalt
sind, werden wir sie noch besprechen.
Am häufigsten hat Rottenhammer das Bad der Diana gemalt. Schon van Mander und alte
Inventare erwähnen solche Darstellungen, auch gibt es Stiche der Sadeler sowie eine Kreidezeich-
nung von 1597 (Weimar) dieses Inhalts.1 Alle diese Aktäonbilder, so namentlich das Schleißheimer
von 1602 (Fig. 18), lehnen sich in der Komposition, insbesondere in der kulissenartigen Stellung
Fig. 19. Rottenhammer, Ruhende Frau mit einem Knaben, Zeichnung.
Darmstadt, großherzogliches Landesmuseum.
der Eckfiguren im Vordergrunde, eng an Tintoretto an; man vergleiche etwa dessen «Musizierende
Frauen» in Dresden.
Vorstellungen aus der Mythologie und Allegorien geben auch die meisten venezianischen
Handzeichnungen wieder. Darunter sind einige frei aufgefaßte und flott gezeichnete Akte, wie
die ruhende Frau mit einem Knaben aus dem Jahre 1601 in Darmstadt (Fig. 19) oder das große
Blatt mit einem Liebespaar und Gottheiten von 1602 in Stuttgart, beides Widmungsblätter.
Einem ähnlichen Zwecke diente wohl auch die kolorierte Federzeichnung von 1604 in Berlin
(Fig. 20), die wegen der Gruppe musizierender Frauen in venezianischem Zeitkostüm — auch die
Haar färbende Dame fehlt nicht — von kulturhistorischem Interesse ist. In diesen Vorstellungs-
kreis gehört auch die reizende corrcggioneske Komposition einer schlafenden Venus, die von Satyrn
belauscht wird; Jakob Matham hat dieses Blatt gestochen (Fig. 21).
Rottenhammers Handzeichnungen sind meist mit der Feder gezeichnet (Tusche oder Sepia)
und leicht laviert, manchmal auch aquarelliert, oft auch nur mit dem Bleistift oder mit
schwarzer und roter Kreide ausgeführt. Gute Beispiele für die letzte Gattung aus der Albertina
sind der hübsche Frauenkopf (Fig. 22) und der in gemischter Technik ausgeführte Entwurf zu
einer Darstellung Christi als Kinderfreund (Tafel XXXVIII), beide wohl aus späterer Zeit. Die
Behandlung bleibt eine rein zeichnerische, von malerischer Auffassung ist wenig zu spüren. Ge-
wöhnlich werden die Umrisse sorgfältig ausgeführt, die Schatten mit wenigen Parallelstrichen oder
1 Vgl. Verz. IV, Nr. 27 u. 40.
Rudolf Arthur Peltzer.
Auch den Sturz des Phaeton, ein Thema, das Gelegenheit gab, zahllose nackte Quell-
nymphen anzubringen, kennen wir in zwei durchaus verschiedenen Versionen, in Cassel und im
Haag (Fig. 16), beide im Jahre 1604 entstanden. Da die Landschaften hier von P. Brill gemalt
sind, werden wir sie noch besprechen.
Am häufigsten hat Rottenhammer das Bad der Diana gemalt. Schon van Mander und alte
Inventare erwähnen solche Darstellungen, auch gibt es Stiche der Sadeler sowie eine Kreidezeich-
nung von 1597 (Weimar) dieses Inhalts.1 Alle diese Aktäonbilder, so namentlich das Schleißheimer
von 1602 (Fig. 18), lehnen sich in der Komposition, insbesondere in der kulissenartigen Stellung
Fig. 19. Rottenhammer, Ruhende Frau mit einem Knaben, Zeichnung.
Darmstadt, großherzogliches Landesmuseum.
der Eckfiguren im Vordergrunde, eng an Tintoretto an; man vergleiche etwa dessen «Musizierende
Frauen» in Dresden.
Vorstellungen aus der Mythologie und Allegorien geben auch die meisten venezianischen
Handzeichnungen wieder. Darunter sind einige frei aufgefaßte und flott gezeichnete Akte, wie
die ruhende Frau mit einem Knaben aus dem Jahre 1601 in Darmstadt (Fig. 19) oder das große
Blatt mit einem Liebespaar und Gottheiten von 1602 in Stuttgart, beides Widmungsblätter.
Einem ähnlichen Zwecke diente wohl auch die kolorierte Federzeichnung von 1604 in Berlin
(Fig. 20), die wegen der Gruppe musizierender Frauen in venezianischem Zeitkostüm — auch die
Haar färbende Dame fehlt nicht — von kulturhistorischem Interesse ist. In diesen Vorstellungs-
kreis gehört auch die reizende corrcggioneske Komposition einer schlafenden Venus, die von Satyrn
belauscht wird; Jakob Matham hat dieses Blatt gestochen (Fig. 21).
Rottenhammers Handzeichnungen sind meist mit der Feder gezeichnet (Tusche oder Sepia)
und leicht laviert, manchmal auch aquarelliert, oft auch nur mit dem Bleistift oder mit
schwarzer und roter Kreide ausgeführt. Gute Beispiele für die letzte Gattung aus der Albertina
sind der hübsche Frauenkopf (Fig. 22) und der in gemischter Technik ausgeführte Entwurf zu
einer Darstellung Christi als Kinderfreund (Tafel XXXVIII), beide wohl aus späterer Zeit. Die
Behandlung bleibt eine rein zeichnerische, von malerischer Auffassung ist wenig zu spüren. Ge-
wöhnlich werden die Umrisse sorgfältig ausgeführt, die Schatten mit wenigen Parallelstrichen oder
1 Vgl. Verz. IV, Nr. 27 u. 40.