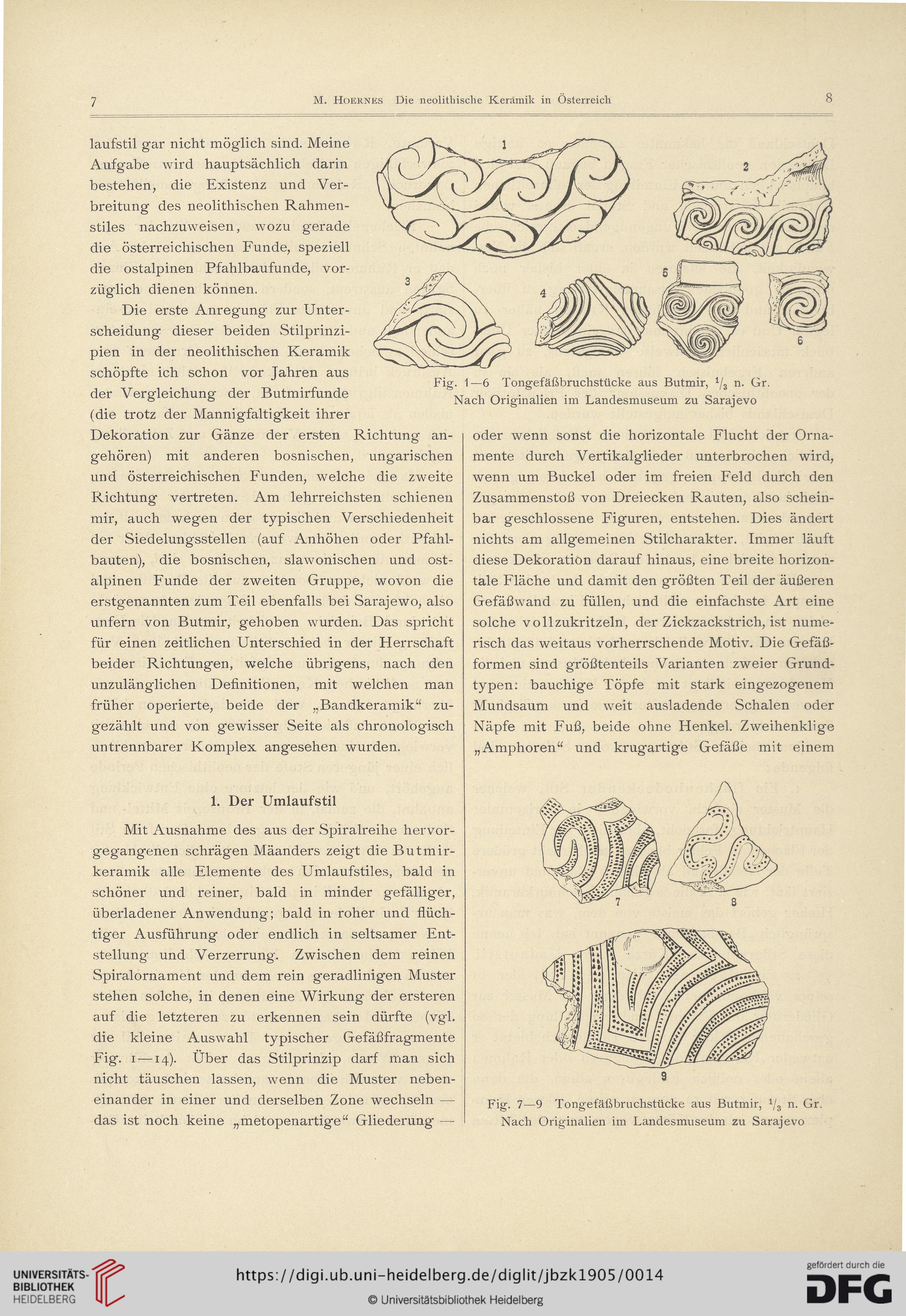7
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
8
Fig. 1—6 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.
Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo
laufstil gar nicht möglich sind. Meine
Aufgabe wird hauptsächlich darin
bestehen, die Existenz und Ver-
breitung des neolithischen Rahmen-
stiles nachzuweisen, wozu gerade
die österreichischen Funde, speziell
die ostalpinen Pfahlbaufunde, vor-
züglich dienen können.
Die erste Anregung zur Unter-
scheidung dieser beiden Stilprinzi-
pien in der neolithischen Keramik
schöpfte ich schon vor Jahren aus
der Vergleichung der Butmirfunde
(die trotz der Mannigfaltigkeit ihrer
Dekoration zur Gänze der ersten Richtung an-
gehören) mit anderen bosnischen, ungarischen
und österreichischen Funden, welche die zweite
Richtung vertreten. Am lehrreichsten schienen
mir, auch wegen der typischen Verschiedenheit
der Siedelungsstellen (auf Anhöhen oder Pfahl-
bauten), die bosnischen, slawonischen und ost-
alpinen Funde der zweiten Gruppe, wovon die
erstgenannten zum Teil ebenfalls bei Sarajewo, also
unfern von Butmir, gehoben wurden. Das spricht
für einen zeitlichen Unterschied in der Herrschaft
beider Richtungen, welche übrigens, nach den
unzulänglichen Definitionen, mit welchen man
früher operierte, beide der „Bandkeramik“ zu-
gezählt und von gewisser Seite als chronologisch
untrennbarer Komplex angesehen wurden.
1. Der Umlaufstil
Mit Ausnahme des aus der Spiralreihe hervor-
gegangenen schrägen Mäanders zeigt die Butmir-
keramik alle Elemente des Umlaufstiles, bald in
schöner und reiner, bald in minder gefälliger,
überladener Anwendung; bald in roher und flüch-
tiger Ausführung oder endlich in seltsamer Ent-
stellung und Verzerrung. Zwischen dem reinen
Spiralornament und dem rein geradlinigen Muster
stehen solche, in denen eine Wirkung der ersteren
auf die letzteren zu erkennen sein dürfte (vgl.
die kleine Auswahl typischer Gefäßfragmente
Fig. i —14). Über das Stilprinzip darf man sich
nicht täuschen lassen, wenn die Muster neben-
einander in einer und derselben Zone wechseln —
das ist noch keine „metopenartige“ Gliederung —
oder wenn sonst die horizontale Flucht der Orna-
mente durch Vertikalglieder unterbrochen wird,
wenn um Buckel oder im freien Feld durch den
Zusammenstoß von Dreiecken Rauten, also schein-
bar geschlossene Figuren, entstehen. Dies ändert
nichts am allgemeinen Stilcharakter. Immer läuft
diese Dekoration darauf hinaus, eine breite horizon-
tale Fläche und damit den größten Teil der äußeren
Gefäßwand zu füllen, und die einfachste Art eine
solche voll zukritzeln, der Zickzackstrich, ist nume-
risch das weitaus vorherrschende Motiv. Die Gefäß-
formen sind größtenteils Varianten zweier Grund-
typen: bauchige Töpfe mit stark eingezogenem
Mundsaum und weit ausladende Schalen oder
Näpfe mit Fuß, beide ohne Henkel. Zweihenklige
„Amphoren“ und krugartige Gefäße mit einem
Fig. 7—9 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.
Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
8
Fig. 1—6 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.
Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo
laufstil gar nicht möglich sind. Meine
Aufgabe wird hauptsächlich darin
bestehen, die Existenz und Ver-
breitung des neolithischen Rahmen-
stiles nachzuweisen, wozu gerade
die österreichischen Funde, speziell
die ostalpinen Pfahlbaufunde, vor-
züglich dienen können.
Die erste Anregung zur Unter-
scheidung dieser beiden Stilprinzi-
pien in der neolithischen Keramik
schöpfte ich schon vor Jahren aus
der Vergleichung der Butmirfunde
(die trotz der Mannigfaltigkeit ihrer
Dekoration zur Gänze der ersten Richtung an-
gehören) mit anderen bosnischen, ungarischen
und österreichischen Funden, welche die zweite
Richtung vertreten. Am lehrreichsten schienen
mir, auch wegen der typischen Verschiedenheit
der Siedelungsstellen (auf Anhöhen oder Pfahl-
bauten), die bosnischen, slawonischen und ost-
alpinen Funde der zweiten Gruppe, wovon die
erstgenannten zum Teil ebenfalls bei Sarajewo, also
unfern von Butmir, gehoben wurden. Das spricht
für einen zeitlichen Unterschied in der Herrschaft
beider Richtungen, welche übrigens, nach den
unzulänglichen Definitionen, mit welchen man
früher operierte, beide der „Bandkeramik“ zu-
gezählt und von gewisser Seite als chronologisch
untrennbarer Komplex angesehen wurden.
1. Der Umlaufstil
Mit Ausnahme des aus der Spiralreihe hervor-
gegangenen schrägen Mäanders zeigt die Butmir-
keramik alle Elemente des Umlaufstiles, bald in
schöner und reiner, bald in minder gefälliger,
überladener Anwendung; bald in roher und flüch-
tiger Ausführung oder endlich in seltsamer Ent-
stellung und Verzerrung. Zwischen dem reinen
Spiralornament und dem rein geradlinigen Muster
stehen solche, in denen eine Wirkung der ersteren
auf die letzteren zu erkennen sein dürfte (vgl.
die kleine Auswahl typischer Gefäßfragmente
Fig. i —14). Über das Stilprinzip darf man sich
nicht täuschen lassen, wenn die Muster neben-
einander in einer und derselben Zone wechseln —
das ist noch keine „metopenartige“ Gliederung —
oder wenn sonst die horizontale Flucht der Orna-
mente durch Vertikalglieder unterbrochen wird,
wenn um Buckel oder im freien Feld durch den
Zusammenstoß von Dreiecken Rauten, also schein-
bar geschlossene Figuren, entstehen. Dies ändert
nichts am allgemeinen Stilcharakter. Immer läuft
diese Dekoration darauf hinaus, eine breite horizon-
tale Fläche und damit den größten Teil der äußeren
Gefäßwand zu füllen, und die einfachste Art eine
solche voll zukritzeln, der Zickzackstrich, ist nume-
risch das weitaus vorherrschende Motiv. Die Gefäß-
formen sind größtenteils Varianten zweier Grund-
typen: bauchige Töpfe mit stark eingezogenem
Mundsaum und weit ausladende Schalen oder
Näpfe mit Fuß, beide ohne Henkel. Zweihenklige
„Amphoren“ und krugartige Gefäße mit einem
Fig. 7—9 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.
Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo