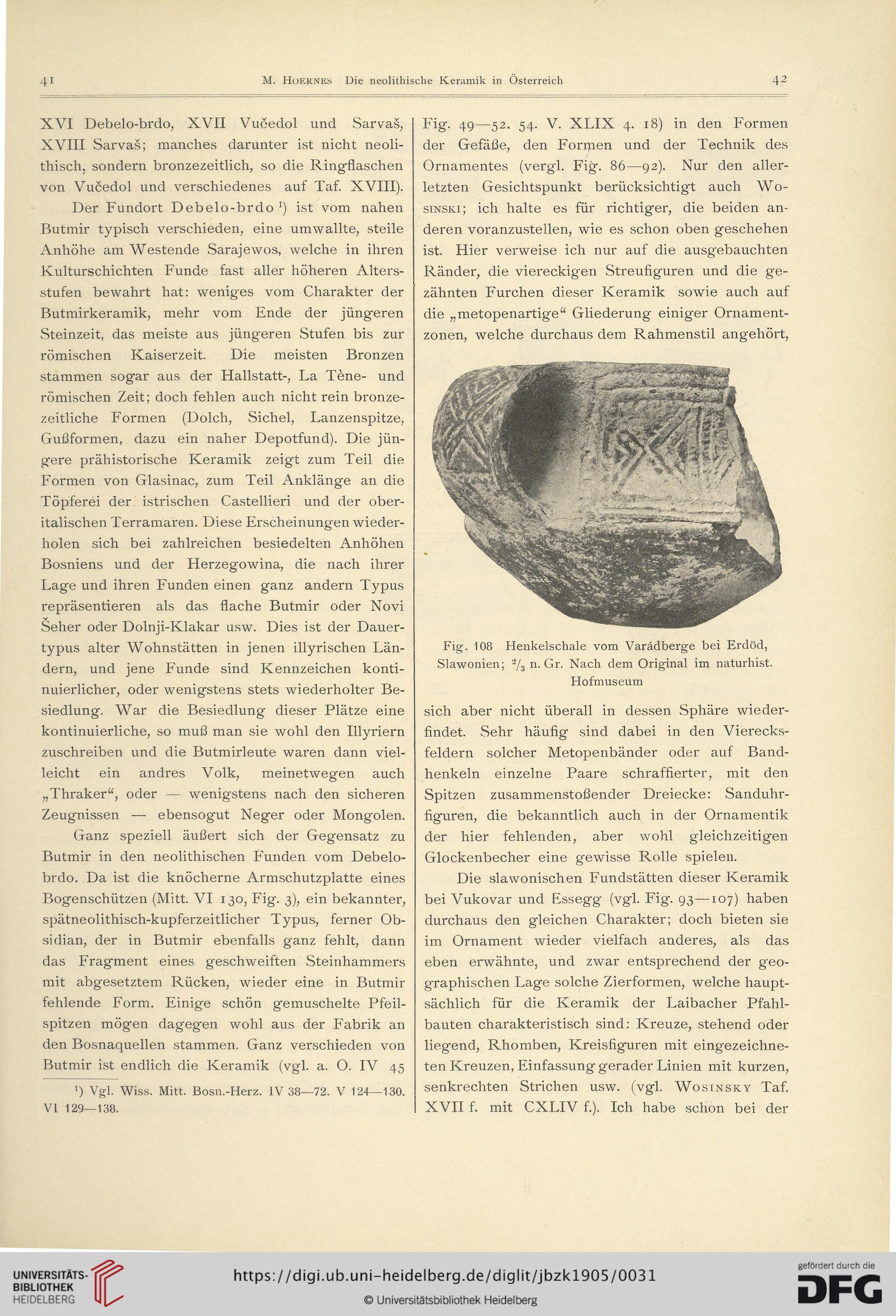4i
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
42
XVI Debelo-brdo, XVII Vuöedol und Sarvas,
XVIII Sarvas; manches darunter ist nicht neoli-
thisch, sondern bronzezeitlich, so die Ringflaschen
von Vucedol und verschiedenes auf Taf. XVIII).
Der Fundort Debelo-brdo *) ist vom nahen
Butmir typisch verschieden, eine umwallte, steile
Anhöhe am Westende Sarajewos, welche in ihren
Kulturschichten Funde fast aller höheren Alters-
stufen bewahrt hat: weniges vom Charakter der
Butmirkeramik, mehr vom Ende der jüngeren
Steinzeit, das meiste aus jüngeren Stufen bis zur
römischen Kaiserzeit. Die meisten Bronzen
stammen sogar aus der Hallstatt-, La Tene- und
römischen Zeit; doch fehlen auch nicht rein bronze-
zeitliche Formen (Dolch, Sichel, Lanzenspitze,
Gußformen, dazu ein naher Depotfund). Die jün-
gere prähistorische Keramik zeigt zum Teil die
Formen von Glasinac, zum Teil Anklänge an die
Töpferei der istrischen Castellieri und der ober-
italischen Terramaren. Diese Erscheinungen wieder-
holen sich bei zahlreichen besiedelten Anhöhen
Bosniens und der Herzegowina, die nach ihrer
Lage und ihren Funden einen ganz andern Typus
repräsentieren als das flache Butmir oder Novi
Seher oder Dolnji-Klakar usw. Dies ist der Dauer-
typus alter Wohnstätten in jenen illyrischen Län-
dern, und jene Funde sind Kennzeichen konti-
nuierlicher, oder wenigstens stets wiederholter Be-
siedlung. War die Besiedlung dieser Plätze eine
kontinuierliche, so muß man sie wohl den Illyriern
zuschreiben und die Butmirleute waren dann viel-
leicht ein andres Volk, meinetwegen auch
„Thraker“, oder — wenigstens nach den sicheren
Zeugnissen — ebensogut Neger oder Mongolen.
Ganz speziell äußert sich der Gegensatz zu
Butmir in den neolithischen Funden vom Debelo-
brdo. Da ist die knöcherne Armschutzplatte eines
Bogenschützen (Mitt. VI 130, Fig. 3), ein bekannter,
spätneolithisch-kupferzeitlicher Typus, ferner Ob-
sidian, der in Butmir ebenfalls ganz fehlt, dann
das Fragment eines geschweiften Steinhammers
mit abgesetztem Rücken, wieder eine in Butmir
fehlende Form. Einige schön gemuschelte Pfeil-
spitzen mögen dagegen wohl aus der Fabrik an
den Bosnaquellen stammen. Ganz verschieden von
Butmir ist endlich die Keramik (vgl. a. O. IV 45
Ö Vgl. Wiss. Mitt. Bosn.-Herz. IV 38—-72. V 124—130.
VI 129—138.
Fig. 49—-52, 54. V. XLIX 4. 18) in den Formen
der Gefäße, den Formen und der Technik des
Ornamentes (vergl. Fig. 86—92). Nur den aller-
letzten Gesichtspunkt berücksichtigt auch Wo-
sinski; ich halte es für richtiger, die beiden an-
deren voranzustellen, wie es schon oben geschehen
ist. Hier verweise ich nur auf die ausgebauchten
Ränder, die viereckigen Streufiguren und die ge-
zähnten Furchen dieser Keramik sowie auch auf
die „metopenartige“ Gliederung einiger Ornament-
zonen, welche durchaus dem Rahmenstil angehört,
Fig. 108 Henkelschale vom Varädberge bei Erdöd,
Slawonien; 2/3 n. Gr. Nach dem Original im naturhist.
Hofmuseum
sich aber nicht überall in dessen Sphäre wieder-
findet. Sehr häufig sind dabei in den Vierecks-
feldern solcher Metopenbänder oder auf Band-
henkeln einzelne Paare schraffierter, mit den
Spitzen zusammenstoßender Dreiecke: Sanduhr-
figuren, die bekanntlich auch in der Ornamentik
der hier fehlenden, aber wohl gleichzeitigen
Glockenbecher eine gewisse Rolle spielen.
Die slawonischen Fundstätten dieser Keramik
bei Vukovar und Essegg (vgl. Fig. 93—107) haben
durchaus den gleichen Charakter; doch bieten sie
im Ornament wieder vielfach anderes, als das
eben erwähnte, und zwar entsprechend der geo-
graphischen Lage solche Zierformen, welche haupt-
sächlich für die Keramik der Laibacher Pfahl-
bauten charakteristisch sind: Kreuze, stehend oder
liegend, Rhomben, Kreisfiguren mit eingezeichne-
ten Kreuzen, Einfassung gerader Linien mit kurzen,
senkrechten Strichen usw. (vgl. Wosinsky Taf.
XVII f. mit CXLIVf.). Ich habe schon bei der
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
42
XVI Debelo-brdo, XVII Vuöedol und Sarvas,
XVIII Sarvas; manches darunter ist nicht neoli-
thisch, sondern bronzezeitlich, so die Ringflaschen
von Vucedol und verschiedenes auf Taf. XVIII).
Der Fundort Debelo-brdo *) ist vom nahen
Butmir typisch verschieden, eine umwallte, steile
Anhöhe am Westende Sarajewos, welche in ihren
Kulturschichten Funde fast aller höheren Alters-
stufen bewahrt hat: weniges vom Charakter der
Butmirkeramik, mehr vom Ende der jüngeren
Steinzeit, das meiste aus jüngeren Stufen bis zur
römischen Kaiserzeit. Die meisten Bronzen
stammen sogar aus der Hallstatt-, La Tene- und
römischen Zeit; doch fehlen auch nicht rein bronze-
zeitliche Formen (Dolch, Sichel, Lanzenspitze,
Gußformen, dazu ein naher Depotfund). Die jün-
gere prähistorische Keramik zeigt zum Teil die
Formen von Glasinac, zum Teil Anklänge an die
Töpferei der istrischen Castellieri und der ober-
italischen Terramaren. Diese Erscheinungen wieder-
holen sich bei zahlreichen besiedelten Anhöhen
Bosniens und der Herzegowina, die nach ihrer
Lage und ihren Funden einen ganz andern Typus
repräsentieren als das flache Butmir oder Novi
Seher oder Dolnji-Klakar usw. Dies ist der Dauer-
typus alter Wohnstätten in jenen illyrischen Län-
dern, und jene Funde sind Kennzeichen konti-
nuierlicher, oder wenigstens stets wiederholter Be-
siedlung. War die Besiedlung dieser Plätze eine
kontinuierliche, so muß man sie wohl den Illyriern
zuschreiben und die Butmirleute waren dann viel-
leicht ein andres Volk, meinetwegen auch
„Thraker“, oder — wenigstens nach den sicheren
Zeugnissen — ebensogut Neger oder Mongolen.
Ganz speziell äußert sich der Gegensatz zu
Butmir in den neolithischen Funden vom Debelo-
brdo. Da ist die knöcherne Armschutzplatte eines
Bogenschützen (Mitt. VI 130, Fig. 3), ein bekannter,
spätneolithisch-kupferzeitlicher Typus, ferner Ob-
sidian, der in Butmir ebenfalls ganz fehlt, dann
das Fragment eines geschweiften Steinhammers
mit abgesetztem Rücken, wieder eine in Butmir
fehlende Form. Einige schön gemuschelte Pfeil-
spitzen mögen dagegen wohl aus der Fabrik an
den Bosnaquellen stammen. Ganz verschieden von
Butmir ist endlich die Keramik (vgl. a. O. IV 45
Ö Vgl. Wiss. Mitt. Bosn.-Herz. IV 38—-72. V 124—130.
VI 129—138.
Fig. 49—-52, 54. V. XLIX 4. 18) in den Formen
der Gefäße, den Formen und der Technik des
Ornamentes (vergl. Fig. 86—92). Nur den aller-
letzten Gesichtspunkt berücksichtigt auch Wo-
sinski; ich halte es für richtiger, die beiden an-
deren voranzustellen, wie es schon oben geschehen
ist. Hier verweise ich nur auf die ausgebauchten
Ränder, die viereckigen Streufiguren und die ge-
zähnten Furchen dieser Keramik sowie auch auf
die „metopenartige“ Gliederung einiger Ornament-
zonen, welche durchaus dem Rahmenstil angehört,
Fig. 108 Henkelschale vom Varädberge bei Erdöd,
Slawonien; 2/3 n. Gr. Nach dem Original im naturhist.
Hofmuseum
sich aber nicht überall in dessen Sphäre wieder-
findet. Sehr häufig sind dabei in den Vierecks-
feldern solcher Metopenbänder oder auf Band-
henkeln einzelne Paare schraffierter, mit den
Spitzen zusammenstoßender Dreiecke: Sanduhr-
figuren, die bekanntlich auch in der Ornamentik
der hier fehlenden, aber wohl gleichzeitigen
Glockenbecher eine gewisse Rolle spielen.
Die slawonischen Fundstätten dieser Keramik
bei Vukovar und Essegg (vgl. Fig. 93—107) haben
durchaus den gleichen Charakter; doch bieten sie
im Ornament wieder vielfach anderes, als das
eben erwähnte, und zwar entsprechend der geo-
graphischen Lage solche Zierformen, welche haupt-
sächlich für die Keramik der Laibacher Pfahl-
bauten charakteristisch sind: Kreuze, stehend oder
liegend, Rhomben, Kreisfiguren mit eingezeichne-
ten Kreuzen, Einfassung gerader Linien mit kurzen,
senkrechten Strichen usw. (vgl. Wosinsky Taf.
XVII f. mit CXLIVf.). Ich habe schon bei der