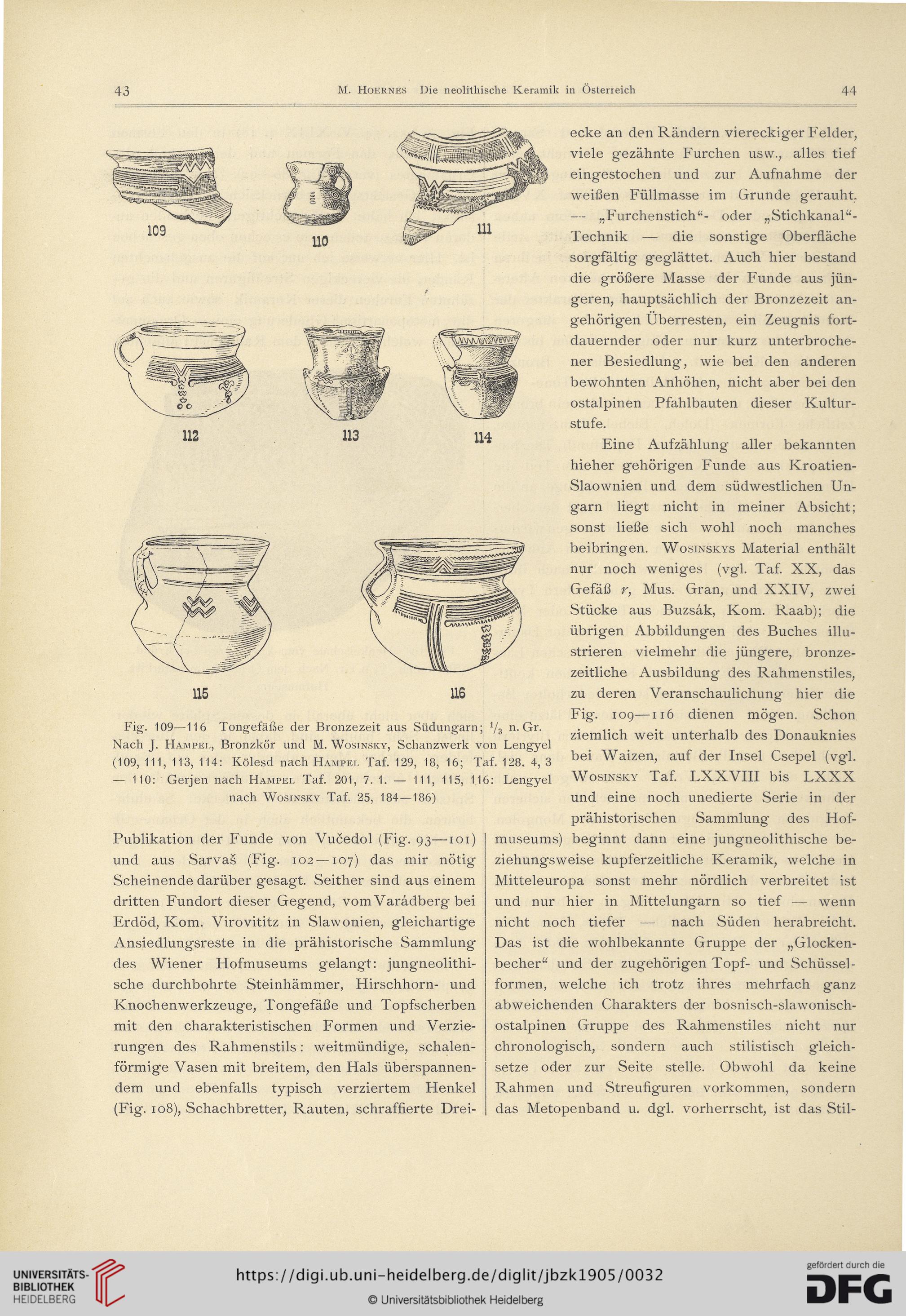43
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
44
115
Fig. 109—116 Tongefäße der Bronzezeit aus Südungarn; % n. Gr.
Nach J. Hampel, Bronzkör und M. Wosinsky, Schanzwerk von Lengyel
(109, 111, 113, 114: Kölesd nach Hampel Taf. 129, 18, 16; Taf. 128. 4, 3
— 110: Gerjen nach Hampel Taf. 201, 7. 1. — 111, 115, 116: Lengyel
nach Wosinsky Taf. 25, 184 —186)
Publikation der Funde von Vucedol (Fig. 93—101)
und aus Sarvas (Fig. 102 —107) das mir nötig
Scheinende darüber gesagt. Seither sind aus einem
dritten Fundort dieser Gegend, vomVarädberg- bei
Erdöd, Kom. Virovititz in Slawonien, gleichartige
Ansiedlungsreste in die prähistorische Sammlung
des Wiener Hofmuseums gelangt: jungneolithi-
sche durchbohrte Steinhämmer, Hirschhorn- und
Knochenwerkzeuge, Tongefäße und Topfscherben
mit den charakteristischen Formen und Verzie-
rungen des Rahmenstils: weitmündige, schalen-
förmige Vasen mit breitem, den Hals überspannen-
dem und ebenfalls typisch verziertem Henkel
(Fig. 108), Schachbretter, Rauten, schraffierte Drei-
ecke an den Rändern viereckiger Felder,
viele gezähnte Furchen usw., alles tief
eingestochen und zur Aufnahme der
weißen Füllmasse im Grunde gerauht,
— „Furchenstich“- oder „Stichkanal“-
Technik — die sonstige Oberfläche
sorgfältig geglättet. Auch hier bestand
die größere Masse der Funde aus jün-
geren, hauptsächlich der Bronzezeit an-
gehörigen Überresten, ein Zeugnis fort-
dauernder oder nur kurz unterbroche-
ner Besiedlung, wie bei den anderen
bewohnten Anhöhen, nicht aber bei den
ostalpinen Pfahlbauten dieser Kultur-
stufe.
Eine Aufzählung aller bekannten
hieher gehörigen Funde aus Kroatien-
Slaownien und dem südwestlichen Un-
garn liegt nicht in meiner Absicht;
sonst ließe sich wohl noch manches
beibringen. Wosinskys Material enthält
nur noch weniges (vgl. Taf. XX, das
Gefäß r, Mus. Gran, und XXIV, zwei
Stücke aus Buzsäk, Kom. Raab); die
übrigen Abbildungen des Buches illu-
strieren vielmehr die jüngere, bronze-
zeitliche Ausbildung des Rahmenstiles,
zu deren Veranschaulichung hier die
Fig. 109—116 dienen mögen. Schon
ziemlich weit unterhalb des Donauknies
bei Waizen, auf der Insel Csepel (vgl.
Wosinsky Taf. LXXVIII bis LXXX
und eine noch unedierte Serie in der
prähistorischen Sammlung des Hof-
museums) beginnt dann eine jungneolithische be-
ziehungsweise kupferzeitliche Keramik, welche in
Mitteleuropa sonst mehr nördlich verbreitet ist
und nur hier in Mittelungarn so tief — wenn
nicht noch tiefer — nach Süden herabreicht.
Das ist die wohlbekannte Gruppe der „Glocken-
becher“ und der zugehörigen Topf- und Schüssel -
formen, welche ich trotz ihres mehrfach ganz
abweichenden Charakters der bosnisch-slawonisch-
ostalpinen Gruppe des Rahmenstiles nicht nur
chronologisch, sondern auch stilistisch gleich-
setze oder zur Seite stelle. Obwohl da keine
Rahmen und Streufiguren vorkommen, sondern
das Metopenband u. dgl. vorherrscht, ist das Stil-
M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich
44
115
Fig. 109—116 Tongefäße der Bronzezeit aus Südungarn; % n. Gr.
Nach J. Hampel, Bronzkör und M. Wosinsky, Schanzwerk von Lengyel
(109, 111, 113, 114: Kölesd nach Hampel Taf. 129, 18, 16; Taf. 128. 4, 3
— 110: Gerjen nach Hampel Taf. 201, 7. 1. — 111, 115, 116: Lengyel
nach Wosinsky Taf. 25, 184 —186)
Publikation der Funde von Vucedol (Fig. 93—101)
und aus Sarvas (Fig. 102 —107) das mir nötig
Scheinende darüber gesagt. Seither sind aus einem
dritten Fundort dieser Gegend, vomVarädberg- bei
Erdöd, Kom. Virovititz in Slawonien, gleichartige
Ansiedlungsreste in die prähistorische Sammlung
des Wiener Hofmuseums gelangt: jungneolithi-
sche durchbohrte Steinhämmer, Hirschhorn- und
Knochenwerkzeuge, Tongefäße und Topfscherben
mit den charakteristischen Formen und Verzie-
rungen des Rahmenstils: weitmündige, schalen-
förmige Vasen mit breitem, den Hals überspannen-
dem und ebenfalls typisch verziertem Henkel
(Fig. 108), Schachbretter, Rauten, schraffierte Drei-
ecke an den Rändern viereckiger Felder,
viele gezähnte Furchen usw., alles tief
eingestochen und zur Aufnahme der
weißen Füllmasse im Grunde gerauht,
— „Furchenstich“- oder „Stichkanal“-
Technik — die sonstige Oberfläche
sorgfältig geglättet. Auch hier bestand
die größere Masse der Funde aus jün-
geren, hauptsächlich der Bronzezeit an-
gehörigen Überresten, ein Zeugnis fort-
dauernder oder nur kurz unterbroche-
ner Besiedlung, wie bei den anderen
bewohnten Anhöhen, nicht aber bei den
ostalpinen Pfahlbauten dieser Kultur-
stufe.
Eine Aufzählung aller bekannten
hieher gehörigen Funde aus Kroatien-
Slaownien und dem südwestlichen Un-
garn liegt nicht in meiner Absicht;
sonst ließe sich wohl noch manches
beibringen. Wosinskys Material enthält
nur noch weniges (vgl. Taf. XX, das
Gefäß r, Mus. Gran, und XXIV, zwei
Stücke aus Buzsäk, Kom. Raab); die
übrigen Abbildungen des Buches illu-
strieren vielmehr die jüngere, bronze-
zeitliche Ausbildung des Rahmenstiles,
zu deren Veranschaulichung hier die
Fig. 109—116 dienen mögen. Schon
ziemlich weit unterhalb des Donauknies
bei Waizen, auf der Insel Csepel (vgl.
Wosinsky Taf. LXXVIII bis LXXX
und eine noch unedierte Serie in der
prähistorischen Sammlung des Hof-
museums) beginnt dann eine jungneolithische be-
ziehungsweise kupferzeitliche Keramik, welche in
Mitteleuropa sonst mehr nördlich verbreitet ist
und nur hier in Mittelungarn so tief — wenn
nicht noch tiefer — nach Süden herabreicht.
Das ist die wohlbekannte Gruppe der „Glocken-
becher“ und der zugehörigen Topf- und Schüssel -
formen, welche ich trotz ihres mehrfach ganz
abweichenden Charakters der bosnisch-slawonisch-
ostalpinen Gruppe des Rahmenstiles nicht nur
chronologisch, sondern auch stilistisch gleich-
setze oder zur Seite stelle. Obwohl da keine
Rahmen und Streufiguren vorkommen, sondern
das Metopenband u. dgl. vorherrscht, ist das Stil-