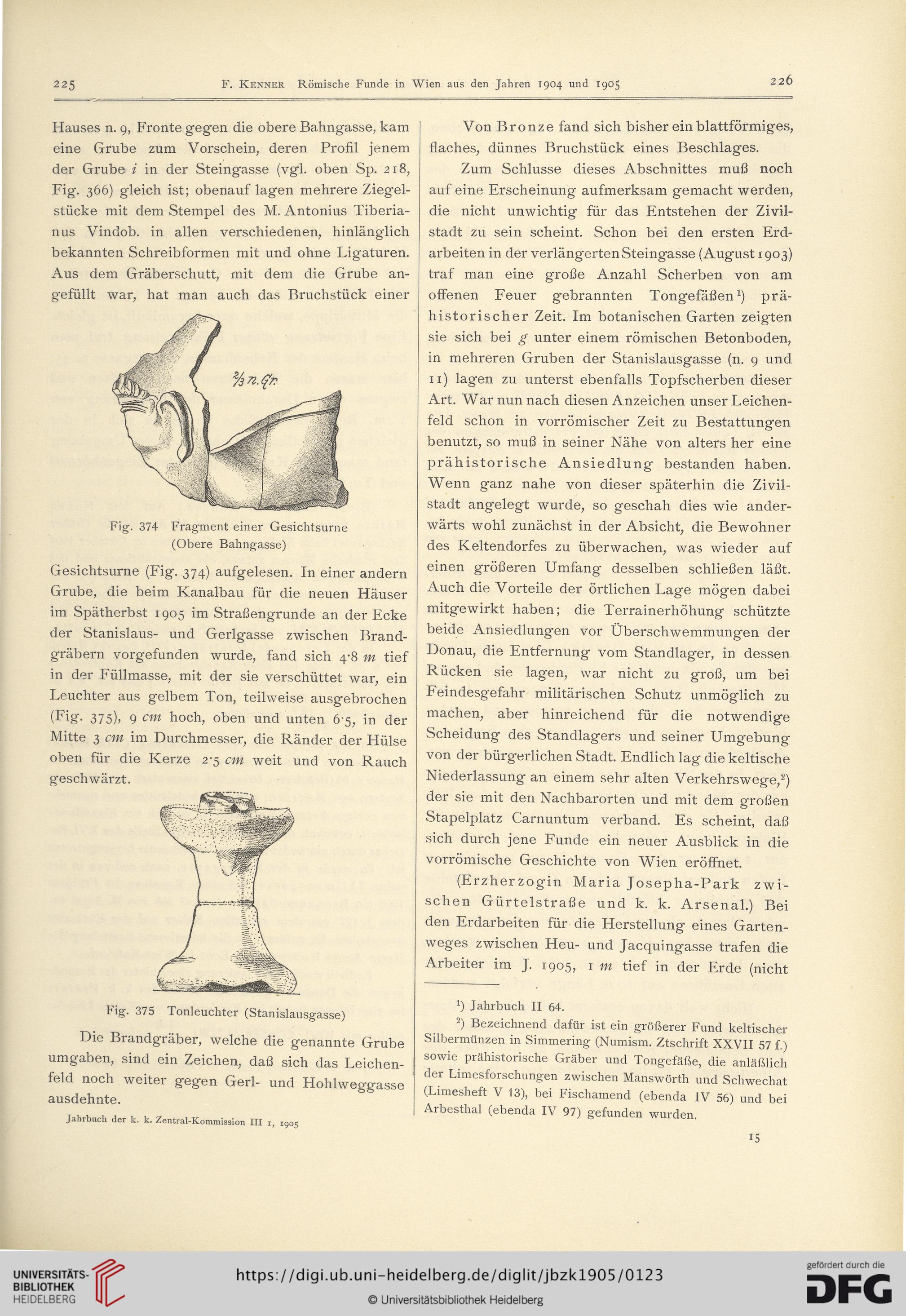225
F. Kenner Römische Funde in Wien aus den Jahren 1904 und I9°S
226
Hauses n. 9, Fronte gegen die obere Bahngasse, kam
eine Grube zum Vorschein, deren Profil jenem
der Grube i in der Steingasse (vgl. oben Sp. 218,
Fig. 366) gleich ist; obenauf lagen mehrere Ziegel-
stücke mit dem Stempel des M. Antonius Tiberia-
nus Vindob. in allen verschiedenen, hinlänglich
bekannten Schreibformen mit und ohne Ligaturen.
Aus dem Gräberschutt, mit dem die Grube an-
gefüllt war, hat man auch das Bruchstück einer
Fig. 374 Fragment einer Gesichtsurne
(Obere Bahngasse)
Gesichtsurne (Fig. 374) aufgelesen. In einer andern
Grube, die beim Kanalbau für die neuen Häuser
im Spätherbst 1905 im Straßengrunde an der Ecke
der Stanislaus- und Gerlgasse zwischen Brand-
gräbern vorgefunden wurde, fand sich 4-8 m tief
in der Füllmasse, mit der sie verschüttet war, ein
Leuchter aus gelbem Ton, teilweise ausgebrochen
(Fig. 375), 9 cm hoch, oben und unten 6-5, in der
Mitte 3 cm im Durchmesser, die Ränder der Hülse
oben für die Kerze 2-5 cm weit und von Rauch
geschwärzt.
Fig. 375 Tonleuchter (Stanislausgasse)
Die Brandgräber, welche die genannte Grube
umgaben, sind ein Zeichen, daß sich das Leichen-
feld noch weiter gegen Gerl- und Hohlweggasse
ausdehnte.
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission ITI 1, 1905
Von Bronze fand sich bisher ein blattförmiges,
flaches, dünnes Bruchstück eines Beschlages.
Zum Schlüsse dieses Abschnittes muß noch
auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht werden,
die nicht unwichtig für das Entstehen der Zivil-
stadt zu sein scheint. Schon bei den ersten Erd-
arbeiten in der verlängerten Steingasse (August 1903)
traf man eine große Anzahl Scherben von am
offenen Feuer gebrannten Tongefäßen1) prä-
historischer Zeit. Im botanischen Garten zeigten
sie sich bei g unter einem römischen Betonboden,
in mehreren Gruben der Stanislausgasse (n. 9 und
11) lagen zu unterst ebenfalls Topfscherben dieser
Art. War nun nach diesen Anzeichen unser Leichen-
feld schon in vorrömischer Zeit zu Bestattungen
benutzt, so muß in seiner Nähe von alters her eine
prähistorische Ansiedlung bestanden haben.
Wenn ganz nahe von dieser späterhin die Zivil-
stadt angelegt wurde, so geschah dies wie ander-
wärts wohl zunächst in der Absicht, die Bewohner
des Keltendorfes zu überwachen, was wieder auf
einen größeren Umfang desselben schließen läßt.
Auch die Vorteile der örtlichen Lage mögen dabei
mitgewirkt haben; die Terrainerhöhung schützte
beide Ansiedlungen vor Überschwemmungen der
Donau, die Entfernung vom Standlager, in dessen
Rücken sie lagen, war nicht zu groß, um bei
Feindesgefahr militärischen Schutz unmöglich zu
machen, aber hinreichend für die notwendige
Scheidung des Standlagers und seiner Umgebung
von der bürgerlichen Stadt. Endlich lag die keltische
Niederlassung an einem sehr alten Verkehrswege,2)
der sie mit den Nachbarorten und mit dem großen
Stapelplatz Carnuntum verband. Es scheint, daß
sich durch jene Funde ein neuer Ausblick in die
vorrömische Geschichte von Wien eröffnet.
(Erzherzogin Maria Josepha-Park zwi-
schen Gürtelstraße und k. k. Arsenal.) Bei
den Erdarbeiten für die Herstellung eines Garten-
weges zwischen Heu- und Jacquingasse trafen die
Arbeiter im J. 1905, 1 m tief in der Erde (nicht
1) Jahrbuch II 64.
2) Bezeichnend dafür ist ein größerer Fund keltischer
Silbermünzen in Simmering (Numism. Ztschrift XXVII 57 f.)
sowie prähistorische Gräber und Tongefäße, die anläßlich
der Limesforschungen zwischen Manswörth und Schwechat
(Limesheft V 13), bei Fischamend (ebenda IV 56) und bei
Arbesthal (ebenda IV 97) gefunden wurden.
15
F. Kenner Römische Funde in Wien aus den Jahren 1904 und I9°S
226
Hauses n. 9, Fronte gegen die obere Bahngasse, kam
eine Grube zum Vorschein, deren Profil jenem
der Grube i in der Steingasse (vgl. oben Sp. 218,
Fig. 366) gleich ist; obenauf lagen mehrere Ziegel-
stücke mit dem Stempel des M. Antonius Tiberia-
nus Vindob. in allen verschiedenen, hinlänglich
bekannten Schreibformen mit und ohne Ligaturen.
Aus dem Gräberschutt, mit dem die Grube an-
gefüllt war, hat man auch das Bruchstück einer
Fig. 374 Fragment einer Gesichtsurne
(Obere Bahngasse)
Gesichtsurne (Fig. 374) aufgelesen. In einer andern
Grube, die beim Kanalbau für die neuen Häuser
im Spätherbst 1905 im Straßengrunde an der Ecke
der Stanislaus- und Gerlgasse zwischen Brand-
gräbern vorgefunden wurde, fand sich 4-8 m tief
in der Füllmasse, mit der sie verschüttet war, ein
Leuchter aus gelbem Ton, teilweise ausgebrochen
(Fig. 375), 9 cm hoch, oben und unten 6-5, in der
Mitte 3 cm im Durchmesser, die Ränder der Hülse
oben für die Kerze 2-5 cm weit und von Rauch
geschwärzt.
Fig. 375 Tonleuchter (Stanislausgasse)
Die Brandgräber, welche die genannte Grube
umgaben, sind ein Zeichen, daß sich das Leichen-
feld noch weiter gegen Gerl- und Hohlweggasse
ausdehnte.
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission ITI 1, 1905
Von Bronze fand sich bisher ein blattförmiges,
flaches, dünnes Bruchstück eines Beschlages.
Zum Schlüsse dieses Abschnittes muß noch
auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht werden,
die nicht unwichtig für das Entstehen der Zivil-
stadt zu sein scheint. Schon bei den ersten Erd-
arbeiten in der verlängerten Steingasse (August 1903)
traf man eine große Anzahl Scherben von am
offenen Feuer gebrannten Tongefäßen1) prä-
historischer Zeit. Im botanischen Garten zeigten
sie sich bei g unter einem römischen Betonboden,
in mehreren Gruben der Stanislausgasse (n. 9 und
11) lagen zu unterst ebenfalls Topfscherben dieser
Art. War nun nach diesen Anzeichen unser Leichen-
feld schon in vorrömischer Zeit zu Bestattungen
benutzt, so muß in seiner Nähe von alters her eine
prähistorische Ansiedlung bestanden haben.
Wenn ganz nahe von dieser späterhin die Zivil-
stadt angelegt wurde, so geschah dies wie ander-
wärts wohl zunächst in der Absicht, die Bewohner
des Keltendorfes zu überwachen, was wieder auf
einen größeren Umfang desselben schließen läßt.
Auch die Vorteile der örtlichen Lage mögen dabei
mitgewirkt haben; die Terrainerhöhung schützte
beide Ansiedlungen vor Überschwemmungen der
Donau, die Entfernung vom Standlager, in dessen
Rücken sie lagen, war nicht zu groß, um bei
Feindesgefahr militärischen Schutz unmöglich zu
machen, aber hinreichend für die notwendige
Scheidung des Standlagers und seiner Umgebung
von der bürgerlichen Stadt. Endlich lag die keltische
Niederlassung an einem sehr alten Verkehrswege,2)
der sie mit den Nachbarorten und mit dem großen
Stapelplatz Carnuntum verband. Es scheint, daß
sich durch jene Funde ein neuer Ausblick in die
vorrömische Geschichte von Wien eröffnet.
(Erzherzogin Maria Josepha-Park zwi-
schen Gürtelstraße und k. k. Arsenal.) Bei
den Erdarbeiten für die Herstellung eines Garten-
weges zwischen Heu- und Jacquingasse trafen die
Arbeiter im J. 1905, 1 m tief in der Erde (nicht
1) Jahrbuch II 64.
2) Bezeichnend dafür ist ein größerer Fund keltischer
Silbermünzen in Simmering (Numism. Ztschrift XXVII 57 f.)
sowie prähistorische Gräber und Tongefäße, die anläßlich
der Limesforschungen zwischen Manswörth und Schwechat
(Limesheft V 13), bei Fischamend (ebenda IV 56) und bei
Arbesthal (ebenda IV 97) gefunden wurden.
15