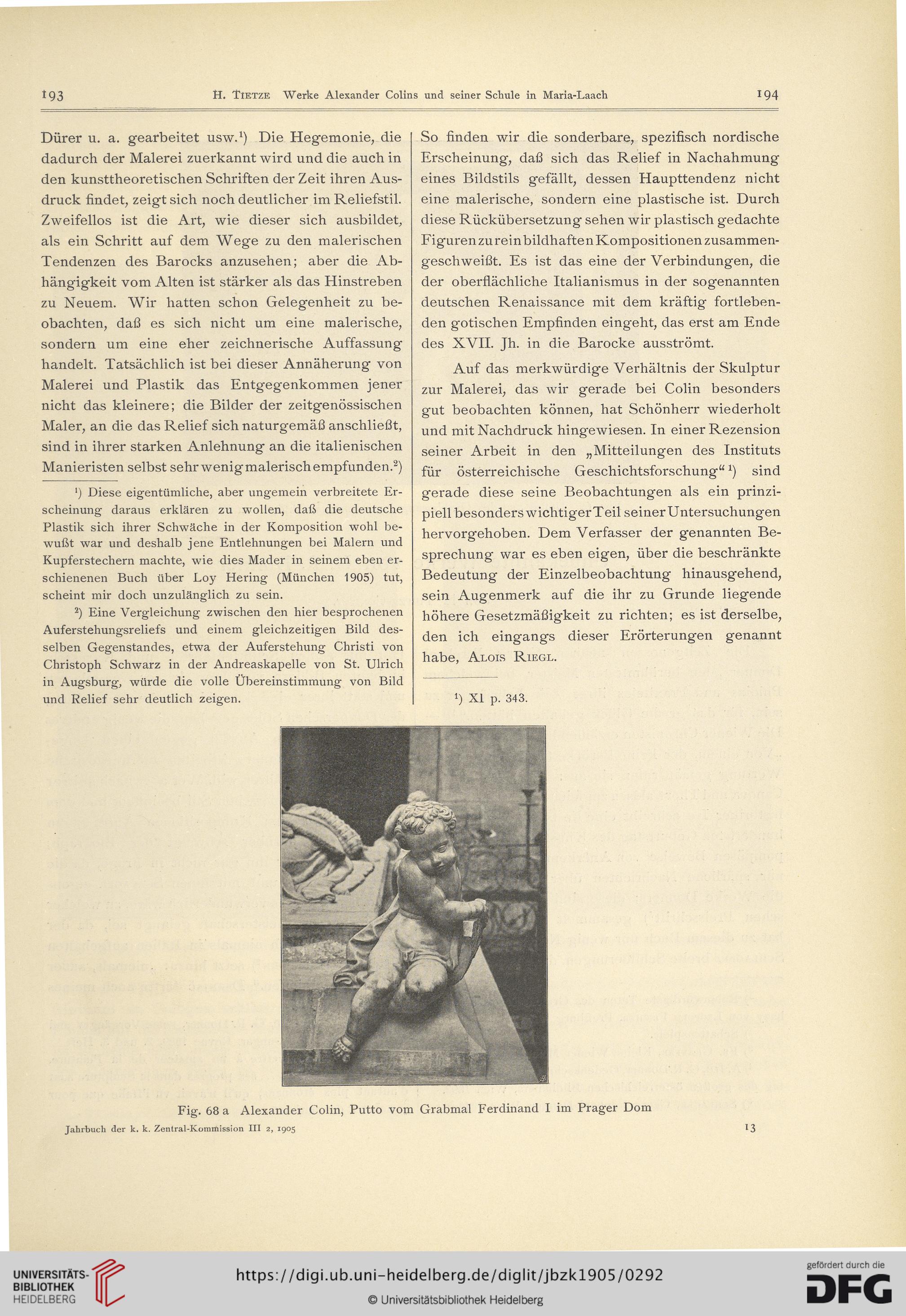i93
Ö. Tietze Werke Alexander Colins und seiner Schule in Maria-Laach
194
Dürer u. a. gearbeitet usw.1) Die Hegemonie, die
dadurch der Malerei zuerkannt wird und die auch in
den kunsttheoretischen Schriften der Zeit ihren Aus-
druck findet, zeigt sich noch deutlicher im Reliefstil.
Zweifellos ist die Art, wie dieser sich ausbildet,
als ein Schritt auf dem Wege zu den malerischen
Tendenzen des Barocks anzusehen; aber die Ab-
hängigkeit vom Alten ist stärker als das Hinstreben
zu Neuem. Wir hatten schon Gelegenheit zu be-
obachten, daß es sich nicht um eine malerische,
sondern um eine eher zeichnerische Auffassung
handelt. Tatsächlich ist bei dieser Annäherung von
Malerei und Plastik das Entgegenkommen jener
nicht das kleinere; die Bilder der zeitgenössischen
Maler, an die das Relief sich naturgemäß anschließt,
sind in ihrer starken Anlehnung an die italienischen
Manieristen selbst sehr wenig malerisch empfunden.2)
*) Diese eigentümliche, aber ungemein verbreitete Er-
scheinung daraus erklären zu wollen, daß die deutsche
Plastik sich ihrer Schwäche in der Komposition wohl be-
wußt war und deshalb jene Entlehnungen bei Malern und
Kupferstechern machte, wie dies Mader in seinem eben er-
schienenen Buch über Loy Hering (München 1905) tut,
scheint mir doch unzulänglich zu sein.
2) Eine Vergleichung zwischen den hier besprochenen
Auferstehungsreliefs und einem gleichzeitigen Bild des-
selben Gegenstandes, etwa der Auferstehung Christi von
Christoph Schwarz in der Andreaskapelle von St. Ulrich
in Augsburg, würde die volle Übereinstimmung von Bild
und Relief sehr deutlich zeigen.
So finden wir die sonderbare, spezifisch nordische
Erscheinung, daß sich das Relief in Nachahmung
eines Bildstils gefällt, dessen Haupttendenz nicht
eine malerische, sondern eine plastische ist. Durch
diese Rückübersetzung sehen wir plastisch gedachte
Figuren zu rein bildhaften Kompositionen zusammen-
geschweißt. Es ist das eine der Verbindungen, die
der oberflächliche Italianismus in der sogenannten
deutschen Renaissance mit dem kräftig fortleben-
den gotischen Empfinden eingeht, das erst am Ende
des XVII. Jh. in die Barocke ausströmt.
Auf das merkwürdige Verhältnis der Skulptur
zur Malerei, das wir gerade bei Colin besonders
gut beobachten können, hat Schönherr wiederholt
und mit Nachdruck hingewiesen. In einer Rezension
seiner Arbeit in den „Mitteilungen des Instituts
für österreichische Geschichtsforschung“b sind
gerade diese seine Beobachtungen als ein prinzi-
piell besonders wichtiger Teil seinerUntersuchungen
hervorgehoben. Dem Verfasser der genannten Be-
sprechung war es eben eigen, über die beschränkte
Bedeutung der Einzelbeobachtung hinausgehend,
sein Augenmerk auf die ihr zu Grunde liegende
höhere Gesetzmäßigkeit zu richten; es ist derselbe,
den ich eingangs dieser Erörterungen genannt
habe, Alois Riegl.
b XI p. 343.
Fig. 68 a Alexander Colin, Putto vom Grabmal Ferdinand I im Prager Dom
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission III 2, 1905
Ö. Tietze Werke Alexander Colins und seiner Schule in Maria-Laach
194
Dürer u. a. gearbeitet usw.1) Die Hegemonie, die
dadurch der Malerei zuerkannt wird und die auch in
den kunsttheoretischen Schriften der Zeit ihren Aus-
druck findet, zeigt sich noch deutlicher im Reliefstil.
Zweifellos ist die Art, wie dieser sich ausbildet,
als ein Schritt auf dem Wege zu den malerischen
Tendenzen des Barocks anzusehen; aber die Ab-
hängigkeit vom Alten ist stärker als das Hinstreben
zu Neuem. Wir hatten schon Gelegenheit zu be-
obachten, daß es sich nicht um eine malerische,
sondern um eine eher zeichnerische Auffassung
handelt. Tatsächlich ist bei dieser Annäherung von
Malerei und Plastik das Entgegenkommen jener
nicht das kleinere; die Bilder der zeitgenössischen
Maler, an die das Relief sich naturgemäß anschließt,
sind in ihrer starken Anlehnung an die italienischen
Manieristen selbst sehr wenig malerisch empfunden.2)
*) Diese eigentümliche, aber ungemein verbreitete Er-
scheinung daraus erklären zu wollen, daß die deutsche
Plastik sich ihrer Schwäche in der Komposition wohl be-
wußt war und deshalb jene Entlehnungen bei Malern und
Kupferstechern machte, wie dies Mader in seinem eben er-
schienenen Buch über Loy Hering (München 1905) tut,
scheint mir doch unzulänglich zu sein.
2) Eine Vergleichung zwischen den hier besprochenen
Auferstehungsreliefs und einem gleichzeitigen Bild des-
selben Gegenstandes, etwa der Auferstehung Christi von
Christoph Schwarz in der Andreaskapelle von St. Ulrich
in Augsburg, würde die volle Übereinstimmung von Bild
und Relief sehr deutlich zeigen.
So finden wir die sonderbare, spezifisch nordische
Erscheinung, daß sich das Relief in Nachahmung
eines Bildstils gefällt, dessen Haupttendenz nicht
eine malerische, sondern eine plastische ist. Durch
diese Rückübersetzung sehen wir plastisch gedachte
Figuren zu rein bildhaften Kompositionen zusammen-
geschweißt. Es ist das eine der Verbindungen, die
der oberflächliche Italianismus in der sogenannten
deutschen Renaissance mit dem kräftig fortleben-
den gotischen Empfinden eingeht, das erst am Ende
des XVII. Jh. in die Barocke ausströmt.
Auf das merkwürdige Verhältnis der Skulptur
zur Malerei, das wir gerade bei Colin besonders
gut beobachten können, hat Schönherr wiederholt
und mit Nachdruck hingewiesen. In einer Rezension
seiner Arbeit in den „Mitteilungen des Instituts
für österreichische Geschichtsforschung“b sind
gerade diese seine Beobachtungen als ein prinzi-
piell besonders wichtiger Teil seinerUntersuchungen
hervorgehoben. Dem Verfasser der genannten Be-
sprechung war es eben eigen, über die beschränkte
Bedeutung der Einzelbeobachtung hinausgehend,
sein Augenmerk auf die ihr zu Grunde liegende
höhere Gesetzmäßigkeit zu richten; es ist derselbe,
den ich eingangs dieser Erörterungen genannt
habe, Alois Riegl.
b XI p. 343.
Fig. 68 a Alexander Colin, Putto vom Grabmal Ferdinand I im Prager Dom
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission III 2, 1905