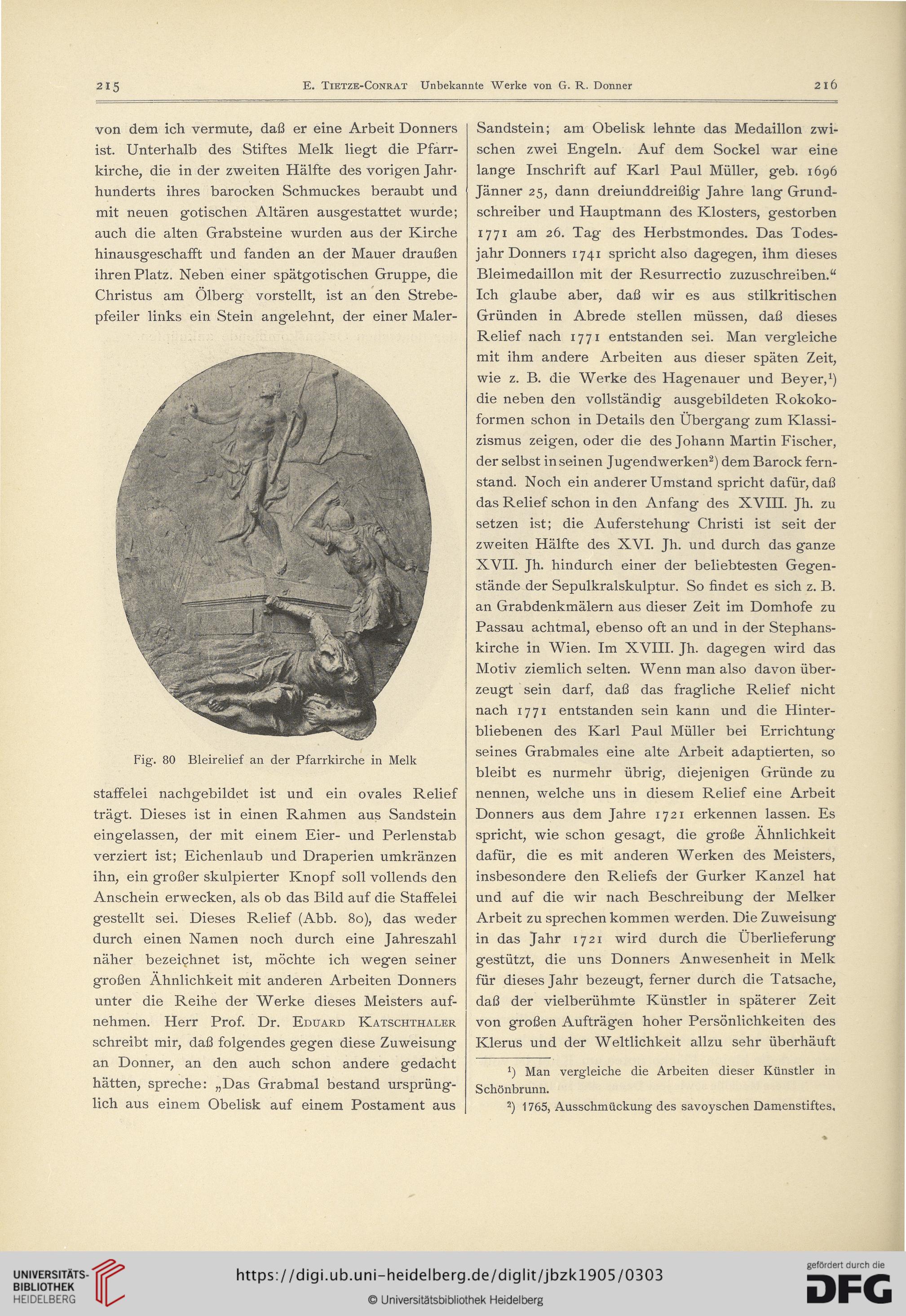215
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
2IÖ
von dem ich vermute, daß er eine Arbeit Donners
ist. Unterhalb des Stiftes Melk liegt die Pfarr-
kirche, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts ihres barocken Schmuckes beraubt und
mit neuen gotischen Altären ausgestattet wurde;
auch die alten Grabsteine wurden aus der Kirche
hinausgeschafft und fanden an der Mauer draußen
ihren Platz. Neben einer spätgotischen Gruppe, die
Christus am Ölberg vorstellt, ist an den Strebe-
pfeiler links ein Stein angelehnt, der einer Maler-
Fig. 80 Bleirelief an der Pfarrkirche in Melk
Staffelei nachgebildet ist und ein ovales Relief
trägt. Dieses ist in einen Rahmen aus Sandstein
eingelassen, der mit einem Eier- und Perlenstab
verziert ist; Eichenlaub und Draperien umkränzen
ihn, ein großer skulpierter Knopf soll vollends den
Anschein erwecken, als ob das Bild auf die Staffelei
gestellt sei. Dieses Relief (Abb. 80), das weder
durch einen Namen noch durch eine Jahreszahl
näher bezeichnet ist, möchte ich wegen seiner
großen Ähnlichkeit mit anderen Arbeiten Donners
unter die Reihe der Werke dieses Meisters auf-
nehmen. Herr Prof. Dr. Eduard Katschthaler
schreibt mir, daß folgendes gegen diese Zuweisung
an Donner, an den auch schon andere gedacht
hätten, spreche: „Das Grabmal bestand ursprüng-
lich aus einem Obelisk auf einem Postament aus
Sandstein; am Obelisk lehnte das Medaillon zwi-
schen zwei Engeln. Auf dem Sockel war eine
lange Inschrift auf Karl Paul Müller, geb. 1696
Jänner 25, dann dreiunddreißig Jahre lang Grund-
schreiber und Hauptmann des Klosters, gestorben
1771 am 26. Tag des Herbstmondes. Das Todes-
jahr Donners 1741 spricht also dagegen, ihm dieses
Bleimedaillon mit der Resurrectio zuzuschreiben.“
Ich glaube aber, daß wir es aus stilkritischen
Gründen in Abrede stellen müssen, daß dieses
Relief nach 1771 entstanden sei. Man vergleiche
mit ihm andere Arbeiten aus dieser späten Zeit,
wie z. B. die Werke des Hagenauer und Beyer,1)
die neben den vollständig ausgebildeten Rokoko-
formen schon in Details den Übergang zum Klassi-
zismus zeigen, oder die des Johann Martin Fischer,
der selbst in seinen Jugendwerken2) dem Barock fern-
stand. Noch ein anderer Umstand spricht dafür, daß
das Relief schon in den Anfang des XVIII. Jh. zu
setzen ist; die Auferstehung Christi ist seit der
zweiten Hälfte des XVI. Jh. und durch das ganze
XVII. Jh. hindurch einer der beliebtesten Gegen-
stände der Sepulkralskulptur. So findet es sich z. B.
an Grabdenkmälern aus dieser Zeit im Domhofe zu
Passau achtmal, ebenso oft an und in der Stephans-
kirche in Wien. Im XVIII. Jh. dagegen wird das
Motiv ziemlich selten. Wenn man also davon über-
zeugt sein darf, daß das fragliche Relief nicht
nach 1771 entstanden sein kann und die Hinter-
bliebenen des Karl Paul Müller bei Errichtung
seines Grabmales eine alte Arbeit adaptierten, so
bleibt es nurmehr übrig, diejenigen Gründe zu
nennen, welche uns in diesem Relief eine Arbeit
Donners aus dem Jahre 1721 erkennen lassen. Es
spricht, wie schon gesagt, die große Ähnlichkeit
dafür, die es mit anderen Werken des Meisters,
insbesondere den Reliefs der Gurker Kanzel hat
und auf die wir nach Beschreibung der Melker
Arbeit zu sprechen kommen werden. Die Zuweisung
in das Jahr 1721 wird durch die Überlieferung
gestützt, die uns Donners Anwesenheit in Melk
für dieses Jahr bezeugt, ferner durch die Tatsache,
daß der vielberühmte Künstler in späterer Zeit
von großen Aufträgen hoher Persönlichkeiten des
Klerus und der Weltlichkeit allzu sehr überhäuft
b Man vergleiche die Arbeiten dieser Künstler in
Schönbrunn.
2) 1765, Ausschmückung des savoyschen Damenstiftes.
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
2IÖ
von dem ich vermute, daß er eine Arbeit Donners
ist. Unterhalb des Stiftes Melk liegt die Pfarr-
kirche, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts ihres barocken Schmuckes beraubt und
mit neuen gotischen Altären ausgestattet wurde;
auch die alten Grabsteine wurden aus der Kirche
hinausgeschafft und fanden an der Mauer draußen
ihren Platz. Neben einer spätgotischen Gruppe, die
Christus am Ölberg vorstellt, ist an den Strebe-
pfeiler links ein Stein angelehnt, der einer Maler-
Fig. 80 Bleirelief an der Pfarrkirche in Melk
Staffelei nachgebildet ist und ein ovales Relief
trägt. Dieses ist in einen Rahmen aus Sandstein
eingelassen, der mit einem Eier- und Perlenstab
verziert ist; Eichenlaub und Draperien umkränzen
ihn, ein großer skulpierter Knopf soll vollends den
Anschein erwecken, als ob das Bild auf die Staffelei
gestellt sei. Dieses Relief (Abb. 80), das weder
durch einen Namen noch durch eine Jahreszahl
näher bezeichnet ist, möchte ich wegen seiner
großen Ähnlichkeit mit anderen Arbeiten Donners
unter die Reihe der Werke dieses Meisters auf-
nehmen. Herr Prof. Dr. Eduard Katschthaler
schreibt mir, daß folgendes gegen diese Zuweisung
an Donner, an den auch schon andere gedacht
hätten, spreche: „Das Grabmal bestand ursprüng-
lich aus einem Obelisk auf einem Postament aus
Sandstein; am Obelisk lehnte das Medaillon zwi-
schen zwei Engeln. Auf dem Sockel war eine
lange Inschrift auf Karl Paul Müller, geb. 1696
Jänner 25, dann dreiunddreißig Jahre lang Grund-
schreiber und Hauptmann des Klosters, gestorben
1771 am 26. Tag des Herbstmondes. Das Todes-
jahr Donners 1741 spricht also dagegen, ihm dieses
Bleimedaillon mit der Resurrectio zuzuschreiben.“
Ich glaube aber, daß wir es aus stilkritischen
Gründen in Abrede stellen müssen, daß dieses
Relief nach 1771 entstanden sei. Man vergleiche
mit ihm andere Arbeiten aus dieser späten Zeit,
wie z. B. die Werke des Hagenauer und Beyer,1)
die neben den vollständig ausgebildeten Rokoko-
formen schon in Details den Übergang zum Klassi-
zismus zeigen, oder die des Johann Martin Fischer,
der selbst in seinen Jugendwerken2) dem Barock fern-
stand. Noch ein anderer Umstand spricht dafür, daß
das Relief schon in den Anfang des XVIII. Jh. zu
setzen ist; die Auferstehung Christi ist seit der
zweiten Hälfte des XVI. Jh. und durch das ganze
XVII. Jh. hindurch einer der beliebtesten Gegen-
stände der Sepulkralskulptur. So findet es sich z. B.
an Grabdenkmälern aus dieser Zeit im Domhofe zu
Passau achtmal, ebenso oft an und in der Stephans-
kirche in Wien. Im XVIII. Jh. dagegen wird das
Motiv ziemlich selten. Wenn man also davon über-
zeugt sein darf, daß das fragliche Relief nicht
nach 1771 entstanden sein kann und die Hinter-
bliebenen des Karl Paul Müller bei Errichtung
seines Grabmales eine alte Arbeit adaptierten, so
bleibt es nurmehr übrig, diejenigen Gründe zu
nennen, welche uns in diesem Relief eine Arbeit
Donners aus dem Jahre 1721 erkennen lassen. Es
spricht, wie schon gesagt, die große Ähnlichkeit
dafür, die es mit anderen Werken des Meisters,
insbesondere den Reliefs der Gurker Kanzel hat
und auf die wir nach Beschreibung der Melker
Arbeit zu sprechen kommen werden. Die Zuweisung
in das Jahr 1721 wird durch die Überlieferung
gestützt, die uns Donners Anwesenheit in Melk
für dieses Jahr bezeugt, ferner durch die Tatsache,
daß der vielberühmte Künstler in späterer Zeit
von großen Aufträgen hoher Persönlichkeiten des
Klerus und der Weltlichkeit allzu sehr überhäuft
b Man vergleiche die Arbeiten dieser Künstler in
Schönbrunn.
2) 1765, Ausschmückung des savoyschen Damenstiftes.