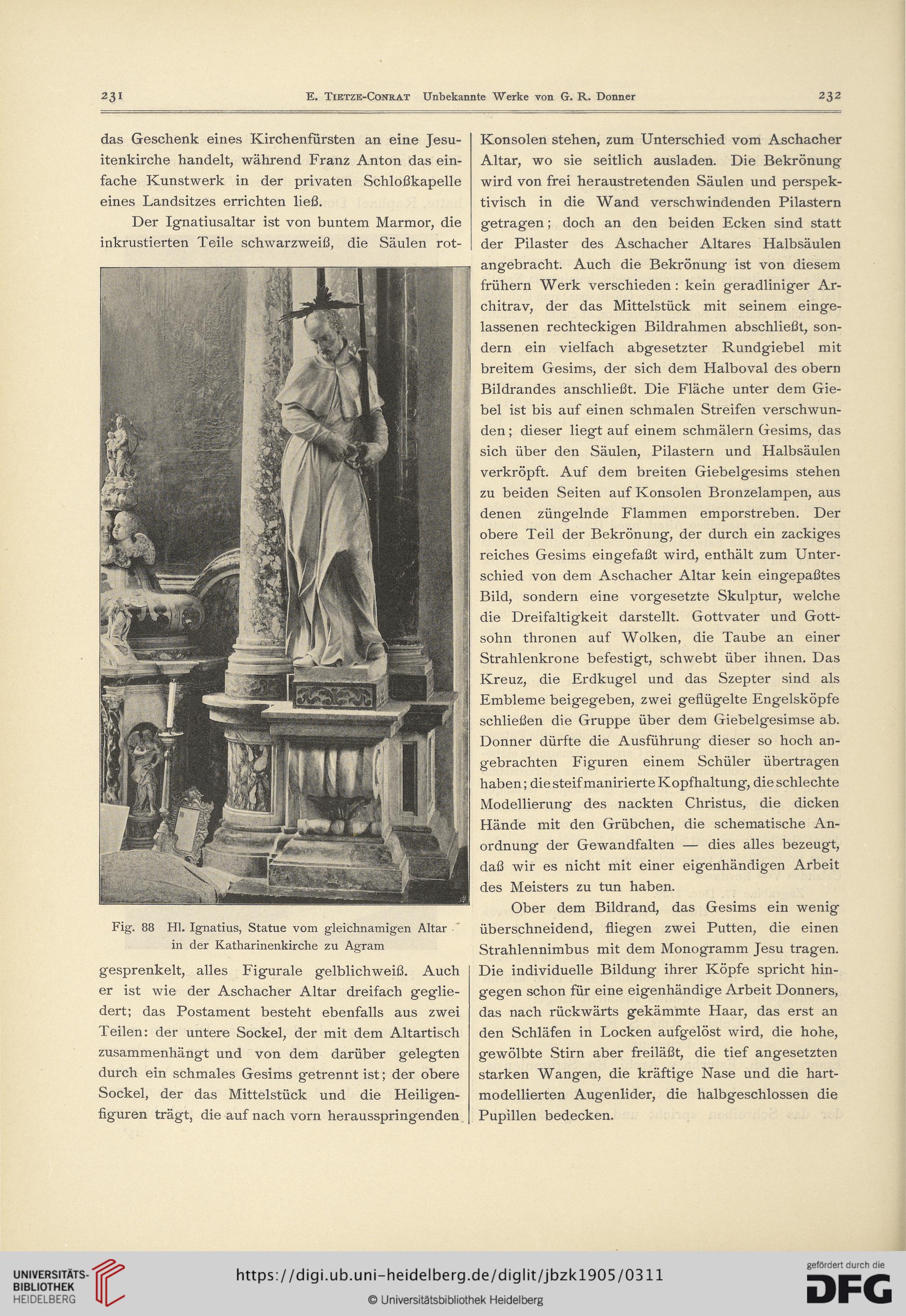231
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
232
das Geschenk eines Kirchenfürsten an eine Jesu-
itenkirche handelt, während Franz Anton das ein-
fache Kunstwerk in der privaten Schloßkapelle
eines Landsitzes errichten ließ.
Der Ignatiusaltar ist von buntem Marmor, die
inkrustierten Teile schwarzweiß, die Säulen rot-
Konsolen stehen, zum Unterschied vom Aschacher
Altar, wo sie seitlich ausladen. Die Bekrönung
wird von frei heraustretenden Säulen und perspek-
tivisch in die Wand verschwindenden Pilastern
getragen; doch an den beiden Ecken sind statt
der Pilaster des Aschacher Altares Halbsäulen
Fig. 88 Hl. Ignatius, Statue vom gleichnamigen Altar
in der Katharinenkirche zu Agram
gesprenkelt, alles Figurale gelblichweiß. Auch
er ist wie der Aschacher Altar dreifach geglie-
dert; das Postament besteht ebenfalls aus zwei
Teilen: der untere Sockel, der mit dem Altartisch
zusammenhängt und von dem darüber gelegten
durch ein schmales Gesims getrennt ist; der obere
Sockel, der das Mittelstück und die Heiligen-
figuren trägt, die auf nach vorn herausspringenden
angebracht. Auch die Bekrönung ist von diesem
frühem Werk verschieden: kein geradliniger Ar-
chitrav, der das Mittelstück mit seinem einge-
lassenen rechteckigen Bildrahmen abschließt, son-
dern ein vielfach abgesetzter Rundgiebel mit
breitem Gesims, der sich dem Halboval des obern
Bildrandes anschließt. Die Fläche unter dem Gie-
bel ist bis auf einen schmalen Streifen verschwun-
den ; dieser liegt auf einem schmälern Gesims, das
sich über den Säulen, Pilastern und Halbsäulen
verkröpft. Auf dem breiten Giebelgesims stehen
zu beiden Seiten auf Konsolen Bronzelampen, aus
denen züngelnde Flammen emporstreben. Der
obere Teil der Bekrönung, der durch ein zackiges
reiches Gesims eingefaßt wird, enthält zum Unter-
schied von dem Aschacher Altar kein eingepaßtes
Bild, sondern eine vorgesetzte Skulptur, welche
die Dreifaltigkeit darstellt. Gottvater und Gott-
sohn thronen auf Wolken, die Taube an einer
Strahlenkrone befestigt, schwebt über ihnen. Das
Kreuz, die Erdkugel und das Szepter sind als
Embleme beigegeben, zwei geflügelte Engelsköpfe
schließen die Gruppe über dem Giebelgesimse ab.
Donner dürfte die Ausführung dieser so hoch an-
gebrachten Figuren einem Schüler übertragen
haben; die steif manirierte Kopfhaltung, die schlechte
Modellierung des nackten Christus, die dicken
Hände mit den Grübchen, die schematische An-
ordnung der Gewandfalten — dies alles bezeugt,
daß wir es nicht mit einer eigenhändigen Arbeit
des Meisters zu tun haben.
Ober dem Bildrand, das Gesims ein wenig
überschneidend, fliegen zwei Putten, die einen
Strahlennimbus mit dem Monogramm Jesu tragen.
Die individuelle Bildung ihrer Köpfe spricht hin-
gegen schon für eine eigenhändige Arbeit Donners,
das nach rückwärts gekämmte Haar, das erst an
den Schläfen in Locken aufgelöst wird, die hohe,
gewölbte Stirn aber freiläßt, die tief angesetzten
starken Wangen, die kräftige Nase und die hart-
modellierten Augenlider, die halbgeschlossen die
Pupillen bedecken.
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
232
das Geschenk eines Kirchenfürsten an eine Jesu-
itenkirche handelt, während Franz Anton das ein-
fache Kunstwerk in der privaten Schloßkapelle
eines Landsitzes errichten ließ.
Der Ignatiusaltar ist von buntem Marmor, die
inkrustierten Teile schwarzweiß, die Säulen rot-
Konsolen stehen, zum Unterschied vom Aschacher
Altar, wo sie seitlich ausladen. Die Bekrönung
wird von frei heraustretenden Säulen und perspek-
tivisch in die Wand verschwindenden Pilastern
getragen; doch an den beiden Ecken sind statt
der Pilaster des Aschacher Altares Halbsäulen
Fig. 88 Hl. Ignatius, Statue vom gleichnamigen Altar
in der Katharinenkirche zu Agram
gesprenkelt, alles Figurale gelblichweiß. Auch
er ist wie der Aschacher Altar dreifach geglie-
dert; das Postament besteht ebenfalls aus zwei
Teilen: der untere Sockel, der mit dem Altartisch
zusammenhängt und von dem darüber gelegten
durch ein schmales Gesims getrennt ist; der obere
Sockel, der das Mittelstück und die Heiligen-
figuren trägt, die auf nach vorn herausspringenden
angebracht. Auch die Bekrönung ist von diesem
frühem Werk verschieden: kein geradliniger Ar-
chitrav, der das Mittelstück mit seinem einge-
lassenen rechteckigen Bildrahmen abschließt, son-
dern ein vielfach abgesetzter Rundgiebel mit
breitem Gesims, der sich dem Halboval des obern
Bildrandes anschließt. Die Fläche unter dem Gie-
bel ist bis auf einen schmalen Streifen verschwun-
den ; dieser liegt auf einem schmälern Gesims, das
sich über den Säulen, Pilastern und Halbsäulen
verkröpft. Auf dem breiten Giebelgesims stehen
zu beiden Seiten auf Konsolen Bronzelampen, aus
denen züngelnde Flammen emporstreben. Der
obere Teil der Bekrönung, der durch ein zackiges
reiches Gesims eingefaßt wird, enthält zum Unter-
schied von dem Aschacher Altar kein eingepaßtes
Bild, sondern eine vorgesetzte Skulptur, welche
die Dreifaltigkeit darstellt. Gottvater und Gott-
sohn thronen auf Wolken, die Taube an einer
Strahlenkrone befestigt, schwebt über ihnen. Das
Kreuz, die Erdkugel und das Szepter sind als
Embleme beigegeben, zwei geflügelte Engelsköpfe
schließen die Gruppe über dem Giebelgesimse ab.
Donner dürfte die Ausführung dieser so hoch an-
gebrachten Figuren einem Schüler übertragen
haben; die steif manirierte Kopfhaltung, die schlechte
Modellierung des nackten Christus, die dicken
Hände mit den Grübchen, die schematische An-
ordnung der Gewandfalten — dies alles bezeugt,
daß wir es nicht mit einer eigenhändigen Arbeit
des Meisters zu tun haben.
Ober dem Bildrand, das Gesims ein wenig
überschneidend, fliegen zwei Putten, die einen
Strahlennimbus mit dem Monogramm Jesu tragen.
Die individuelle Bildung ihrer Köpfe spricht hin-
gegen schon für eine eigenhändige Arbeit Donners,
das nach rückwärts gekämmte Haar, das erst an
den Schläfen in Locken aufgelöst wird, die hohe,
gewölbte Stirn aber freiläßt, die tief angesetzten
starken Wangen, die kräftige Nase und die hart-
modellierten Augenlider, die halbgeschlossen die
Pupillen bedecken.