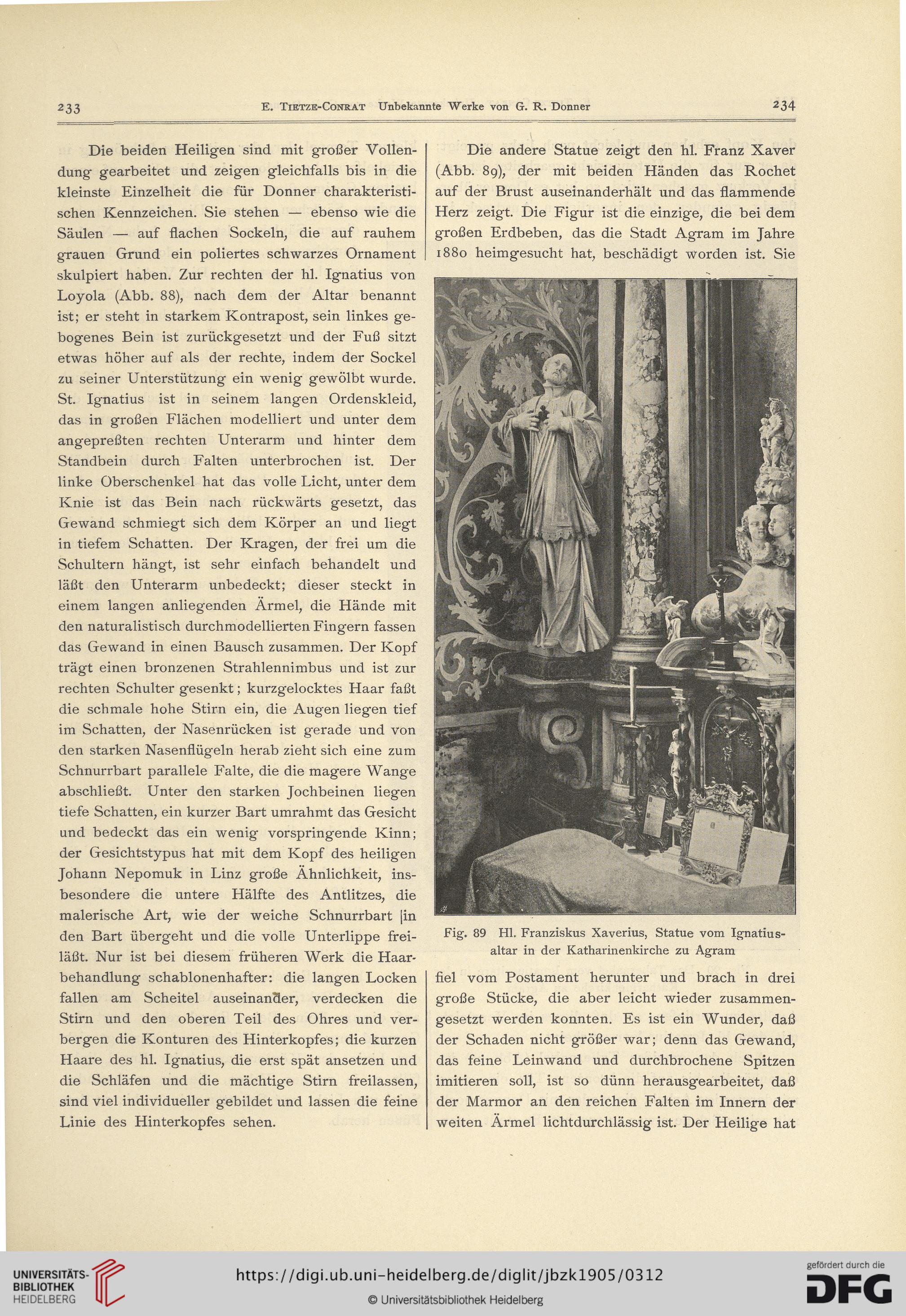233
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
234
Die beiden Heiligen sind mit großer Vollen-
dung gearbeitet und zeigen gleichfalls bis in die
kleinste Einzelheit die für Donner charakteristi-
schen Kennzeichen. Sie stehen — ebenso wie die
Säulen — auf flachen Sockeln, die auf rauhem
grauen Grund ein poliertes schwarzes Ornament
skulpiert haben. Zur rechten der hl. Ignatius von
Loyola (Abb. 88), nach dem der Altar benannt
ist; er steht in starkem Kontrapost, sein linkes ge-
bogenes Bein ist zurückgesetzt und der Fuß sitzt
etwas höher auf als der rechte, indem der Sockel
zu seiner Unterstützung ein wenig gewölbt wurde.
St. Ignatius ist in seinem langen Ordenskleid,
das in großen Flächen modelliert und unter dem
angepreßten rechten Unterarm und hinter dem
Standbein durch Falten unterbrochen ist. Der
linke Oberschenkel hat das volle Licht, unter dem
Knie ist das Bein nach rückwärts gesetzt, das
Gewand schmiegt sich dem Körper an und liegt
in tiefem Schatten. Der Kragen, der frei um die
Schultern hängt, ist sehr einfach behandelt und
läßt den Unterarm unbedeckt; dieser steckt in
einem langen anliegenden Ärmel, die Hände mit
den naturalistisch durchmodellierten Fingern fassen
das Gewand in einen Bausch zusammen. Der Kopf
trägt einen bronzenen Strahlennimbus und ist zur
rechten Schulter gesenkt; kurzgelocktes Haar faßt
die schmale hohe Stirn ein, die Augen liegen tief
im Schatten, der Nasenrücken ist gerade und von
den starken Nasenflügeln herab zieht sich eine zum
Schnurrbart parallele Falte, die die magere Wange
abschließt. Unter den starken Jochbeinen liegen
tiefe Schatten, ein kurzer Bart umrahmt das Gesicht
und bedeckt das ein wenig vorspringende Kinn;
der Gesichtstypus hat mit dem Kopf des heiligen
Johann Nepomuk in Linz große Ähnlichkeit, ins-
besondere die untere Hälfte des Antlitzes, die
malerische Art, wie der weiche Schnurrbart [in
den Bart übergeht und die volle Unterlippe frei-
läßt. Nur ist bei diesem früheren Werk die Haar-
behandlung schablonenhafter: die langen Locken
fallen am Scheitel auseinander, verdecken die
Stirn und den oberen Teil des Ohres und ver-
bergen die Konturen des Hinterkopfes; die kurzen
Haare des hl. Ignatius, die erst spät ansetzen und
die Schläfen und die mächtige Stirn freilassen,
sind viel individueller gebildet und lassen die feine
Linie des Hinterkopfes sehen.
Die andere Statue zeigt den hl. Franz Xaver
(Abb. 89), der mit beiden Händen das Röchet
auf der Brust auseinanderhält und das flammende
Herz zeigt. Die Figur ist die einzige, die bei dem
großen Erdbeben, das die Stadt Agram im Jahre
1880 heimgesucht hat, beschädigt worden ist. Sie
Fig. 89 Hl. Franziskus Xaverius, Statue vom Ignatius-
altar in der Katharinenkirche zu Agram
fiel vom Postament herunter und brach in drei
große Stücke, die aber leicht wieder zusammen-
gesetzt werden konnten. Es ist ein Wunder, daß
der Schaden nicht größer war; denn das Gewand,
das feine Leinwand und durchbrochene Spitzen
imitieren soll, ist so dünn herausgearbeitet, daß
der Marmor an den reichen Falten im Innern der
weiten Ärmel lichtdurchlässig ist. Der Heilige hat
E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner
234
Die beiden Heiligen sind mit großer Vollen-
dung gearbeitet und zeigen gleichfalls bis in die
kleinste Einzelheit die für Donner charakteristi-
schen Kennzeichen. Sie stehen — ebenso wie die
Säulen — auf flachen Sockeln, die auf rauhem
grauen Grund ein poliertes schwarzes Ornament
skulpiert haben. Zur rechten der hl. Ignatius von
Loyola (Abb. 88), nach dem der Altar benannt
ist; er steht in starkem Kontrapost, sein linkes ge-
bogenes Bein ist zurückgesetzt und der Fuß sitzt
etwas höher auf als der rechte, indem der Sockel
zu seiner Unterstützung ein wenig gewölbt wurde.
St. Ignatius ist in seinem langen Ordenskleid,
das in großen Flächen modelliert und unter dem
angepreßten rechten Unterarm und hinter dem
Standbein durch Falten unterbrochen ist. Der
linke Oberschenkel hat das volle Licht, unter dem
Knie ist das Bein nach rückwärts gesetzt, das
Gewand schmiegt sich dem Körper an und liegt
in tiefem Schatten. Der Kragen, der frei um die
Schultern hängt, ist sehr einfach behandelt und
läßt den Unterarm unbedeckt; dieser steckt in
einem langen anliegenden Ärmel, die Hände mit
den naturalistisch durchmodellierten Fingern fassen
das Gewand in einen Bausch zusammen. Der Kopf
trägt einen bronzenen Strahlennimbus und ist zur
rechten Schulter gesenkt; kurzgelocktes Haar faßt
die schmale hohe Stirn ein, die Augen liegen tief
im Schatten, der Nasenrücken ist gerade und von
den starken Nasenflügeln herab zieht sich eine zum
Schnurrbart parallele Falte, die die magere Wange
abschließt. Unter den starken Jochbeinen liegen
tiefe Schatten, ein kurzer Bart umrahmt das Gesicht
und bedeckt das ein wenig vorspringende Kinn;
der Gesichtstypus hat mit dem Kopf des heiligen
Johann Nepomuk in Linz große Ähnlichkeit, ins-
besondere die untere Hälfte des Antlitzes, die
malerische Art, wie der weiche Schnurrbart [in
den Bart übergeht und die volle Unterlippe frei-
läßt. Nur ist bei diesem früheren Werk die Haar-
behandlung schablonenhafter: die langen Locken
fallen am Scheitel auseinander, verdecken die
Stirn und den oberen Teil des Ohres und ver-
bergen die Konturen des Hinterkopfes; die kurzen
Haare des hl. Ignatius, die erst spät ansetzen und
die Schläfen und die mächtige Stirn freilassen,
sind viel individueller gebildet und lassen die feine
Linie des Hinterkopfes sehen.
Die andere Statue zeigt den hl. Franz Xaver
(Abb. 89), der mit beiden Händen das Röchet
auf der Brust auseinanderhält und das flammende
Herz zeigt. Die Figur ist die einzige, die bei dem
großen Erdbeben, das die Stadt Agram im Jahre
1880 heimgesucht hat, beschädigt worden ist. Sie
Fig. 89 Hl. Franziskus Xaverius, Statue vom Ignatius-
altar in der Katharinenkirche zu Agram
fiel vom Postament herunter und brach in drei
große Stücke, die aber leicht wieder zusammen-
gesetzt werden konnten. Es ist ein Wunder, daß
der Schaden nicht größer war; denn das Gewand,
das feine Leinwand und durchbrochene Spitzen
imitieren soll, ist so dünn herausgearbeitet, daß
der Marmor an den reichen Falten im Innern der
weiten Ärmel lichtdurchlässig ist. Der Heilige hat