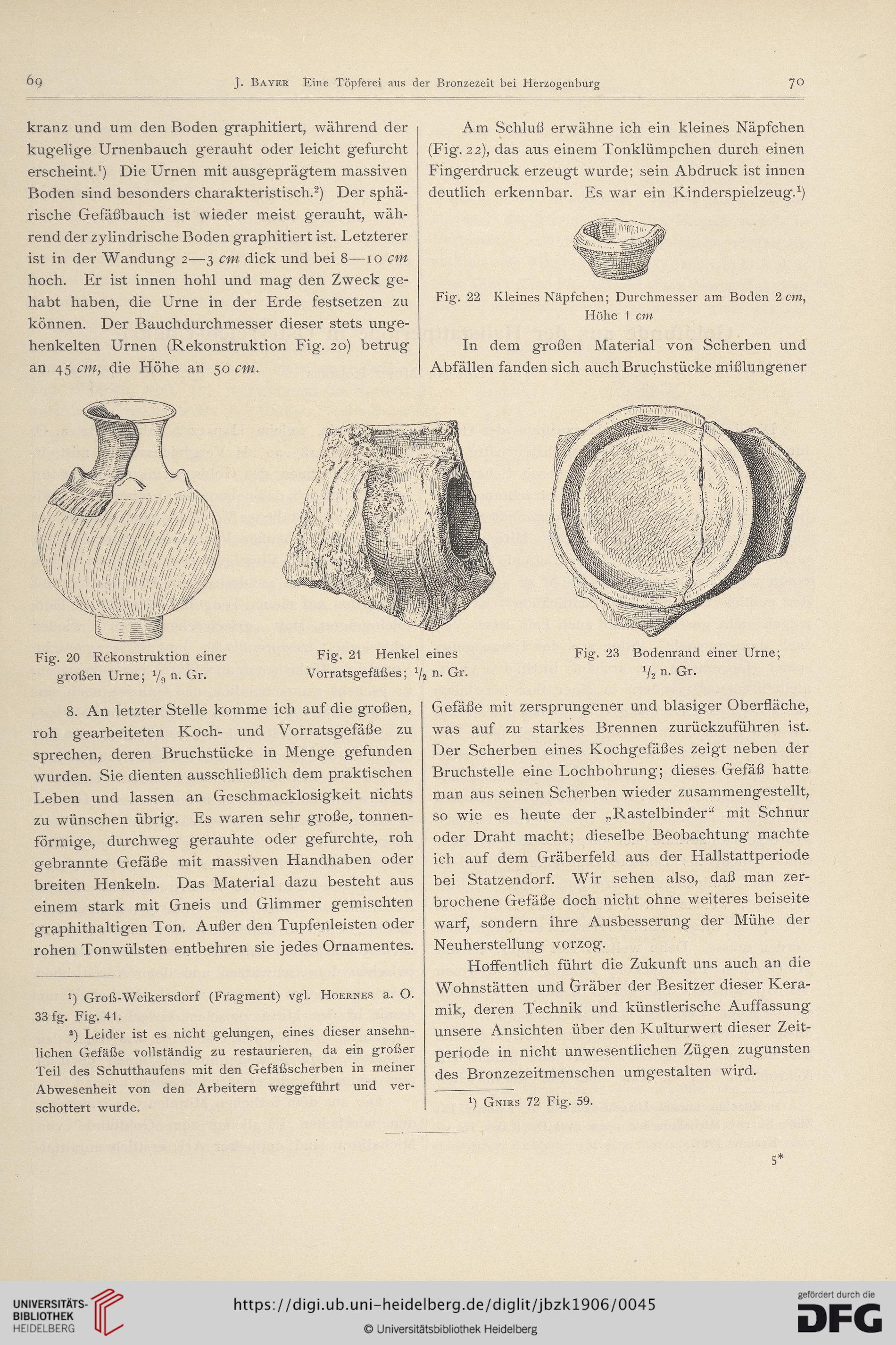J. Bayer
Eine Töpferei aus der Bronzezeit bei Herzogenburg
70
kranz und um den Boden graphitiert, während der
kugelige Urnenbauch gerauht oder leicht gefurcht
erscheint1) Die Urnen mit ausgeprägtem massiven
Boden sind besonders charakteristisch.* 2) Der sphä-
rische Gefäßbauch ist wieder meist gerauht, wäh-
rend der zylindrische Boden graphitiert ist. Letzterer
ist in der Wandung 2—3 cm dick und bei 8—10 cm
hoch. Er ist innen hohl und mag den Zweck ge-
habt haben, die Urne in der Erde festsetzen zu
können. Der Bauchdurchmesser dieser stets unge-
henkelten Urnen (Rekonstruktion Fig. 20) betrug
an 45 cm, die Höhe an 50 cm.
Am Schluß erwähne ich ein kleines Näpfchen
(Fig. 22), das aus einem Tonklümpchen durch einen
Fingerdruck erzeugt wurde; sein Abdruck ist innen
deutlich erkennbar. Es war ein Kinderspielzeug.1)
Fig. 22 Kleines Näpfchen; Durchmesser am Boden 2 cm,
Höhe 1 cm
In dem großen Material von Scherben und
Abfällen fanden sich auch Bruchstücke mißlungener
Fig. 20 Rekonstruktion einer
großen Urne; V9 n. Gr.
Fig. 21 Henkel eines
Vorratsgefäßes; 1/2 n. Gr.
Fig. 23 Bodenrand einer Urne;
V2 n. Gr.
8. An letzter Stelle komme ich auf die großen,
roh gearbeiteten Koch- und Vorratsgefäße zu
sprechen, deren Bruchstücke in Menge gefunden
wurden. Sie dienten ausschließlich dem praktischen
Leben und lassen an Geschmacklosigkeit nichts
zu wünschen übrig. Es waren sehr große, tonnen-
förmige, durchweg gerauhte oder gefurchte, roh
gebrannte Gefäße mit massiven Handhaben oder
breiten Henkeln. Das Material dazu besteht aus
einem stark mit Gneis und Glimmer gemischten
graphithaltigen Ton. Außer den Tupfenleisten oder
rohen Tonwülsten entbehren sie jedes Ornamentes.
b Groß-Weikersdorf (Fragment) vgl. Hoernes a. O.
33 fg. Fig. 41.
2) Leider ist es nicht gelungen, eines dieser ansehn-
lichen Gefäße vollständig zu restaurieren, da ein großer
Teil des Schutthaufens mit den Gefäßscherben in meiner
Abwesenheit von den Arbeitern weggeführt und ver-
schottert wurde.
Gefäße mit zersprungener und blasiger Oberfläche,
was auf zu starkes Brennen zurückzuführen ist.
Der Scherben eines Kochgefäßes zeigt neben der
Bruchstelle eine Lochbohrung; dieses Gefäß hatte
man aus seinen Scherben wieder zusammengestellt,
so wie es heute der „Rastelbinder“ mit Schnur
oder Draht macht; dieselbe Beobachtung machte
ich auf dem Gräberfeld aus der Hallstattperiode
bei Statzendorf. Wir sehen also, daß man zer-
brochene Gefäße doch nicht ohne weiteres beiseite
warf, sondern ihre Ausbesserung der Mühe der
Neuherstellung vorzog.
Hoffentlich führt die Zukunft uns auch an die
Wohnstätten und Gräber der Besitzer dieser Kera-
mik, deren Technik und künstlerische Auffassung
unsere Ansichten über den Kulturwert dieser Zeit-
periode in nicht unwesentlichen Zügen zugunsten
des Bronzezeitmenschen umgestalten wird.
1) Gnirs 72 Fig. 59.
5;
Eine Töpferei aus der Bronzezeit bei Herzogenburg
70
kranz und um den Boden graphitiert, während der
kugelige Urnenbauch gerauht oder leicht gefurcht
erscheint1) Die Urnen mit ausgeprägtem massiven
Boden sind besonders charakteristisch.* 2) Der sphä-
rische Gefäßbauch ist wieder meist gerauht, wäh-
rend der zylindrische Boden graphitiert ist. Letzterer
ist in der Wandung 2—3 cm dick und bei 8—10 cm
hoch. Er ist innen hohl und mag den Zweck ge-
habt haben, die Urne in der Erde festsetzen zu
können. Der Bauchdurchmesser dieser stets unge-
henkelten Urnen (Rekonstruktion Fig. 20) betrug
an 45 cm, die Höhe an 50 cm.
Am Schluß erwähne ich ein kleines Näpfchen
(Fig. 22), das aus einem Tonklümpchen durch einen
Fingerdruck erzeugt wurde; sein Abdruck ist innen
deutlich erkennbar. Es war ein Kinderspielzeug.1)
Fig. 22 Kleines Näpfchen; Durchmesser am Boden 2 cm,
Höhe 1 cm
In dem großen Material von Scherben und
Abfällen fanden sich auch Bruchstücke mißlungener
Fig. 20 Rekonstruktion einer
großen Urne; V9 n. Gr.
Fig. 21 Henkel eines
Vorratsgefäßes; 1/2 n. Gr.
Fig. 23 Bodenrand einer Urne;
V2 n. Gr.
8. An letzter Stelle komme ich auf die großen,
roh gearbeiteten Koch- und Vorratsgefäße zu
sprechen, deren Bruchstücke in Menge gefunden
wurden. Sie dienten ausschließlich dem praktischen
Leben und lassen an Geschmacklosigkeit nichts
zu wünschen übrig. Es waren sehr große, tonnen-
förmige, durchweg gerauhte oder gefurchte, roh
gebrannte Gefäße mit massiven Handhaben oder
breiten Henkeln. Das Material dazu besteht aus
einem stark mit Gneis und Glimmer gemischten
graphithaltigen Ton. Außer den Tupfenleisten oder
rohen Tonwülsten entbehren sie jedes Ornamentes.
b Groß-Weikersdorf (Fragment) vgl. Hoernes a. O.
33 fg. Fig. 41.
2) Leider ist es nicht gelungen, eines dieser ansehn-
lichen Gefäße vollständig zu restaurieren, da ein großer
Teil des Schutthaufens mit den Gefäßscherben in meiner
Abwesenheit von den Arbeitern weggeführt und ver-
schottert wurde.
Gefäße mit zersprungener und blasiger Oberfläche,
was auf zu starkes Brennen zurückzuführen ist.
Der Scherben eines Kochgefäßes zeigt neben der
Bruchstelle eine Lochbohrung; dieses Gefäß hatte
man aus seinen Scherben wieder zusammengestellt,
so wie es heute der „Rastelbinder“ mit Schnur
oder Draht macht; dieselbe Beobachtung machte
ich auf dem Gräberfeld aus der Hallstattperiode
bei Statzendorf. Wir sehen also, daß man zer-
brochene Gefäße doch nicht ohne weiteres beiseite
warf, sondern ihre Ausbesserung der Mühe der
Neuherstellung vorzog.
Hoffentlich führt die Zukunft uns auch an die
Wohnstätten und Gräber der Besitzer dieser Kera-
mik, deren Technik und künstlerische Auffassung
unsere Ansichten über den Kulturwert dieser Zeit-
periode in nicht unwesentlichen Zügen zugunsten
des Bronzezeitmenschen umgestalten wird.
1) Gnirs 72 Fig. 59.
5;