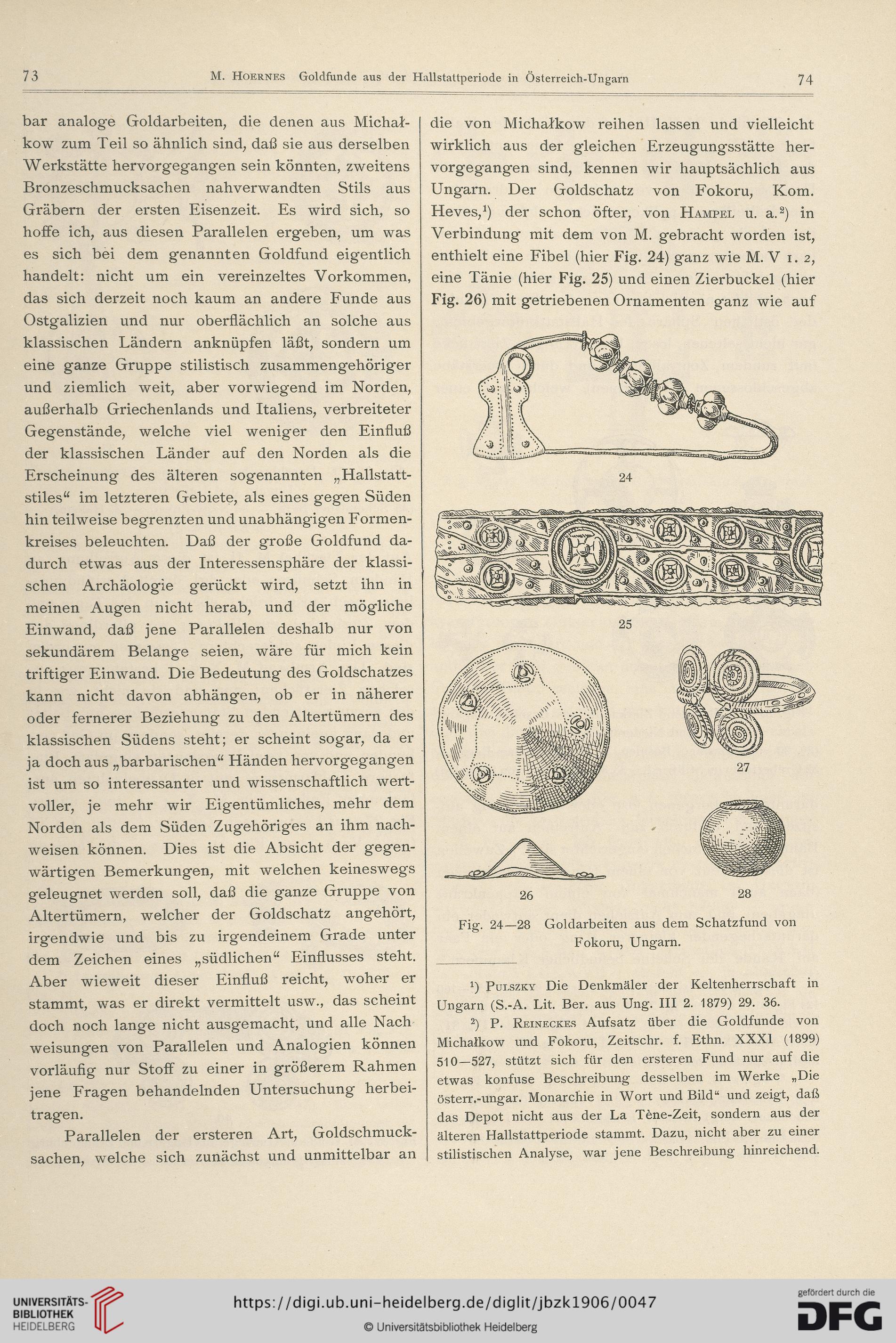73
Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn
74
bar analoge Goldarbeiten, die denen aus Michal-
kow zum Teil so ähnlich sind, daß sie aus derselben
Werkstätte hervorgegangen sein könnten, zweitens
Bronzeschmucksachen nahverwandten Stils aus
Gräbern der ersten Eisenzeit. Es wird sich, so
hoffe ich, aus diesen Parallelen ergeben, um was
es sich bei dem genannten Goldfund eigentlich
handelt: nicht um ein vereinzeltes Vorkommen,
das sich derzeit noch kaum an andere Funde aus
Ostgalizien und nur oberflächlich an solche aus
klassischen Ländern anknüpfen läßt, sondern um
eine ganze Gruppe stilistisch zusammengehöriger
und ziemlich weit, aber vorwiegend im Norden,
außerhalb Griechenlands und Italiens, verbreiteter
Gegenstände, welche viel weniger den Einfluß
der klassischen Länder auf den Norden als die
Erscheinung des älteren sogenannten „Hallstatt-
stiles“ im letzteren Gebiete, als eines gegen Süden
hin teilweise begrenzten und unabhängigen Formen-
kreises beleuchten. Daß der große Goldfund da-
durch etwas aus der Interessensphäre der klassi-
schen Archäologie gerückt wird, setzt ihn in
meinen Augen nicht herab, und der mögliche
Einwand, daß jene Parallelen deshalb nur von
sekundärem Belange seien, wäre für mich kein
triftiger Einwand. Die Bedeutung des Goldschatzes
kann nicht davon abhängen, ob er in näherer
oder fernerer Beziehung zu den Altertümern des
klassischen Südens steht; er scheint sogar, da er
ja doch aus „barbarischen“ Händen hervorgegangen
ist um so interessanter und wissenschaftlich wert-
voller, je mehr wir Eigentümliches, mehr dem
Norden als dem Süden Zugehöriges an ihm nach-
weisen können. Dies ist die Absicht der gegen-
wärtigen Bemerkungen, mit welchen keineswegs
geleugnet werden soll, daß die ganze Gruppe von
Altertümern, welcher der Goldschatz angehört,
irgendwie und bis zu irgendeinem Grade unter
dem Zeichen eines „südlichen“ Einflusses steht.
Aber wieweit dieser Einfluß reicht, woher er
stammt, was er direkt vermittelt usw., das scheint
doch noch lange nicht ausgemacht, und alle Nach
Weisungen von Parallelen und Analogien können
vorläufig nur Stoff zu einer in größerem Rahmen
jene Fragen behandelnden Untersuchung herbei-
tragen.
Parallelen der ersteren Art, Goldschmuck-
sachen, welche sich zunächst und unmittelbar an
die von Michalkow reihen lassen und vielleicht
wirklich aus der gleichen Erzeugungsstätte her-
vorgegangen sind, kennen wir hauptsächlich aus
Ungarn. Der Goldschatz von Fokoru, Kom.
Heves,1) der schon öfter, von Hampel u. a.2) in
Verbindung mit dem von Μ. gebracht worden ist,
enthielt eine Fibel (hier Fig. 24) ganz wie Μ. V i. 2,
eine Tänie (hier Fig. 25) und einen Zierbuckel (hier
Fig. 26) mit getriebenen Ornamenten ganz wie auf
24
25
Fig. 24—28
Goldarbeiten aus dem Schatzfund von
Fokoru, Ungarn.
27
1) Pulszky Die Denkmäler der Keltenherrschaft in
Ungarn (S.-A. Lit. Ber. aus Ung. III 2. 1879) 29. 36.
2) P. Reineckes Aufsatz über die Goldfunde von
Michalkow und Fokoru, Zeitschr. f. Ethn. XXXI (1899)
510—527, stützt sich für den ersteren Fund nur auf die
etwas konfuse Beschreibung desselben im Werke „Die
österr.-Ungar. Monarchie in Wort und Bild“ und zeigt, daß
das Depot nicht aus der La Tene-Zeit, sondern aus der
älteren Hallstattperiode stammt. Dazu, nicht aber zu einer
stilistischen Analyse, war jene Beschreibung hinreichend.
Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn
74
bar analoge Goldarbeiten, die denen aus Michal-
kow zum Teil so ähnlich sind, daß sie aus derselben
Werkstätte hervorgegangen sein könnten, zweitens
Bronzeschmucksachen nahverwandten Stils aus
Gräbern der ersten Eisenzeit. Es wird sich, so
hoffe ich, aus diesen Parallelen ergeben, um was
es sich bei dem genannten Goldfund eigentlich
handelt: nicht um ein vereinzeltes Vorkommen,
das sich derzeit noch kaum an andere Funde aus
Ostgalizien und nur oberflächlich an solche aus
klassischen Ländern anknüpfen läßt, sondern um
eine ganze Gruppe stilistisch zusammengehöriger
und ziemlich weit, aber vorwiegend im Norden,
außerhalb Griechenlands und Italiens, verbreiteter
Gegenstände, welche viel weniger den Einfluß
der klassischen Länder auf den Norden als die
Erscheinung des älteren sogenannten „Hallstatt-
stiles“ im letzteren Gebiete, als eines gegen Süden
hin teilweise begrenzten und unabhängigen Formen-
kreises beleuchten. Daß der große Goldfund da-
durch etwas aus der Interessensphäre der klassi-
schen Archäologie gerückt wird, setzt ihn in
meinen Augen nicht herab, und der mögliche
Einwand, daß jene Parallelen deshalb nur von
sekundärem Belange seien, wäre für mich kein
triftiger Einwand. Die Bedeutung des Goldschatzes
kann nicht davon abhängen, ob er in näherer
oder fernerer Beziehung zu den Altertümern des
klassischen Südens steht; er scheint sogar, da er
ja doch aus „barbarischen“ Händen hervorgegangen
ist um so interessanter und wissenschaftlich wert-
voller, je mehr wir Eigentümliches, mehr dem
Norden als dem Süden Zugehöriges an ihm nach-
weisen können. Dies ist die Absicht der gegen-
wärtigen Bemerkungen, mit welchen keineswegs
geleugnet werden soll, daß die ganze Gruppe von
Altertümern, welcher der Goldschatz angehört,
irgendwie und bis zu irgendeinem Grade unter
dem Zeichen eines „südlichen“ Einflusses steht.
Aber wieweit dieser Einfluß reicht, woher er
stammt, was er direkt vermittelt usw., das scheint
doch noch lange nicht ausgemacht, und alle Nach
Weisungen von Parallelen und Analogien können
vorläufig nur Stoff zu einer in größerem Rahmen
jene Fragen behandelnden Untersuchung herbei-
tragen.
Parallelen der ersteren Art, Goldschmuck-
sachen, welche sich zunächst und unmittelbar an
die von Michalkow reihen lassen und vielleicht
wirklich aus der gleichen Erzeugungsstätte her-
vorgegangen sind, kennen wir hauptsächlich aus
Ungarn. Der Goldschatz von Fokoru, Kom.
Heves,1) der schon öfter, von Hampel u. a.2) in
Verbindung mit dem von Μ. gebracht worden ist,
enthielt eine Fibel (hier Fig. 24) ganz wie Μ. V i. 2,
eine Tänie (hier Fig. 25) und einen Zierbuckel (hier
Fig. 26) mit getriebenen Ornamenten ganz wie auf
24
25
Fig. 24—28
Goldarbeiten aus dem Schatzfund von
Fokoru, Ungarn.
27
1) Pulszky Die Denkmäler der Keltenherrschaft in
Ungarn (S.-A. Lit. Ber. aus Ung. III 2. 1879) 29. 36.
2) P. Reineckes Aufsatz über die Goldfunde von
Michalkow und Fokoru, Zeitschr. f. Ethn. XXXI (1899)
510—527, stützt sich für den ersteren Fund nur auf die
etwas konfuse Beschreibung desselben im Werke „Die
österr.-Ungar. Monarchie in Wort und Bild“ und zeigt, daß
das Depot nicht aus der La Tene-Zeit, sondern aus der
älteren Hallstattperiode stammt. Dazu, nicht aber zu einer
stilistischen Analyse, war jene Beschreibung hinreichend.