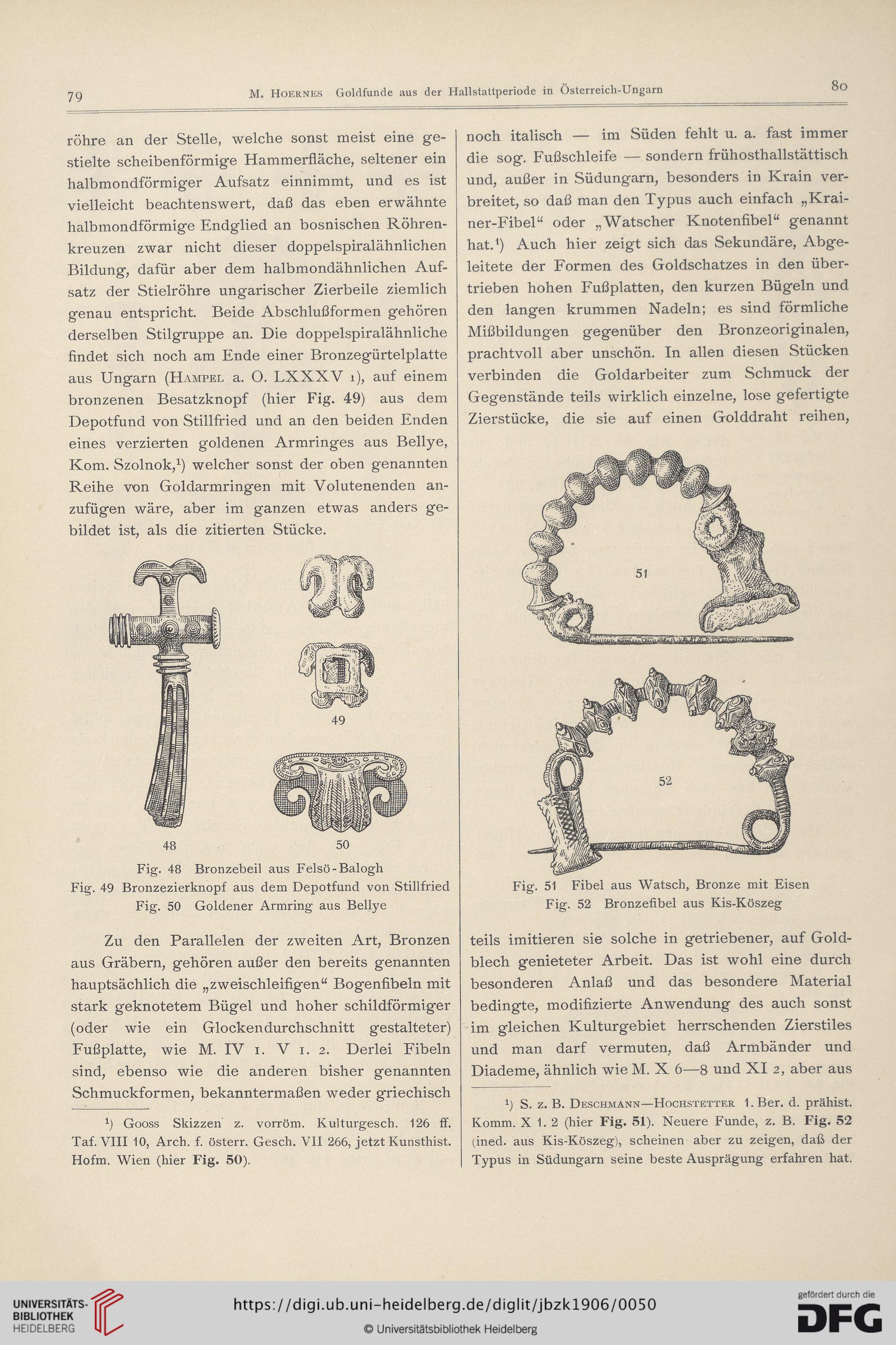79
Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn
8o
röhre an der Stelle, welche sonst meist eine ge-
stielte scheibenförmige Hammerfläche, seltener ein
halbmondförmiger Aufsatz einnimmt, und es ist
vielleicht beachtenswert, daß das eben erwähnte
halbmondförmige Endglied an bosnischen Röhren-
kreuzen zwar nicht dieser doppelspiralähnlichen
Bildung, dafür aber dem halbmondähnlichen Auf-
satz der Stielröhre ungarischer Zierbeile ziemlich
genau entspricht. Beide Abschlußformen gehören
derselben Stilgruppe an. Die doppelspiralähnliche
findet sich noch am Ende einer Bronzegürtelplatte
aus Ungarn (Hampel a. O. LXXXV i), auf einem
bronzenen Besatzknopf (hier Fig. 49) aus dem
Depotfund von Stillfried und an den beiden Enden
eines verzierten goldenen Armringes aus Bellye,
Kom. Szolnok,1) welcher sonst der oben genannten
Reihe von Goldarmringen mit Volutenenden an-
zufügen wäre, aber im ganzen etwas anders ge-
bildet ist, als die zitierten Stücke.
48
50
Fig. 48 Bronzebeil aus Felsö-Balogh
Fig. 49 Bronzezierknopf aus dem Depotfund von Stillfried
Fig. 50 Goldener Armring aus Bellye
Zu den Parallelen der zweiten Art, Bronzen
aus Gräbern, gehören außer den bereits genannten
hauptsächlich die „zweischleifigen“ Bogenfibeln mit
stark geknotetem Bügel und hoher schildförmiger
(oder wie ein Glockendurchschnitt gestalteter)
Fußplatte, wie Μ. IV ι. V i. 2. Derlei Fibeln
sind, ebenso wie die anderen bisher genannten
Schmuckformen, bekanntermaßen weder griechisch
Gooss Skizzen z. vorröm. Kulturgesch. 126 ff.
Taf. VIII 10, Arch. f. österr. Gesch. VII 266, jetzt Kunsthist.
Hofm. Wien (hier Fig. 50).
noch italisch — im Süden fehlt u. a. fast immer
die sog. Fußschleife — sondern frühosthallstättisch
und, außer in Südungarn, besonders in Krain ver-
breitet, so daß man den Typus auch einfach „Krai-
ner-Fibel“ oder „Wätscher Knotenfibel“ genannt
hat.1) Auch hier zeigt sich das Sekundäre, Abge-
leitete der Formen des Goldschatzes in den über-
trieben hohen Fußplatten, den kurzen Bügeln und
den langen krummen Nadeln; es sind förmliche
Mißbildungen gegenüber den Bronzeoriginalen,
prachtvoll aber unschön. In allen diesen Stücken
verbinden die Goldarbeiter zum Schmuck der
Gegenstände teils wirklich einzelne, lose gefertigte
Zierstücke, die sie auf einen Golddraht reihen,
Fig. 51 Fibel aus Watsch, Bronze mit Eisen
Fig. 52 Bronzefibel aus Kis-Köszeg
teils imitieren sie solche in getriebener, auf Gold-
blech genieteter Arbeit. Das ist wohl eine durch
besonderen Anlaß und das besondere Material
bedingte, modifizierte Anwendung des auch sonst
im gleichen Kulturgebiet herrschenden Zierstiles
und man darf vermuten, daß Armbänder und
Diademe, ähnlich wie Μ. X 6—8 und XI 2, aber aus
S. z. B. Deschmann—Hochstetter 1. Ber. d. prähist.
Komm. X 1. 2 (hier Fig. 51). Neuere Funde, z. B. Fig. 52
(ined. aus Kis-Köszeg), scheinen aber zu zeigen, daß der
Typus in Südungarn seine beste Ausprägung erfahren hat.
Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn
8o
röhre an der Stelle, welche sonst meist eine ge-
stielte scheibenförmige Hammerfläche, seltener ein
halbmondförmiger Aufsatz einnimmt, und es ist
vielleicht beachtenswert, daß das eben erwähnte
halbmondförmige Endglied an bosnischen Röhren-
kreuzen zwar nicht dieser doppelspiralähnlichen
Bildung, dafür aber dem halbmondähnlichen Auf-
satz der Stielröhre ungarischer Zierbeile ziemlich
genau entspricht. Beide Abschlußformen gehören
derselben Stilgruppe an. Die doppelspiralähnliche
findet sich noch am Ende einer Bronzegürtelplatte
aus Ungarn (Hampel a. O. LXXXV i), auf einem
bronzenen Besatzknopf (hier Fig. 49) aus dem
Depotfund von Stillfried und an den beiden Enden
eines verzierten goldenen Armringes aus Bellye,
Kom. Szolnok,1) welcher sonst der oben genannten
Reihe von Goldarmringen mit Volutenenden an-
zufügen wäre, aber im ganzen etwas anders ge-
bildet ist, als die zitierten Stücke.
48
50
Fig. 48 Bronzebeil aus Felsö-Balogh
Fig. 49 Bronzezierknopf aus dem Depotfund von Stillfried
Fig. 50 Goldener Armring aus Bellye
Zu den Parallelen der zweiten Art, Bronzen
aus Gräbern, gehören außer den bereits genannten
hauptsächlich die „zweischleifigen“ Bogenfibeln mit
stark geknotetem Bügel und hoher schildförmiger
(oder wie ein Glockendurchschnitt gestalteter)
Fußplatte, wie Μ. IV ι. V i. 2. Derlei Fibeln
sind, ebenso wie die anderen bisher genannten
Schmuckformen, bekanntermaßen weder griechisch
Gooss Skizzen z. vorröm. Kulturgesch. 126 ff.
Taf. VIII 10, Arch. f. österr. Gesch. VII 266, jetzt Kunsthist.
Hofm. Wien (hier Fig. 50).
noch italisch — im Süden fehlt u. a. fast immer
die sog. Fußschleife — sondern frühosthallstättisch
und, außer in Südungarn, besonders in Krain ver-
breitet, so daß man den Typus auch einfach „Krai-
ner-Fibel“ oder „Wätscher Knotenfibel“ genannt
hat.1) Auch hier zeigt sich das Sekundäre, Abge-
leitete der Formen des Goldschatzes in den über-
trieben hohen Fußplatten, den kurzen Bügeln und
den langen krummen Nadeln; es sind förmliche
Mißbildungen gegenüber den Bronzeoriginalen,
prachtvoll aber unschön. In allen diesen Stücken
verbinden die Goldarbeiter zum Schmuck der
Gegenstände teils wirklich einzelne, lose gefertigte
Zierstücke, die sie auf einen Golddraht reihen,
Fig. 51 Fibel aus Watsch, Bronze mit Eisen
Fig. 52 Bronzefibel aus Kis-Köszeg
teils imitieren sie solche in getriebener, auf Gold-
blech genieteter Arbeit. Das ist wohl eine durch
besonderen Anlaß und das besondere Material
bedingte, modifizierte Anwendung des auch sonst
im gleichen Kulturgebiet herrschenden Zierstiles
und man darf vermuten, daß Armbänder und
Diademe, ähnlich wie Μ. X 6—8 und XI 2, aber aus
S. z. B. Deschmann—Hochstetter 1. Ber. d. prähist.
Komm. X 1. 2 (hier Fig. 51). Neuere Funde, z. B. Fig. 52
(ined. aus Kis-Köszeg), scheinen aber zu zeigen, daß der
Typus in Südungarn seine beste Ausprägung erfahren hat.