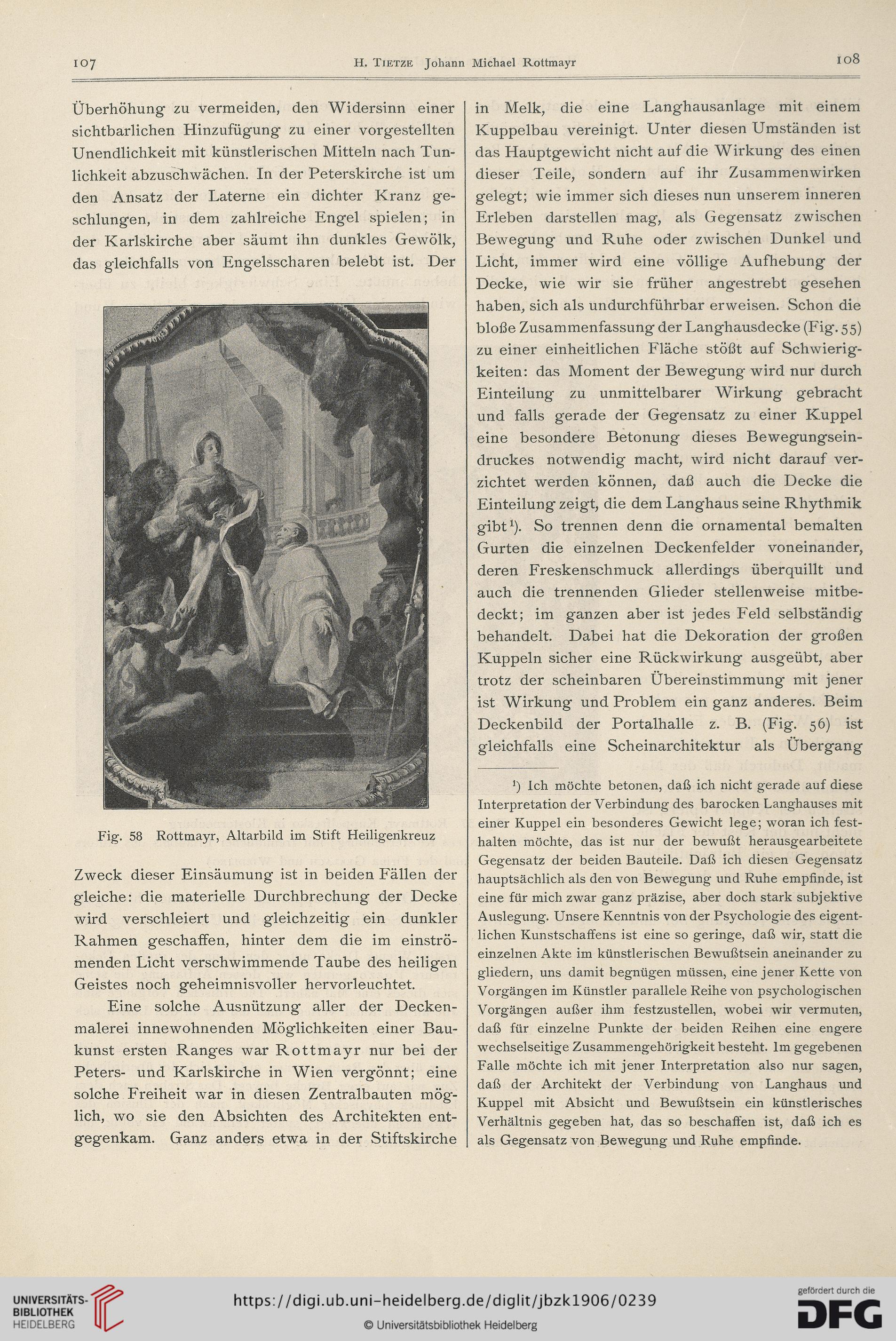io7
Η. Tiktze Johann Michael Rottmayr
Ιθ8
Überhöhung zu vermeiden, den Widersinn einer
sichtbarlichen Hinzufügung zu einer vorgestellten
Unendlichkeit mit künstlerischen Mitteln nach Tun-
lichkeit abzuschwächen. In der Peterskirche ist um
den Ansatz der Laterne ein dichter Kranz ge-
schlungen, in dem zahlreiche Engel spielen; in
der Karlskirche aber säumt ihn dunkles Gewölk,
das gleichfalls von Engelsscharen belebt ist. Der
Fig. 58 Rottmayr, Altarbild im Stift Heiligenkreuz
Zweck dieser Einsäumung ist in beiden Fällen der
gleiche: die materielle Durchbrechung der Decke
wird verschleiert und gleichzeitig ein dunkler
Rahmen geschaffen, hinter dem die im einströ-
menden Licht verschwimmende Taube des heiligen
Geistes noch geheimnisvoller hervorleuchtet.
Eine solche Ausnützung aller der Decken-
malerei innewohnenden Möglichkeiten einer Bau-
kunst ersten Ranges war Rottmayr nur bei der
Peters- und Karlskirche in Wien vergönnt; eine
solche Freiheit war in diesen Zentralbauten mög-
lich, wo sie den Absichten des Architekten ent-
gegenkam. Ganz anders etwa in der Stiftskirche
in Melk, die eine Langhausanlage mit einem
Kuppelbau vereinigt. Unter diesen Umständen ist
das Hauptgewicht nicht auf die Wirkung des einen
dieser Teile, sondern auf ihr Zusammenwirken
gelegt; wie immer sich dieses nun unserem inneren
Erleben darstellen mag, als Gegensatz zwischen
Bewegung und Ruhe oder zwischen Dunkel und
Licht, immer wird eine völlige Aufhebung der
Decke, wie wir sie früher angestrebt gesehen
haben, sich als undurchführbar erweisen. Schon die
bloße Zusammenfassung der Langhausdecke (Fig. 55)
zu einer einheitlichen Fläche stößt auf Schwierig-
keiten: das Moment der Bewegung wird nur durch
Einteilung zu unmittelbarer Wirkung gebracht
und falls gerade der Gegensatz zu einer Kuppel
eine besondere Betonung dieses Bewegungsein-
druckes notwendig macht, wird nicht darauf ver-
zichtet werden können, daß auch die Decke die
Einteilung zeigt, die dem Langhaus seine Rhythmik
gibt1). So trennen denn die ornamental bemalten
Gurten die einzelnen Deckenfelder voneinander,
deren Freskenschmuck allerdings überquillt und
auch die trennenden Glieder stellenweise mitbe-
deckt; im ganzen aber ist jedes Feld selbständig
behandelt. Dabei hat die Dekoration der großen
Kuppeln sicher eine Rückwirkung ausgeübt, aber
trotz der scheinbaren Übereinstimmung mit jener
ist Wirkung und Problem ein ganz anderes. Beim
Deckenbild der Portalhalle z. B. (Fig. 56) ist
gleichfalls eine Scheinarchitektur als Übergang
’) Ich möchte betonen, daß ich nicht gerade auf diese
Interpretation der Verbindung des barocken Langhauses mit
einer Kuppel ein besonderes Gewicht lege; woran ich fest-
halten möchte, das ist nur der bewußt herausgearbeitete
Gegensatz der beiden Bauteile. Daß ich diesen Gegensatz
hauptsächlich als den von Bewegung und Ruhe empfinde, ist
eine für mich zwar ganz präzise, aber doch stark subjektive
Auslegung. Unsere Kenntnis von der Psychologie des eigent-
lichen Kunstschaffens ist eine so geringe, daß wir, statt die
einzelnen Akte im künstlerischen Bewußtsein aneinander zu
gliedern, uns damit begnügen müssen, eine jener Kette von
Vorgängen im Künstler parallele Reihe von psychologischen
Vorgängen außer ihm festzustellen, wobei wir vermuten,
daß für einzelne Punkte der beiden Reihen eine engere
wechselseitige Zusammengehörigkeit besteht. Im gegebenen
Falle möchte ich mit jener Interpretation also nur sagen,
daß der Architekt der Verbindung von Langhaus und
Kuppel mit Absicht und Bewußtsein ein künstlerisches
Verhältnis gegeben hat, das so beschaffen ist, daß ich es
als Gegensatz von Bewegung und Ruhe empfinde.
Η. Tiktze Johann Michael Rottmayr
Ιθ8
Überhöhung zu vermeiden, den Widersinn einer
sichtbarlichen Hinzufügung zu einer vorgestellten
Unendlichkeit mit künstlerischen Mitteln nach Tun-
lichkeit abzuschwächen. In der Peterskirche ist um
den Ansatz der Laterne ein dichter Kranz ge-
schlungen, in dem zahlreiche Engel spielen; in
der Karlskirche aber säumt ihn dunkles Gewölk,
das gleichfalls von Engelsscharen belebt ist. Der
Fig. 58 Rottmayr, Altarbild im Stift Heiligenkreuz
Zweck dieser Einsäumung ist in beiden Fällen der
gleiche: die materielle Durchbrechung der Decke
wird verschleiert und gleichzeitig ein dunkler
Rahmen geschaffen, hinter dem die im einströ-
menden Licht verschwimmende Taube des heiligen
Geistes noch geheimnisvoller hervorleuchtet.
Eine solche Ausnützung aller der Decken-
malerei innewohnenden Möglichkeiten einer Bau-
kunst ersten Ranges war Rottmayr nur bei der
Peters- und Karlskirche in Wien vergönnt; eine
solche Freiheit war in diesen Zentralbauten mög-
lich, wo sie den Absichten des Architekten ent-
gegenkam. Ganz anders etwa in der Stiftskirche
in Melk, die eine Langhausanlage mit einem
Kuppelbau vereinigt. Unter diesen Umständen ist
das Hauptgewicht nicht auf die Wirkung des einen
dieser Teile, sondern auf ihr Zusammenwirken
gelegt; wie immer sich dieses nun unserem inneren
Erleben darstellen mag, als Gegensatz zwischen
Bewegung und Ruhe oder zwischen Dunkel und
Licht, immer wird eine völlige Aufhebung der
Decke, wie wir sie früher angestrebt gesehen
haben, sich als undurchführbar erweisen. Schon die
bloße Zusammenfassung der Langhausdecke (Fig. 55)
zu einer einheitlichen Fläche stößt auf Schwierig-
keiten: das Moment der Bewegung wird nur durch
Einteilung zu unmittelbarer Wirkung gebracht
und falls gerade der Gegensatz zu einer Kuppel
eine besondere Betonung dieses Bewegungsein-
druckes notwendig macht, wird nicht darauf ver-
zichtet werden können, daß auch die Decke die
Einteilung zeigt, die dem Langhaus seine Rhythmik
gibt1). So trennen denn die ornamental bemalten
Gurten die einzelnen Deckenfelder voneinander,
deren Freskenschmuck allerdings überquillt und
auch die trennenden Glieder stellenweise mitbe-
deckt; im ganzen aber ist jedes Feld selbständig
behandelt. Dabei hat die Dekoration der großen
Kuppeln sicher eine Rückwirkung ausgeübt, aber
trotz der scheinbaren Übereinstimmung mit jener
ist Wirkung und Problem ein ganz anderes. Beim
Deckenbild der Portalhalle z. B. (Fig. 56) ist
gleichfalls eine Scheinarchitektur als Übergang
’) Ich möchte betonen, daß ich nicht gerade auf diese
Interpretation der Verbindung des barocken Langhauses mit
einer Kuppel ein besonderes Gewicht lege; woran ich fest-
halten möchte, das ist nur der bewußt herausgearbeitete
Gegensatz der beiden Bauteile. Daß ich diesen Gegensatz
hauptsächlich als den von Bewegung und Ruhe empfinde, ist
eine für mich zwar ganz präzise, aber doch stark subjektive
Auslegung. Unsere Kenntnis von der Psychologie des eigent-
lichen Kunstschaffens ist eine so geringe, daß wir, statt die
einzelnen Akte im künstlerischen Bewußtsein aneinander zu
gliedern, uns damit begnügen müssen, eine jener Kette von
Vorgängen im Künstler parallele Reihe von psychologischen
Vorgängen außer ihm festzustellen, wobei wir vermuten,
daß für einzelne Punkte der beiden Reihen eine engere
wechselseitige Zusammengehörigkeit besteht. Im gegebenen
Falle möchte ich mit jener Interpretation also nur sagen,
daß der Architekt der Verbindung von Langhaus und
Kuppel mit Absicht und Bewußtsein ein künstlerisches
Verhältnis gegeben hat, das so beschaffen ist, daß ich es
als Gegensatz von Bewegung und Ruhe empfinde.