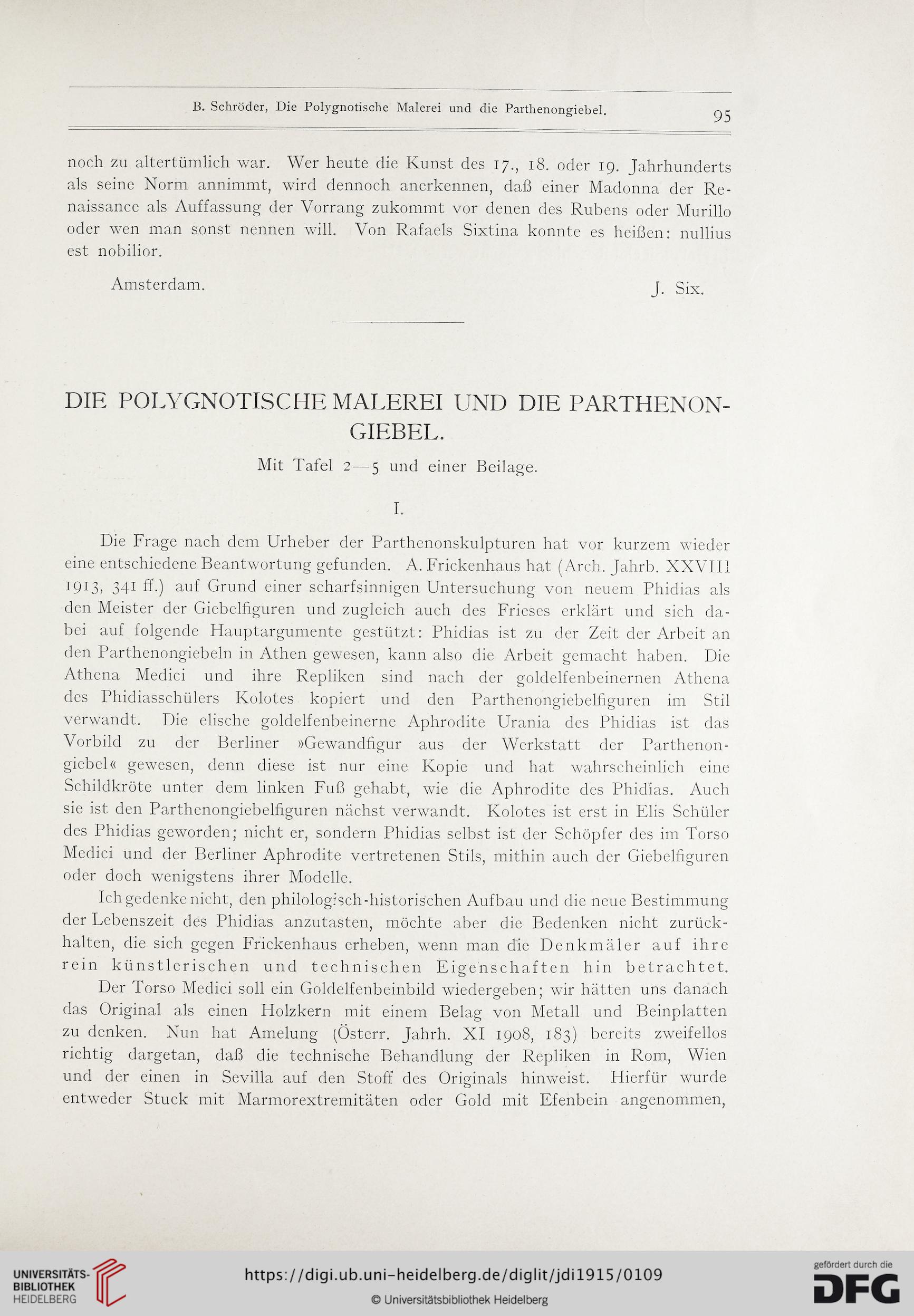B. Schröder, Die Polygnotische Malerei und die Parthenongiebel.
95
noch zu altertümlich war. Wer heute die Kunst des 17., 18. oder 19. Jahrhunderts
als seine Norm annimmt, wird dennoch anerkennen, daß einer Madonna der Re-
naissance als Auffassung der Vorrang zukommt vor denen des Rubens oder Murillo
oder wen man sonst nennen will. Von Rafaels Sixtina konnte es heißen: nullius
est nobilior.
Amsterdam.
J. Six.
DIE POLYGNOTISCHE MALEREI UND DIE PARTHENON-
GIEBEL.
Mit Tafel 2—5 und einer Beilage.
I.
Die Frage nach dem Urheber der Parthenonskulpturen hat vor kurzem wieder
eine entschiedene Beantwortung gefunden. A. Frickenhaus hat (Arch. Jahrb. XXVIII
1913, 341 ff.) auf Grund einer scharfsinnigen Untersuchung von neuem Phidias als
den Meister der Giebelfiguren und zugleich auch des Frieses erklärt und sich da-
bei auf folgende Hauptargumente gestützt: Phidias ist zu der Zeit der Arbeit an
den Parthenongiebeln in Athen gewesen, kann also die Arbeit gemacht haben. Die
Athena Medici und ihre Repliken sind nach der goldelfenbeinernen Athena
des Phidiasschülers Kolotes kopiert und den Parthenongiebelfiguren im Stil
verwandt. Die elische goldelfenbeinerne Aphrodite Urania des Phidias ist das
Vorbild zu der Berliner »Gewandfigur aus der Werkstatt der Parthenon-
giebel« gewesen, denn diese ist nur eine Kopie und hat wahrscheinlich eine
Schildkröte unter dem linken Fuß gehabt, wie die Aphrodite des Phidias. Auch
sie ist den Parthenongiebelfiguren nächst verwandt. Kolotes ist erst in Elis Schüler
des Phidias geworden; nicht er, sondern Phidias selbst ist der Schöpfer des im Torso
Medici und der Berliner Aphrodite vertretenen Stils, mithin auch der Giebelfiguren
oder doch wenigstens ihrer Modelle.
Ich gedenke nicht, den philologisch-historischen Aufbau und die neue Bestimmung
der Lebenszeit des Phidias anzutasten, möchte aber die Bedenken nicht zurück-
halten, die sich gegen Frickenhaus erheben, wenn man die Denkmäler auf ihre
rein künstlerischen und technischen Eigenschaften hin betrachtet.
Der Torso Medici soll ein Goldelfenbeinbild wiedergeben; wir hätten uns danach
das Original als einen Holzkern mit einem Belag von Metall und Beinplatten
zu denken. Nun hat Amelung (Österr. Jahrh. XI 1908, 183) bereits zweifellos
richtig dargetan, daß die technische Behandlung der Repliken in Rom, Wien
und der einen in Sevilla auf den Stoff des Originals hinweist. Hierfür wurde
entweder Stuck mit Marmorextremitäten oder Gold mit Efenbein angenommen,
95
noch zu altertümlich war. Wer heute die Kunst des 17., 18. oder 19. Jahrhunderts
als seine Norm annimmt, wird dennoch anerkennen, daß einer Madonna der Re-
naissance als Auffassung der Vorrang zukommt vor denen des Rubens oder Murillo
oder wen man sonst nennen will. Von Rafaels Sixtina konnte es heißen: nullius
est nobilior.
Amsterdam.
J. Six.
DIE POLYGNOTISCHE MALEREI UND DIE PARTHENON-
GIEBEL.
Mit Tafel 2—5 und einer Beilage.
I.
Die Frage nach dem Urheber der Parthenonskulpturen hat vor kurzem wieder
eine entschiedene Beantwortung gefunden. A. Frickenhaus hat (Arch. Jahrb. XXVIII
1913, 341 ff.) auf Grund einer scharfsinnigen Untersuchung von neuem Phidias als
den Meister der Giebelfiguren und zugleich auch des Frieses erklärt und sich da-
bei auf folgende Hauptargumente gestützt: Phidias ist zu der Zeit der Arbeit an
den Parthenongiebeln in Athen gewesen, kann also die Arbeit gemacht haben. Die
Athena Medici und ihre Repliken sind nach der goldelfenbeinernen Athena
des Phidiasschülers Kolotes kopiert und den Parthenongiebelfiguren im Stil
verwandt. Die elische goldelfenbeinerne Aphrodite Urania des Phidias ist das
Vorbild zu der Berliner »Gewandfigur aus der Werkstatt der Parthenon-
giebel« gewesen, denn diese ist nur eine Kopie und hat wahrscheinlich eine
Schildkröte unter dem linken Fuß gehabt, wie die Aphrodite des Phidias. Auch
sie ist den Parthenongiebelfiguren nächst verwandt. Kolotes ist erst in Elis Schüler
des Phidias geworden; nicht er, sondern Phidias selbst ist der Schöpfer des im Torso
Medici und der Berliner Aphrodite vertretenen Stils, mithin auch der Giebelfiguren
oder doch wenigstens ihrer Modelle.
Ich gedenke nicht, den philologisch-historischen Aufbau und die neue Bestimmung
der Lebenszeit des Phidias anzutasten, möchte aber die Bedenken nicht zurück-
halten, die sich gegen Frickenhaus erheben, wenn man die Denkmäler auf ihre
rein künstlerischen und technischen Eigenschaften hin betrachtet.
Der Torso Medici soll ein Goldelfenbeinbild wiedergeben; wir hätten uns danach
das Original als einen Holzkern mit einem Belag von Metall und Beinplatten
zu denken. Nun hat Amelung (Österr. Jahrh. XI 1908, 183) bereits zweifellos
richtig dargetan, daß die technische Behandlung der Repliken in Rom, Wien
und der einen in Sevilla auf den Stoff des Originals hinweist. Hierfür wurde
entweder Stuck mit Marmorextremitäten oder Gold mit Efenbein angenommen,