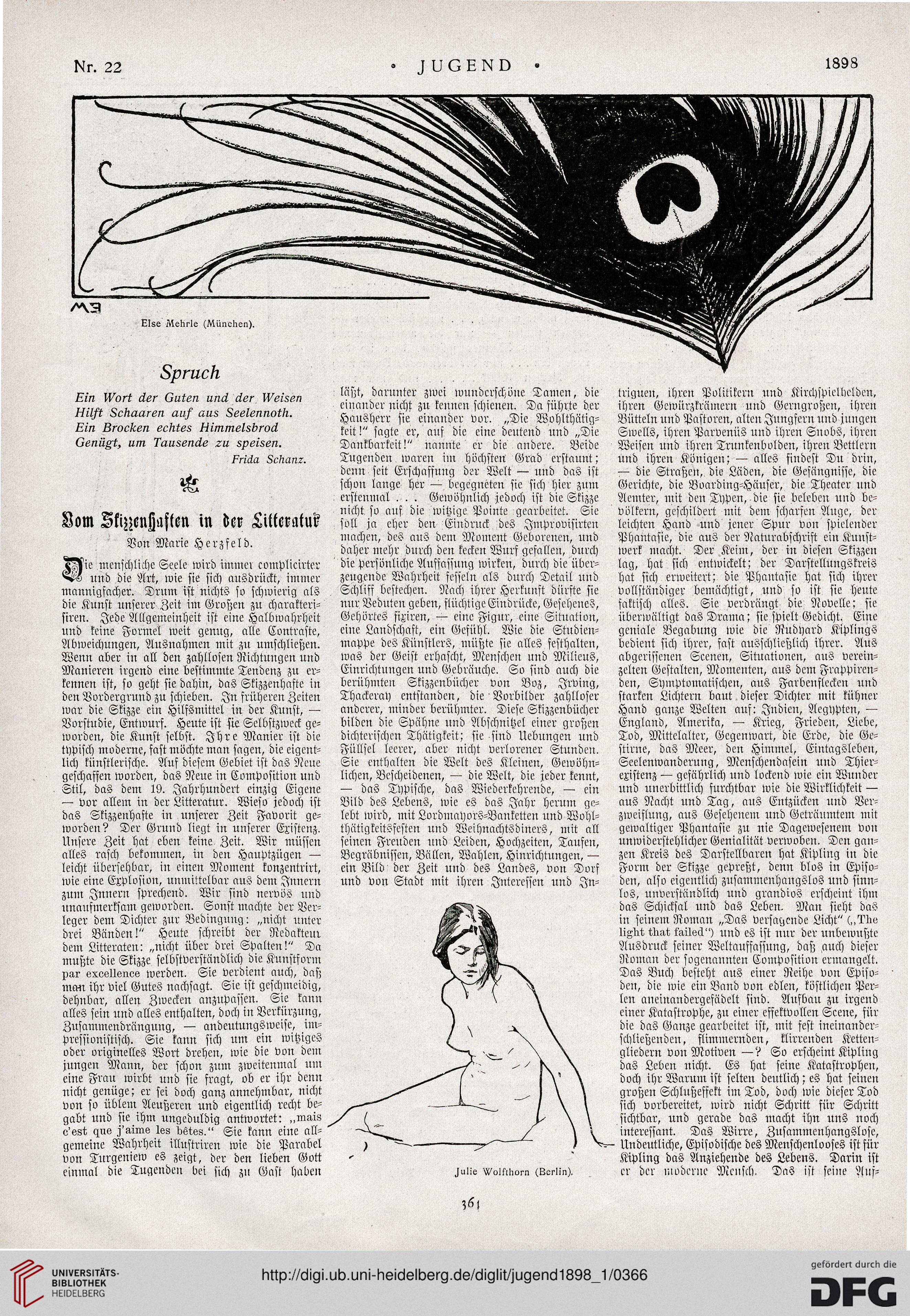Nr. 22
JUGEND
1898
Ein Wort der Guten und der Weisen
Hilft Schaaren auf aus Seelennoth.
Ein Brocken echtes Himmelsbrod
Genügt, um Tausende zu speisen.
Frida Schanz.
&
Som ZkiWijjaften in der Litteratuk
Von Marie Herzfeld.
zUie menschliche Seele wird immer complicirter
und die Art, wie sie sich ausdrückt, immer
mannigfacher. Drum ist nichts so schwierig als
die Kunst unserer Zeit im Großen zu charakteri-
siren. Jede Allgemeinheit ist eine Halbwahrheit
und keine Formet weit genug, alle Contraste,
Abweichungen, Ausnahmen mit zu umschließen.
Wenn aber in all den zahllosen Richtungen und
Manieren irgend eine bestimmte Tendenz zu er-
kennen ist, so geht sie dahin, das Skizzenhafte in
den Vordergrund zu schieben. In früheren Zeiten
war die Skizze ein Hilfsnüttel in der Kunst, —
Vorstudie, Entwurf. Heute ist sie Selbstzweck ge-
worden, die Kunst selbst. Ihre Manier ist die
typisch moderne, fast möchte man sagen, die eigent-
lich künstlerische. Auf diesem Gebiet ist das Neue
geschaffen worden, das Neue in Composition und
Stil, das dem 19. Jahrhundert einzig Eigene
— vor allem in der Litteratur. Wieso jedoch ist
das Skizzenhafte in unserer Zeit Favorit ge-
worden? Der Grund liegt in unserer Existenz.
Unsere Zeit hat eben keine Zeit. Wir müssen
alles rasch bekommen, in den Hauptzügen —
leicht übersehbar, in einen Moment konzentrirt,
wie eine Explosion, unmittelbar aus dem Innern
zum Innern sprechend. Wir sind nervös und
nnansmerksam geworden. Sonst machte der Ver-
leger dem Dichter zur Bedingung: „nicht unter
drei Bänden!" Heute schreibt der Redakteur
dem Litteraten: „nicht über drei Spalten!" Da
mußte die Skizze selbstverständlich die Kunstform
par excellence werden. Sie verdient auch, daß
man ihr viel Gutes nachsagt. Sie ist geschmeidig,
dehnbar, allen Zwecken anzupassen. Sie kann
alles sein und alles enthalten, doch iil Verkürzung,
Zusammendrängung, — andeutungsweise, im-
pressionistisch. Sie kann sich um ein witziges
oder originelles Wort drehen, wie die von dem
jungen Mann, der schon zum zweitenmal um
eine Frau wirbt und sie fragt, ob er ihr denn
nicht genüge; er sei doch ganz annehmbar, nicht
von so üblem Aeußeren und eigentlich recht be-
gabt und sic ihm ungeduldig antwortet: „mais
c’est que j’aime les betes.“ Sie kann eine all-
gemeine Wahrheit illustriren wie die Parabel
von Turgenjew es zeigt, der den lieben Gott
einmal die Tugenden bei sich zu Gast haben
läßt, darunter zwei wunderschöne Damen, die
einander nicht zu kennen schienen. Da führte der
Hausherr sie einander vor. „Die Wohltätig-
keit!" sagte er, auf die eine deutend und „Die
Dankbarkeit!" nannte er die andere. Beide
Tugenden waren im höchsten Grad erstaunt;
denn seit Erschaffung der Welt — und das ist
schon lange her — begegneten sie sich hier zum
erstenmal . . . Gewöhnlich jedoch ist die Skizze
nicht so auf die witzige Pointe gearbeitet. Sie
soll ja eher den Eindruck des Jmprovisirten
machen, des aus dem Moment Geborenen, und
daher mehr durch den kecken Wurf gefallen, durch
die persönliche Auffassung wirken, durch die über-
zeugende Wahrheit fesseln als durch Detail und
Schliff bestechen. Nach ihrer Herkunft dürfte sie
nur Veduten geben, flüchtige Eindrücke, Gesehenes,
Gehörtes fixiren, — eine Figur, eine Situation,
eine Landschaft, ein Gefühl. Wie die Studien-
mappe des Künstlers, müßte sie alles festhalteu,
was der Geist erhascht, Menschen und Milieus,
Einrichtungen und Gebräuche. So sind auch die
berühmten Skizzenbücher von Boz, Irving,
Thackcray entstanden, die Vorbilder zahlloser
anderer, minder berühmter. Diese Skizzenbiicher
bilden die Spähne und Abschnitzel einer großen
dichterischen Thätigkeit; sie sind Hebungen und
Füllsel leerer, aber nicht verlorener Stunden.
Sie enthalten die Welt des Kleinen, Gewöhn-
lichen, Bescheidenen, — die Welt, die jeder kennt,
— das Typische, das Wiederkehrende, — ein
Bild des Lebens, wie es das Jahr herum ge-
lebt wird, mit Lordmayors-Banketten und Wohl-
thätigkeitsfesten und Weihnachtsdiners, mit all
seinen Freuden und Leiden, Hochzeiten, Taufen,
Begräbnissen, Bällen, Wahlen, Hinrichtungen, —
ein Bild der Zeit und des Landes, von Dorf
und von Stadt mit ihren Interessen und Jn-
triguen, ihren Politikern und Kirchspielbclden,
ihren Gewürzkrämern und Gcrngroßen, ihren
Bütteln und Pastoren, alten Jungfern und jungen
Swells, ihren Parvenüs und ihren Snobs, ihren
Weisen und ihren Trunkenbolden, ihren Bettlern
und ihren Königen; — alles findest Du drin,
— die Straßen, die Läden, die Gefängnisse, die
Gerichte, die Boarding-Hänser, die Theater und
Aemter, mit den Typen, , die sie beleben und be-
völkern, geschildert mit dem scharfen Auge, der
leichten Hand und jener Spur von spielender
Phantasie, die aus der Naturabschrift ein Kunst-
werk macht. Der Keim, der in diesen Skizzen
lag, hat sich entivickelt; der Darstellnngskreis
hat sich erweitert; die Phantasie hat sich ihrer
vollständiger bemächtigt, und so ist sie heute
faktisch alles. Sie verdrängt die Novelle; sie
überwältigt das Drama; sie spielt Gedicht. Eine
geniale Begabung ivie die Rudyard Kiplings
bedient sich ihrer, fast ausschließlich ihrer. Aus
abgerissenen Scenen, Situationen, aus verein-
zelten Gestalten, Momenten, aus dem Frappiren-
den, Symptomatischen, aus Farbenflecken und
starken Lichtern baut dieser Dichter mit kühner
Hand ganze Welten auf: Indien, Aegypten, —
England, Amerika, — Krieg, Frieden, Liebe,
Tod, Mittelalter, Gegenwart, die Erde, die Ge-
stirne, das Meer, den Himmel, Eintagsleben,
Seelenwanderung, Menschendasein und Thier-
existenz — gefährlich und lockend wie ein Wunder
und unerbittlich furchtbar wie die Wirklichkeit —
aus Nacht und Tag, ans Entzücken und Ver-
zweiflung, aus Gesehenem und Geträumtem mit
gewaltiger Phantasie zu nie Dagewesenem von
unwiderstehlicher Genialität verwoben. Den gan-
zen Kreis des Darstellbaren hat Kipling in die
Form der Skizze gepreßt, denn blos in Episo-
den, also eigentlich zusammenhangslos und sinn-
los, unverständlich und grandios erscheint ihm
das Schicksal und das Leben. Man sieht das
in seinem Roman „Das versagende Licht" („The
light that failed“) und es ist nur der unbewußte
Ausdruck seiner Weltauffassung, daß auch dieser
Roman der sogenannten Composition ermangelt.
Das Buch besteht aus einer Reihe von Episo-
den, die wie ein Band von edlen, köstlichen Per-
len aneinandergefädelt sind. Aufbau zu irgend
einer Katastrophe, zu einer effektvollen Scene, für
die das Ganze gearbeitet ist, mit fest ineinander-
schließenden, flimmernden, klirrenden Ketten-
gliedern von Motiven —? So erscheint Kipling
das Leben nicht. Es hat seine Katastrophen,
doch ihr Warum ist selten deutlich; es hat seinen
großen Schlnßeffekt im Tod, doch ivie dieser Tod
sich vorbereitet, ivird nicht Schritt für Schritt
sichtbar, und gerade das macht ihn uns noch
interessant. Das Wirre, Zusammenhangslose,
Undeutliche, Episodische des Menschenlooses ist ftir
Kipling das Anziehende des Lebens. Darin ist
er der moderne Mensch. DaS ist seine Auf-
JUGEND
1898
Ein Wort der Guten und der Weisen
Hilft Schaaren auf aus Seelennoth.
Ein Brocken echtes Himmelsbrod
Genügt, um Tausende zu speisen.
Frida Schanz.
&
Som ZkiWijjaften in der Litteratuk
Von Marie Herzfeld.
zUie menschliche Seele wird immer complicirter
und die Art, wie sie sich ausdrückt, immer
mannigfacher. Drum ist nichts so schwierig als
die Kunst unserer Zeit im Großen zu charakteri-
siren. Jede Allgemeinheit ist eine Halbwahrheit
und keine Formet weit genug, alle Contraste,
Abweichungen, Ausnahmen mit zu umschließen.
Wenn aber in all den zahllosen Richtungen und
Manieren irgend eine bestimmte Tendenz zu er-
kennen ist, so geht sie dahin, das Skizzenhafte in
den Vordergrund zu schieben. In früheren Zeiten
war die Skizze ein Hilfsnüttel in der Kunst, —
Vorstudie, Entwurf. Heute ist sie Selbstzweck ge-
worden, die Kunst selbst. Ihre Manier ist die
typisch moderne, fast möchte man sagen, die eigent-
lich künstlerische. Auf diesem Gebiet ist das Neue
geschaffen worden, das Neue in Composition und
Stil, das dem 19. Jahrhundert einzig Eigene
— vor allem in der Litteratur. Wieso jedoch ist
das Skizzenhafte in unserer Zeit Favorit ge-
worden? Der Grund liegt in unserer Existenz.
Unsere Zeit hat eben keine Zeit. Wir müssen
alles rasch bekommen, in den Hauptzügen —
leicht übersehbar, in einen Moment konzentrirt,
wie eine Explosion, unmittelbar aus dem Innern
zum Innern sprechend. Wir sind nervös und
nnansmerksam geworden. Sonst machte der Ver-
leger dem Dichter zur Bedingung: „nicht unter
drei Bänden!" Heute schreibt der Redakteur
dem Litteraten: „nicht über drei Spalten!" Da
mußte die Skizze selbstverständlich die Kunstform
par excellence werden. Sie verdient auch, daß
man ihr viel Gutes nachsagt. Sie ist geschmeidig,
dehnbar, allen Zwecken anzupassen. Sie kann
alles sein und alles enthalten, doch iil Verkürzung,
Zusammendrängung, — andeutungsweise, im-
pressionistisch. Sie kann sich um ein witziges
oder originelles Wort drehen, wie die von dem
jungen Mann, der schon zum zweitenmal um
eine Frau wirbt und sie fragt, ob er ihr denn
nicht genüge; er sei doch ganz annehmbar, nicht
von so üblem Aeußeren und eigentlich recht be-
gabt und sic ihm ungeduldig antwortet: „mais
c’est que j’aime les betes.“ Sie kann eine all-
gemeine Wahrheit illustriren wie die Parabel
von Turgenjew es zeigt, der den lieben Gott
einmal die Tugenden bei sich zu Gast haben
läßt, darunter zwei wunderschöne Damen, die
einander nicht zu kennen schienen. Da führte der
Hausherr sie einander vor. „Die Wohltätig-
keit!" sagte er, auf die eine deutend und „Die
Dankbarkeit!" nannte er die andere. Beide
Tugenden waren im höchsten Grad erstaunt;
denn seit Erschaffung der Welt — und das ist
schon lange her — begegneten sie sich hier zum
erstenmal . . . Gewöhnlich jedoch ist die Skizze
nicht so auf die witzige Pointe gearbeitet. Sie
soll ja eher den Eindruck des Jmprovisirten
machen, des aus dem Moment Geborenen, und
daher mehr durch den kecken Wurf gefallen, durch
die persönliche Auffassung wirken, durch die über-
zeugende Wahrheit fesseln als durch Detail und
Schliff bestechen. Nach ihrer Herkunft dürfte sie
nur Veduten geben, flüchtige Eindrücke, Gesehenes,
Gehörtes fixiren, — eine Figur, eine Situation,
eine Landschaft, ein Gefühl. Wie die Studien-
mappe des Künstlers, müßte sie alles festhalteu,
was der Geist erhascht, Menschen und Milieus,
Einrichtungen und Gebräuche. So sind auch die
berühmten Skizzenbücher von Boz, Irving,
Thackcray entstanden, die Vorbilder zahlloser
anderer, minder berühmter. Diese Skizzenbiicher
bilden die Spähne und Abschnitzel einer großen
dichterischen Thätigkeit; sie sind Hebungen und
Füllsel leerer, aber nicht verlorener Stunden.
Sie enthalten die Welt des Kleinen, Gewöhn-
lichen, Bescheidenen, — die Welt, die jeder kennt,
— das Typische, das Wiederkehrende, — ein
Bild des Lebens, wie es das Jahr herum ge-
lebt wird, mit Lordmayors-Banketten und Wohl-
thätigkeitsfesten und Weihnachtsdiners, mit all
seinen Freuden und Leiden, Hochzeiten, Taufen,
Begräbnissen, Bällen, Wahlen, Hinrichtungen, —
ein Bild der Zeit und des Landes, von Dorf
und von Stadt mit ihren Interessen und Jn-
triguen, ihren Politikern und Kirchspielbclden,
ihren Gewürzkrämern und Gcrngroßen, ihren
Bütteln und Pastoren, alten Jungfern und jungen
Swells, ihren Parvenüs und ihren Snobs, ihren
Weisen und ihren Trunkenbolden, ihren Bettlern
und ihren Königen; — alles findest Du drin,
— die Straßen, die Läden, die Gefängnisse, die
Gerichte, die Boarding-Hänser, die Theater und
Aemter, mit den Typen, , die sie beleben und be-
völkern, geschildert mit dem scharfen Auge, der
leichten Hand und jener Spur von spielender
Phantasie, die aus der Naturabschrift ein Kunst-
werk macht. Der Keim, der in diesen Skizzen
lag, hat sich entivickelt; der Darstellnngskreis
hat sich erweitert; die Phantasie hat sich ihrer
vollständiger bemächtigt, und so ist sie heute
faktisch alles. Sie verdrängt die Novelle; sie
überwältigt das Drama; sie spielt Gedicht. Eine
geniale Begabung ivie die Rudyard Kiplings
bedient sich ihrer, fast ausschließlich ihrer. Aus
abgerissenen Scenen, Situationen, aus verein-
zelten Gestalten, Momenten, aus dem Frappiren-
den, Symptomatischen, aus Farbenflecken und
starken Lichtern baut dieser Dichter mit kühner
Hand ganze Welten auf: Indien, Aegypten, —
England, Amerika, — Krieg, Frieden, Liebe,
Tod, Mittelalter, Gegenwart, die Erde, die Ge-
stirne, das Meer, den Himmel, Eintagsleben,
Seelenwanderung, Menschendasein und Thier-
existenz — gefährlich und lockend wie ein Wunder
und unerbittlich furchtbar wie die Wirklichkeit —
aus Nacht und Tag, ans Entzücken und Ver-
zweiflung, aus Gesehenem und Geträumtem mit
gewaltiger Phantasie zu nie Dagewesenem von
unwiderstehlicher Genialität verwoben. Den gan-
zen Kreis des Darstellbaren hat Kipling in die
Form der Skizze gepreßt, denn blos in Episo-
den, also eigentlich zusammenhangslos und sinn-
los, unverständlich und grandios erscheint ihm
das Schicksal und das Leben. Man sieht das
in seinem Roman „Das versagende Licht" („The
light that failed“) und es ist nur der unbewußte
Ausdruck seiner Weltauffassung, daß auch dieser
Roman der sogenannten Composition ermangelt.
Das Buch besteht aus einer Reihe von Episo-
den, die wie ein Band von edlen, köstlichen Per-
len aneinandergefädelt sind. Aufbau zu irgend
einer Katastrophe, zu einer effektvollen Scene, für
die das Ganze gearbeitet ist, mit fest ineinander-
schließenden, flimmernden, klirrenden Ketten-
gliedern von Motiven —? So erscheint Kipling
das Leben nicht. Es hat seine Katastrophen,
doch ihr Warum ist selten deutlich; es hat seinen
großen Schlnßeffekt im Tod, doch ivie dieser Tod
sich vorbereitet, ivird nicht Schritt für Schritt
sichtbar, und gerade das macht ihn uns noch
interessant. Das Wirre, Zusammenhangslose,
Undeutliche, Episodische des Menschenlooses ist ftir
Kipling das Anziehende des Lebens. Darin ist
er der moderne Mensch. DaS ist seine Auf-