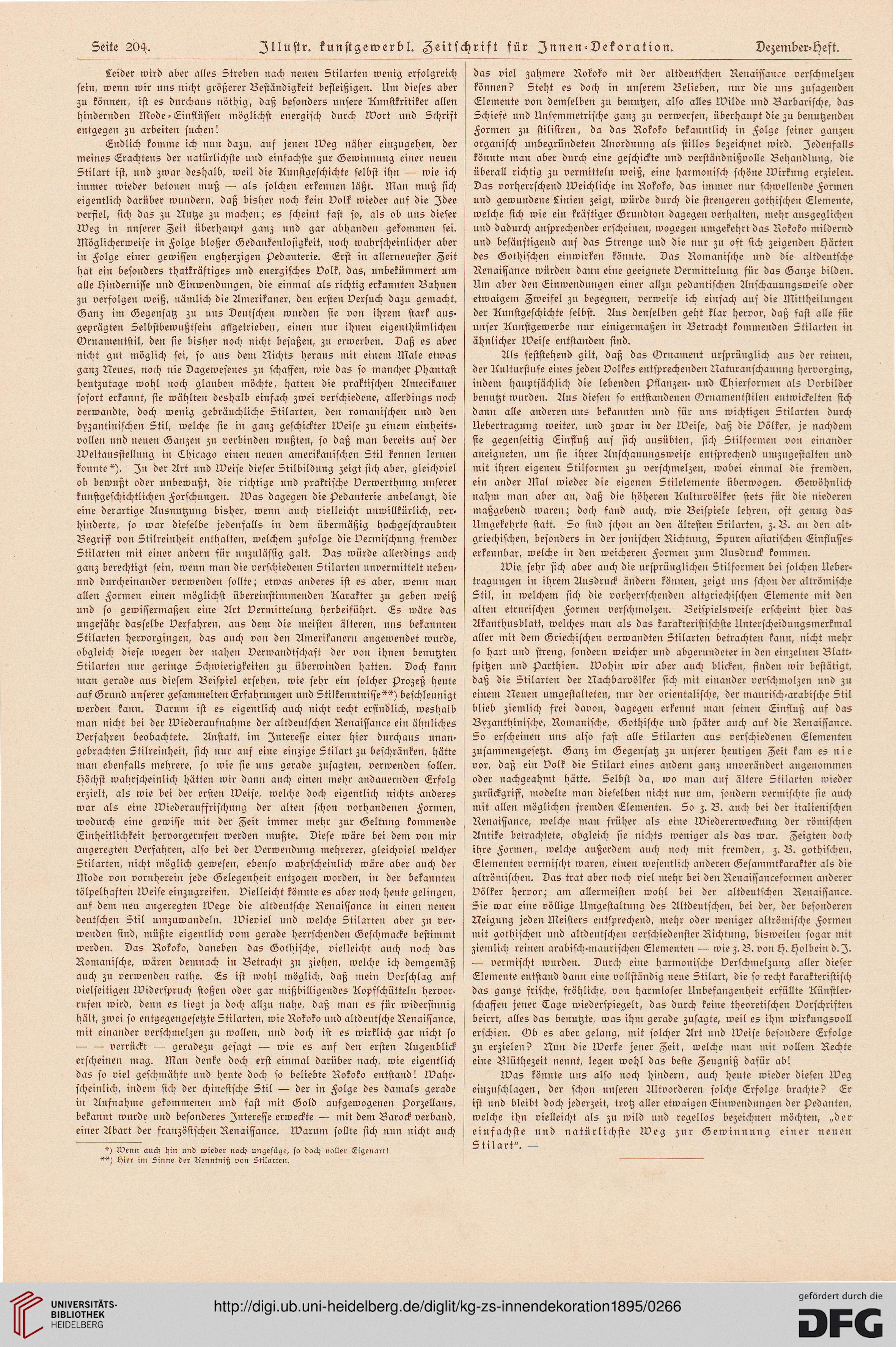Seite 20H.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Dezember-kfeft.
Leider wird aber alles Streben nach neuen Stilarten wenig erfolgreich
sein, wenn wir uns nicht größerer Beständigkeit befleißigen. Um dieses aber
zu können, ist es durchaus nöthig, daß besonders unsere Kunstkritiker allen
hindernden Mode > Einflüssen möglichst energisch durch Wort und Schrift
entgegen zu arbeiten suchen!
Endlich komme ich nun dazu, auf jenen Weg näher einzugehen, der
meines Erachtens der natürlichste und einfachste zur Gewinnung einer neuen
Stilart ist, und zwar deshalb, weil die Kunstgeschichte selbst ihn — wie ich
immer wieder betonen muß — als solchen erkennen läßt. Man muß sich
eigentlich darüber wundern, daß bisher noch kein Volk wieder auf die Idee
verfiel, sich das zu Nutze zu machen; es scheint fast so, als ob uns dieser
Weg in unserer Zeit überhaupt ganz und gar abhanden gekommen sei.
Möglicherweise in Folge bloßer Gedankenlosigkeit, noch wahrscheinlicher aber
in Folge einer gewissen engherzigen Pedanterie. Erst in allerneuester Zeit
hat ein besonders thatkrästiges und energisches Volk, das, unbekümmert um
alle Hindernisse und Einwendungen, die einmal als richtig erkannten Bahnen
zu verfolgen weiß, nämlich die Amerikaner, den ersten Versuch dazu gemacht.
Ganz im Gegensatz zu uns Deutschen wurden sie von ihrem stark aus-
geprägten Selbstbewußtsein abgetrieben, einen nur ihnen eigenthümlichen
Mrnamentstil, den sie bisher noch nicht besaßen, zu erwerben. Daß es aber
nicht gut möglich sei, so aus dem Nichts heraus mit einem Male etwas
ganz Neues, noch nie Dagewesenes zu schaffen, wie das so mancher Phantast
heutzutage wohl noch glauben möchte, hatten die praktischen Amerikaner
sofort erkannt, sie wählten deshalb einfach zwei verschiedene, allerdings noch
verwandte, doch wenig gebräuchliche Stilarten, den romanischen und den
byzantinischen Stil, welche sie in ganz geschickter Weise zu einem einheits-
vollen und neuen Ganzen zu verbinden wußten, so daß man bereits auf der
Weltausstellung in Lhicago einen neuen amerikanischen Stil kennen lernen
konnte*). In der Art und Weise dieser Stilbildung zeigt sich aber, gleichviel
ob bewußt oder unbewußt, die richtige und praktische verwerthung unserer
kunstgeschichtlichen Forschungen. Was dagegen die Pedanterie anbelangt, die
eine derartige Ausnutzung bisher, wenn auch vielleicht unwillkürlich, ver-
hinderte, so war dieselbe jedenfalls in dem übermäßig hochgeschraubten
Begriff von Stilreinheit enthalten, welchem zufolge die Vermischung fremder
Stilarten mit einer andern für unzulässig galt. Das würde allerdings auch
ganz berechtigt sein, wenn man die verschiedenen Stilarten unvermittelt neben-
und durcheinander verwenden sollte; etwas anderes ist es aber, wenn man
allen Formen einen möglichst übereinstimmenden Karakter zu geben weiß
und so gewissermaßen eine Art Vermittelung herbeiführt. Ls wäre das
ungefähr dasselbe Verfahren, aus dem die meisten älteren, uns bekannten
Stilarten hervorgingen, das auch von den Amerikanern angewendet wurde,
obgleich diese wegen der nahen Verwandtschaft der von ihnen benutzten
Stilarten nur geringe Schwierigkeiten zu überwinden hatten. Doch kann
man gerade aus diesem Beispiel ersehen, wie sehr ein solcher Prozeß heute
auf Grund unserer gesammelten Erfahrungen und Stilkenntnisse**) beschleunigt
werden kann. Darum ist es eigentlich auch nicht recht erfindlich, weshalb
man nicht bei der Wiederaufnahme der altdeutschen Renaissance ein ähnliches
Verfahren beobachtete. Anstatt, im Interesse einer hier durchaus unan-
gebrachten Stilreinheit, sich nur auf eine einzige Stilart zu beschränken, hätte
man ebenfalls mehrere, so wie sie uns gerade zusagten, verwenden sollen.
Höchst wahrscheinlich hätten wir dann auch einen mehr andauernden Erfolg
erzielt, als wie bei der ersten Weise, welche doch eigentlich nichts anderes
war als eine Wiederauffrischung der alten schon vorhandenen Formen,
wodurch eine gewisse mit der Zeit immer mehr zur Geltung kommende
Einheitlichkeit hervorgerufen werden mußte. Diese wäre bei dem von mir
angeregten Verfahren, also bei der Verwendung mehrerer, gleichviel welcher
Stilarten, nicht möglich gewesen, ebenso wahrscheinlich wäre aber auch der
Mode von vornherein jede Gelegenheit entzogen worden, in der bekannten
tölpelhaften Weise einzugreisen. Vielleicht könnte es aber noch heute gelingen,
auf dein neu angeregten Wege die altdeutsche Renaissance in einen neuen
deutschen Stil umzuwandeln. Wieviel und welche Stilarten aber zu ver-
wenden sind, müßte eigentlich vom gerade herrschenden Geschmacks bestimmt
werden. Das Rokoko, daneben das Gothische, vielleicht auch noch das
Romanische, wären demnach in Betracht zu ziehen, welche ich demgemäß
auch zu verwenden rathe. Es ist wohl möglich, daß mein Vorschlag auf
vielseitigen Widerspruch stoßen oder gar mißbilligendes Koxfschütteln hervor-
rufen wird, denn es liegt ja doch allzu nahe, daß mau es für widersinnig
hält, zwei so entgegengesetzte Stilarten, wie Rokoko und altdeutsche Renaissance,
mit einander verschmelzen zu wollen, und doch ist es wirklich gar nicht so
-verrückt — geradezu gesagt — wie es ans den ersten Augenblick
erscheinen mag. Man denke doch erst einmal darüber nach, wie eigentlich
das so viel geschmähte und heute doch so beliebte Rokoko entstand! Wahr-
scheinlich, indem sich der chinesische Stil — der in Folge des damals gerade
in Aufnahme gekommenen und fast mit Gold ausgewogenen Porzellans,
bekannt wurde und besonderes Interesse erweckte — mit dem Barock verband,
einer Abart der französischen Renaissance. Warum sollte sich nun nicht auch
das viel zahmere Rokoko mit der altdeutschen Renaissance verschmelzen
können? Steht es doch in unserem Belieben, nur die uns zusagenden
Elemente von demselben zu benutzen, also alles Wilde und Barbarische, das
Schiefe und Unsymmetrische ganz zu verwerfen, überhaupt die zu benutzenden
Formen zu stilisiren, da das Rokoko bekanntlich in Folge seiner ganzen
organisch unbegründeten Anordnung als stillos bezeichnet wird. Jedenfalls
könnte man aber durch eine geschickte und verständnißvolle Behandlung, die
überall richtig zu vermitteln weiß, eine harmonisch schöne Wirkung erzielen.
Das vorherrschend Weichliche im Rokoko, das immer nur schwellende Formen
und gewundene Linien zeigt, würde durch die strengeren gothischen Elemente,
welche sich wie ein kräftiger Grundton dagegen verhalten, mehr ausgeglichen
und dadurch ansprechender erscheinen, wogegen umgekehrt das Rokoko mildernd
und besänftigend auf das Strenge und die nur zu oft sich zeigenden Härten
des Gothischen einwirken könnte. Das Romanische und die altdeutsche
Renaissance würden daun eine geeignete Vermittelung für das Ganze bilden.
Um aber den Einwendungen einer allzu pedantischen Anschauungsweise oder
etwaigem Zweifel zu begegnen, verweise ich einfach aus die Mittheilungen
der Kunstgeschichte selbst. Aus denselben geht klar hervor, daß fast alle für
unser Kunstgewerbe nur einigermaßen in Betracht kommenden Stilarten in
ähnlicher Weise entstanden sind.
Als feststehend gilt, daß das (Ornament ursprünglich aus der reine»,
der Kulturstufe eines jeden Volkes entsprechenden Naturanschauung hervorging,
indem hauptsächlich die lebenden Pflanzen- und Thierformen als Vorbilder
benutzt wurden. Aus diesen so entstandenen Grnamentstilen entwickelten sich
dann alle anderen uns bekannten und für uns wichtigen Stilarten durch
Uebertraguug weiter, und zwar in der weise, daß die Völker, je nachdem
sie gegenseitig Einfluß auf sich ausübten, sich Stilformen von einander
aneigneten, um sie ihrer Anschauungsweise entsprechend umzugestalten und
mit ihren eigenen Stilformen zu verschmelzen, wobei einmal die fremden,
ein ander Mal wieder die eigenen Stilelemente überwogen. Gewöhnlich
nahm man aber an, daß die höheren Kulturvölker stets für die niederen
maßgebend waren; doch fand auch, wie Beispiele lehren, oft genug das
Umgekehrte statt. So sind schon an den ältesten Stilarten, z. B. an den alt-
griechischen, besonders in der jonischen Richtung, Spuren asiatischen Einflusses
erkennbar, welche in den weicheren Formen zum Ausdruck kommen.
wie sehr sich aber auch die ursprünglichen Stilformen bei solchen Ueber-
tragungen in ihrem Ausdruck ändern können, zeigt uns schon der altrömische
Stil, in welchem sich die vorherrschenden altgriechischen Elemente mit den
alten etrurischen Formen verschmolzen. Beispielsweise erscheint hier das
Akanthusblatt, welches man als das karakteristischste Unterscheidungsmerkmal
aller mit dem Griechischen verwandten Stilarten betrachten kann, nicht mehr
so hart und streng, sondern weicher und abgerundeter in den einzelnen Blatt-
spitzen und parthien. Wohin wir aber auch blicken, finden wir bestätigt,
daß die Stilarten der Nachbarvölker sich mit einander verschmolzen und zu
einem Neuen umgestalteten, nur der orientalische, der maurisch-arabische Stil
blieb ziemlich frei davon, dagegen erkennt man seinen Einfluß auf das
Byzanthinische, Romanische, Gothische und später auch auf die Renaissance.
So erscheinen uns also fast alle Stilarten aus verschiedenen Elementen
zusammengesetzt. Ganz im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit kam es nie
vor, daß ein Volk die Stilart eines andern ganz unverändert angenommen
oder nachgeahmt hätte. Selbst da, wo man auf ältere Stilarten wieder
zurückgriff, modelte man dieselben nicht nur um, sondern vermischte sie auch
mit allen möglichen fremden Elementen. So z. B. auch bei der italienischen
Renaissance, welche man früher als eine Wiedererweckung der römischen
Antike betrachtete, obgleich sie nichts weniger als das war. Zeigten doch
ihre Formen, welche außerdem auch noch mit fremden, z. B. gothischen,
Elementen vermischt waren, einen wesentlich anderen Gesammtkarakter als die
altrömischen. Das trat aber noch viel mehr bei den Renaissanceformen anderer
Völker hervor; am allermeisten wohl bei der altdeutschen Renaissance.
Sie war eine völlige Umgestaltung des Altdeutschen, bei der, der besonderen
Neigung jeden Meisters entsprechend, mehr oder weniger altrömische Formen
mit gothischen und altdeutschen verschiedenster Richtung, bisweilen sogar mit
ziemlich reinen arabisch-maurischen Elementen — wie z. B. von H. Holbein d.I.
— vermischt wurden. Durch eine harmonische Verschmelzung aller dieser
Elemente entstand dann eine vollständig neue Stilart, die so recht karakteristisch
das ganze frische, fröhliche, von harmloser Unbefangenheit erfüllte Künstler-
schaffen jener Tage wiederspiegelt, das durch keine theoretischen Vorschriften
beirrt, alles das benutzte, was ihm gerade zusagte, weil es ihm wirkungsvoll
erschien. Bb es aber gelang, mit solcher Art und Weise besondere Erfolge
zu erzielen? Nun die Werke jener Zeit, welche man mit vollem Rechte
eine Llüthezeit nennt, legen wohl das beste Zeugniß dafür ab!
was könnte uns also noch hindern, auch heute wieder diesen Weg
einzuschlagen, der schon unseren Altoorderen solche Erfolge brachte? Er
ist und bleibt doch jederzeit, trotz aller etwaigen Einwendungen der Pedanten,
welche ihn vielleicht als zu wild und regellos bezeichnen möchten, „der
einfachste und natürlichste Weg zur Gewinnung einer neuen
Stilart". —
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Dezember-kfeft.
Leider wird aber alles Streben nach neuen Stilarten wenig erfolgreich
sein, wenn wir uns nicht größerer Beständigkeit befleißigen. Um dieses aber
zu können, ist es durchaus nöthig, daß besonders unsere Kunstkritiker allen
hindernden Mode > Einflüssen möglichst energisch durch Wort und Schrift
entgegen zu arbeiten suchen!
Endlich komme ich nun dazu, auf jenen Weg näher einzugehen, der
meines Erachtens der natürlichste und einfachste zur Gewinnung einer neuen
Stilart ist, und zwar deshalb, weil die Kunstgeschichte selbst ihn — wie ich
immer wieder betonen muß — als solchen erkennen läßt. Man muß sich
eigentlich darüber wundern, daß bisher noch kein Volk wieder auf die Idee
verfiel, sich das zu Nutze zu machen; es scheint fast so, als ob uns dieser
Weg in unserer Zeit überhaupt ganz und gar abhanden gekommen sei.
Möglicherweise in Folge bloßer Gedankenlosigkeit, noch wahrscheinlicher aber
in Folge einer gewissen engherzigen Pedanterie. Erst in allerneuester Zeit
hat ein besonders thatkrästiges und energisches Volk, das, unbekümmert um
alle Hindernisse und Einwendungen, die einmal als richtig erkannten Bahnen
zu verfolgen weiß, nämlich die Amerikaner, den ersten Versuch dazu gemacht.
Ganz im Gegensatz zu uns Deutschen wurden sie von ihrem stark aus-
geprägten Selbstbewußtsein abgetrieben, einen nur ihnen eigenthümlichen
Mrnamentstil, den sie bisher noch nicht besaßen, zu erwerben. Daß es aber
nicht gut möglich sei, so aus dem Nichts heraus mit einem Male etwas
ganz Neues, noch nie Dagewesenes zu schaffen, wie das so mancher Phantast
heutzutage wohl noch glauben möchte, hatten die praktischen Amerikaner
sofort erkannt, sie wählten deshalb einfach zwei verschiedene, allerdings noch
verwandte, doch wenig gebräuchliche Stilarten, den romanischen und den
byzantinischen Stil, welche sie in ganz geschickter Weise zu einem einheits-
vollen und neuen Ganzen zu verbinden wußten, so daß man bereits auf der
Weltausstellung in Lhicago einen neuen amerikanischen Stil kennen lernen
konnte*). In der Art und Weise dieser Stilbildung zeigt sich aber, gleichviel
ob bewußt oder unbewußt, die richtige und praktische verwerthung unserer
kunstgeschichtlichen Forschungen. Was dagegen die Pedanterie anbelangt, die
eine derartige Ausnutzung bisher, wenn auch vielleicht unwillkürlich, ver-
hinderte, so war dieselbe jedenfalls in dem übermäßig hochgeschraubten
Begriff von Stilreinheit enthalten, welchem zufolge die Vermischung fremder
Stilarten mit einer andern für unzulässig galt. Das würde allerdings auch
ganz berechtigt sein, wenn man die verschiedenen Stilarten unvermittelt neben-
und durcheinander verwenden sollte; etwas anderes ist es aber, wenn man
allen Formen einen möglichst übereinstimmenden Karakter zu geben weiß
und so gewissermaßen eine Art Vermittelung herbeiführt. Ls wäre das
ungefähr dasselbe Verfahren, aus dem die meisten älteren, uns bekannten
Stilarten hervorgingen, das auch von den Amerikanern angewendet wurde,
obgleich diese wegen der nahen Verwandtschaft der von ihnen benutzten
Stilarten nur geringe Schwierigkeiten zu überwinden hatten. Doch kann
man gerade aus diesem Beispiel ersehen, wie sehr ein solcher Prozeß heute
auf Grund unserer gesammelten Erfahrungen und Stilkenntnisse**) beschleunigt
werden kann. Darum ist es eigentlich auch nicht recht erfindlich, weshalb
man nicht bei der Wiederaufnahme der altdeutschen Renaissance ein ähnliches
Verfahren beobachtete. Anstatt, im Interesse einer hier durchaus unan-
gebrachten Stilreinheit, sich nur auf eine einzige Stilart zu beschränken, hätte
man ebenfalls mehrere, so wie sie uns gerade zusagten, verwenden sollen.
Höchst wahrscheinlich hätten wir dann auch einen mehr andauernden Erfolg
erzielt, als wie bei der ersten Weise, welche doch eigentlich nichts anderes
war als eine Wiederauffrischung der alten schon vorhandenen Formen,
wodurch eine gewisse mit der Zeit immer mehr zur Geltung kommende
Einheitlichkeit hervorgerufen werden mußte. Diese wäre bei dem von mir
angeregten Verfahren, also bei der Verwendung mehrerer, gleichviel welcher
Stilarten, nicht möglich gewesen, ebenso wahrscheinlich wäre aber auch der
Mode von vornherein jede Gelegenheit entzogen worden, in der bekannten
tölpelhaften Weise einzugreisen. Vielleicht könnte es aber noch heute gelingen,
auf dein neu angeregten Wege die altdeutsche Renaissance in einen neuen
deutschen Stil umzuwandeln. Wieviel und welche Stilarten aber zu ver-
wenden sind, müßte eigentlich vom gerade herrschenden Geschmacks bestimmt
werden. Das Rokoko, daneben das Gothische, vielleicht auch noch das
Romanische, wären demnach in Betracht zu ziehen, welche ich demgemäß
auch zu verwenden rathe. Es ist wohl möglich, daß mein Vorschlag auf
vielseitigen Widerspruch stoßen oder gar mißbilligendes Koxfschütteln hervor-
rufen wird, denn es liegt ja doch allzu nahe, daß mau es für widersinnig
hält, zwei so entgegengesetzte Stilarten, wie Rokoko und altdeutsche Renaissance,
mit einander verschmelzen zu wollen, und doch ist es wirklich gar nicht so
-verrückt — geradezu gesagt — wie es ans den ersten Augenblick
erscheinen mag. Man denke doch erst einmal darüber nach, wie eigentlich
das so viel geschmähte und heute doch so beliebte Rokoko entstand! Wahr-
scheinlich, indem sich der chinesische Stil — der in Folge des damals gerade
in Aufnahme gekommenen und fast mit Gold ausgewogenen Porzellans,
bekannt wurde und besonderes Interesse erweckte — mit dem Barock verband,
einer Abart der französischen Renaissance. Warum sollte sich nun nicht auch
das viel zahmere Rokoko mit der altdeutschen Renaissance verschmelzen
können? Steht es doch in unserem Belieben, nur die uns zusagenden
Elemente von demselben zu benutzen, also alles Wilde und Barbarische, das
Schiefe und Unsymmetrische ganz zu verwerfen, überhaupt die zu benutzenden
Formen zu stilisiren, da das Rokoko bekanntlich in Folge seiner ganzen
organisch unbegründeten Anordnung als stillos bezeichnet wird. Jedenfalls
könnte man aber durch eine geschickte und verständnißvolle Behandlung, die
überall richtig zu vermitteln weiß, eine harmonisch schöne Wirkung erzielen.
Das vorherrschend Weichliche im Rokoko, das immer nur schwellende Formen
und gewundene Linien zeigt, würde durch die strengeren gothischen Elemente,
welche sich wie ein kräftiger Grundton dagegen verhalten, mehr ausgeglichen
und dadurch ansprechender erscheinen, wogegen umgekehrt das Rokoko mildernd
und besänftigend auf das Strenge und die nur zu oft sich zeigenden Härten
des Gothischen einwirken könnte. Das Romanische und die altdeutsche
Renaissance würden daun eine geeignete Vermittelung für das Ganze bilden.
Um aber den Einwendungen einer allzu pedantischen Anschauungsweise oder
etwaigem Zweifel zu begegnen, verweise ich einfach aus die Mittheilungen
der Kunstgeschichte selbst. Aus denselben geht klar hervor, daß fast alle für
unser Kunstgewerbe nur einigermaßen in Betracht kommenden Stilarten in
ähnlicher Weise entstanden sind.
Als feststehend gilt, daß das (Ornament ursprünglich aus der reine»,
der Kulturstufe eines jeden Volkes entsprechenden Naturanschauung hervorging,
indem hauptsächlich die lebenden Pflanzen- und Thierformen als Vorbilder
benutzt wurden. Aus diesen so entstandenen Grnamentstilen entwickelten sich
dann alle anderen uns bekannten und für uns wichtigen Stilarten durch
Uebertraguug weiter, und zwar in der weise, daß die Völker, je nachdem
sie gegenseitig Einfluß auf sich ausübten, sich Stilformen von einander
aneigneten, um sie ihrer Anschauungsweise entsprechend umzugestalten und
mit ihren eigenen Stilformen zu verschmelzen, wobei einmal die fremden,
ein ander Mal wieder die eigenen Stilelemente überwogen. Gewöhnlich
nahm man aber an, daß die höheren Kulturvölker stets für die niederen
maßgebend waren; doch fand auch, wie Beispiele lehren, oft genug das
Umgekehrte statt. So sind schon an den ältesten Stilarten, z. B. an den alt-
griechischen, besonders in der jonischen Richtung, Spuren asiatischen Einflusses
erkennbar, welche in den weicheren Formen zum Ausdruck kommen.
wie sehr sich aber auch die ursprünglichen Stilformen bei solchen Ueber-
tragungen in ihrem Ausdruck ändern können, zeigt uns schon der altrömische
Stil, in welchem sich die vorherrschenden altgriechischen Elemente mit den
alten etrurischen Formen verschmolzen. Beispielsweise erscheint hier das
Akanthusblatt, welches man als das karakteristischste Unterscheidungsmerkmal
aller mit dem Griechischen verwandten Stilarten betrachten kann, nicht mehr
so hart und streng, sondern weicher und abgerundeter in den einzelnen Blatt-
spitzen und parthien. Wohin wir aber auch blicken, finden wir bestätigt,
daß die Stilarten der Nachbarvölker sich mit einander verschmolzen und zu
einem Neuen umgestalteten, nur der orientalische, der maurisch-arabische Stil
blieb ziemlich frei davon, dagegen erkennt man seinen Einfluß auf das
Byzanthinische, Romanische, Gothische und später auch auf die Renaissance.
So erscheinen uns also fast alle Stilarten aus verschiedenen Elementen
zusammengesetzt. Ganz im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit kam es nie
vor, daß ein Volk die Stilart eines andern ganz unverändert angenommen
oder nachgeahmt hätte. Selbst da, wo man auf ältere Stilarten wieder
zurückgriff, modelte man dieselben nicht nur um, sondern vermischte sie auch
mit allen möglichen fremden Elementen. So z. B. auch bei der italienischen
Renaissance, welche man früher als eine Wiedererweckung der römischen
Antike betrachtete, obgleich sie nichts weniger als das war. Zeigten doch
ihre Formen, welche außerdem auch noch mit fremden, z. B. gothischen,
Elementen vermischt waren, einen wesentlich anderen Gesammtkarakter als die
altrömischen. Das trat aber noch viel mehr bei den Renaissanceformen anderer
Völker hervor; am allermeisten wohl bei der altdeutschen Renaissance.
Sie war eine völlige Umgestaltung des Altdeutschen, bei der, der besonderen
Neigung jeden Meisters entsprechend, mehr oder weniger altrömische Formen
mit gothischen und altdeutschen verschiedenster Richtung, bisweilen sogar mit
ziemlich reinen arabisch-maurischen Elementen — wie z. B. von H. Holbein d.I.
— vermischt wurden. Durch eine harmonische Verschmelzung aller dieser
Elemente entstand dann eine vollständig neue Stilart, die so recht karakteristisch
das ganze frische, fröhliche, von harmloser Unbefangenheit erfüllte Künstler-
schaffen jener Tage wiederspiegelt, das durch keine theoretischen Vorschriften
beirrt, alles das benutzte, was ihm gerade zusagte, weil es ihm wirkungsvoll
erschien. Bb es aber gelang, mit solcher Art und Weise besondere Erfolge
zu erzielen? Nun die Werke jener Zeit, welche man mit vollem Rechte
eine Llüthezeit nennt, legen wohl das beste Zeugniß dafür ab!
was könnte uns also noch hindern, auch heute wieder diesen Weg
einzuschlagen, der schon unseren Altoorderen solche Erfolge brachte? Er
ist und bleibt doch jederzeit, trotz aller etwaigen Einwendungen der Pedanten,
welche ihn vielleicht als zu wild und regellos bezeichnen möchten, „der
einfachste und natürlichste Weg zur Gewinnung einer neuen
Stilart". —