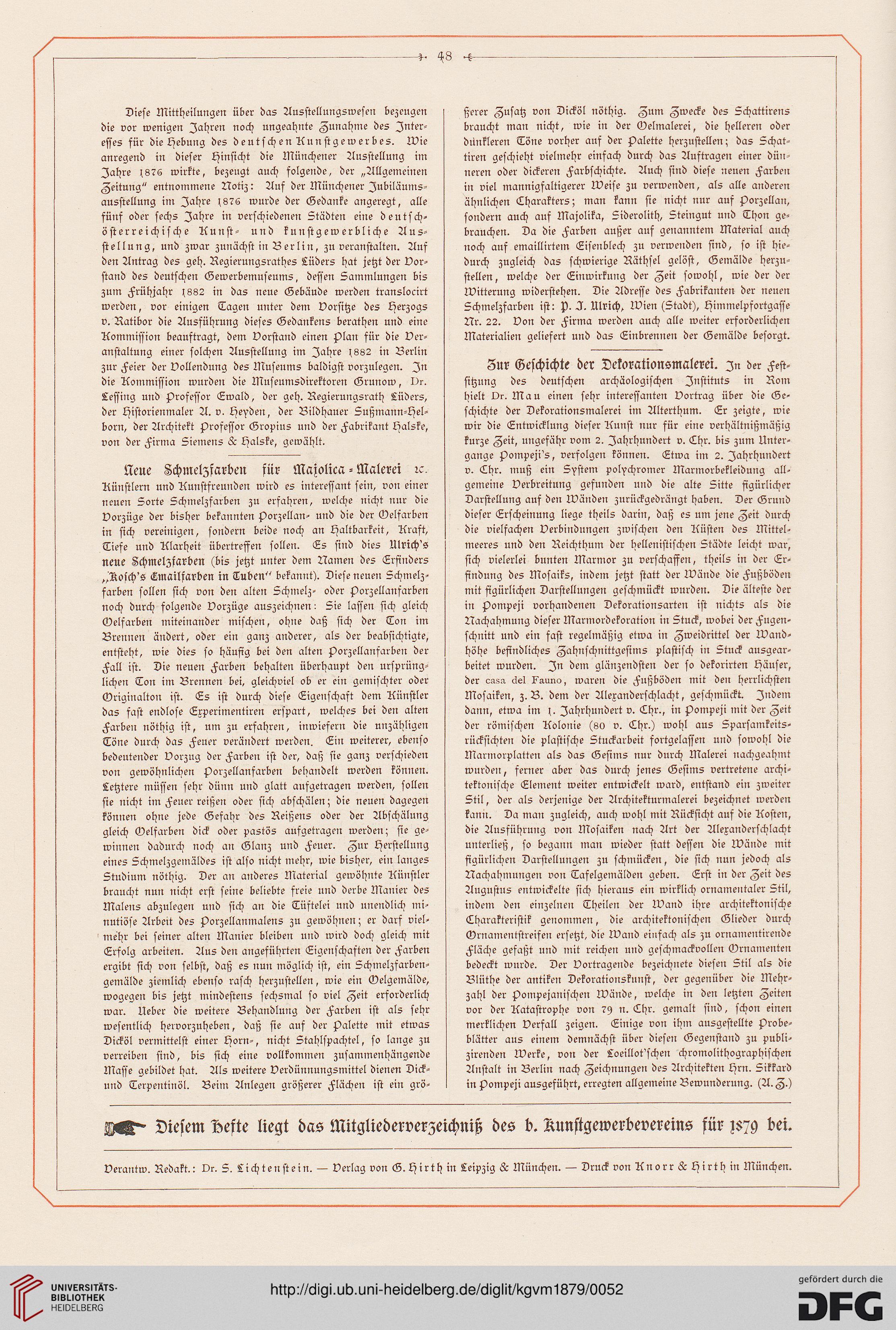4- ^8 ~i
Diese Mittheilungen über das Ausstellungswesen bezeugen
die vor wenigen Jahren noch ungeahnte Zunahme des Inter-
esses für die kfebung des deutsch en Runstgew erb es. Wie
anregend in dieser Hinsicht die Münchener Ausstellung im
Jahre ;876 wirkte, bezeugt auch folgende, der „Allgemeinen
Zeitung" entnommene Notiz: Auf der Münchener Jubiläums-
ausstellung int Jahre ;876 wurde der Gedanke angeregt, alle
fünf oder sechs Jahre in verschiedenen Städten eine deutsch,
ö st e r r e i ch i s ch e K u n st - und k u n st g e w e r b l i ch e A u s-
ftellung, und zwar zunächst in Berlin, zu veranstalten. Auf
den Antrag des geh. Regierungsrathes Lüders hat jetzt der Vor-
stand des deutschen Gewerbemuseums, dessen Sammlungen bis
zum Frühjahr J882 j,as neue Gebäude werden translocirt
werden, vor einigen Tagen unter dem Vorsitze des Herzogs
v. Ratibor die Ausführung dieses Gedankens berathen und eine
Kommission beauftragt, dem Vorstand einen plan für die Ver-
anstaltung einer solchen Ausstellung im Jahre ^882 in Berlin
zur Feier der Vollendung des Museums baldigst vorzulegen. In
die Kommission wurden die Museumsdirektoren Grunow, Vr.
Lessing und Professor Ewald, der geh. Regierungsrath Lüders,
der Historienmaler A. v. Heyden, der Bildhauer Sußmann-Hel-
born, der Architekt Professor Gropius und der Fabrikant Halske,
von der Firma Siemens & Halske, gewählt.
Neue Jchnrelzfarbeu für Majolica - Malerei ic.
Künstlern und Kunstfreunden wird es interessant sein, von einer
neuen Sorte Schmelzfarben zu erfahren, welche nicht nur die
Vorzüge der bisher bekannten Porzellan- und die der Delfarben
in sich vereinigen, sondern beide noch an Haltbarkeit, Kraft,
Tiefe und Klarheit übertressen sollen. Ls sind dies Ulrich's
neue Zchmelzfarben (bis jetzt unter dem Namen des Erfinders
„Kosch's Emailfarben in Tuben" bekannt). Diese neuen Schmelz,
färben sollen sich von den alten Schmelz- oder Porzellanfarben
noch durch folgende Vorzüge auszeichnen: Sie lassen sich gleich
Gelfarben miteinander mischen, ohne daß sich der Ton im
Brennen ändert, oder ein ganz anderer, als der beabsichtigte,
entsteht, wie dies so häufig bei den alten Porzellanfarben der
Fall ist. Die neuen Farben behalten überhaupt den ursprüng-
lichen Ton im Brennen bei, gleichviel ob er ein gemischter oder
Griginalton ist. Es ist durch diese Eigenschaft dem Künstler
das fast endlose Erperimentiren erspart, welches bei den alten
Farben nöthig ist, um zu erfahren, inwiefern die unzähligen
Töne durch das Feuer verändert werden. Ein weiterer, ebenso
bedeutender Vorzug der Farben ist der, daß sie ganz verschieden
von gewöhnlichen Porzellanfarben behandelt werden können.
Letztere müssen sehr dünn und glatt aufgetragen werden, sollen
sie nicht im Feuer reißen oder sich abschälen; die neuen dagegen
können ohne jede Gefahr des Reißens oder der Abschälung
gleich Gelsarben dick oder pastös aufgetragen werden; sie ge-
winnen dadurch noch an Glanz und Feuer. Zur Herstellung
eines Schmelzgemäldes ist also nicht mehr, wie bisher, ein langes
Studium nöthig. Der an anderes Material gewöhnte Künstler
braucht nun nicht erst seine beliebte freie und derbe Manier des
Malens abzulegen und sich an die Tüftelei und unendlich mi-
nutiöse Arbeit des Porzellanmalens zu gewöhnen; er darf viel-
mehr bei seiner alten Manier bleiben und wird doch gleich mit
Erfolg arbeiten. Aus den angeführten Eigenschaften der Farben
ergibt sich von selbst, daß es nun möglich ist, ein Schmelzfarben-
gemälde ziemlich ebenso rasch herzustellen, wie ein Gelgemälde,
wogegen bis jetzt mindestens sechsmal so viel Zeit erforderlich
war. lieber die weitere Behandlung der Farben ist als sehr
wesentlich hervorzuheben, daß sie auf der Palette mit etwas
Dicköl vermittelst einer Horn-, nicht Stahlspachtel, so lange zu
verreiben sind, bis sich eine vollkommen zusammenhängende
Masse gebildet hat. Als weitere Verdünnungsmittel dienen Dick-
und Terpentinöl. Beim Anlegen größerer Flächen ist ein grö-
ßerer Zusatz von Dicköl nöthig. Zum Zwecke des Schattirens
braucht man nicht, wie in der Gelmalerei, die helleren oder
dünkleren Töne vorher auf der Palette herzustellen; das Schat-
tiren geschieht vielmehr einfach durch das Aufträgen einer dün-
neren oder dickeren Farbfchichte. Auch find diese neuen Farben
in viel mannigfaltigerer Weise zu verwenden, als alle anderen
ähnlichen Lharakters; man kann sie nicht nur auf Porzellan,
sondern auch auf Majolika, Siderolith, Steingut und Thon ge-
brauchen. Da die Farben außer auf genanntem Material auch
noch auf emaillirtem Eisenblech zu verwenden sind, so ist hie-
durch zugleich das schwierige Räthsel gelöst, Gemälde herzu-
stellen, welche der Einwirkung der Zeit sowohl, wie der der
Witterung widerstehen. Die Adresse des Fabrikanten der neuen
Schmelzfarben ist: p. A. Ulrich, Wien (Stadt), Himmelpfortgaffe
Nr. 22. von der Firma werden auch alle weiter erforderlichen
Materialien geliefert und das Einbrennen der Gemälde besorgt.
Zur Geschichte der Dekorationsmalerei. In der Fest-
sitzung des deutschen archäologischen Instituts in Rom
hielt Or. Mau einen sehr interessanten Vortrag über die Ge-
schichte der Dekorationsmalerei im Alterthum. Er zeigte, wie
wir die Entwicklung dieser Kunst nur für eine verhältnißmäßig
kurze Zeit, ungefähr vom 2. Jahrhundert v. Ehr. bis zum Unter-
gänge pomxeji's, verfolgen können. Etwa im 2. Jahrhundert
v. Ehr. muß ein System polychromer Marmorbekleidung all-
gemeine Verbreitung gefunden und die alte Sitte figürlicher
Darstellung auf den Wänden zurückgedrängt haben. Der Grund
dieser Erscheinung liege theils darin, daß es um jene Zeit durch
die vielfachen Verbindungen zwischen den Küsten des Mittel-
meeres und den Reichthum der hellenistischen Städte leicht war,
sich vielerlei bunten Marmor zu verschaffen, theils in der Er-
findung des Mosaiks, indem jetzt statt der Wände die Fußböden
mit figürlichen Darstellungen geschmückt wurden. Die älteste der
in Pompeji vorhandenen Dekorationsarten ist nichts als die
Nachahmung dieser Marmordekoration in Stuck, wobei der Fugen-
schnitt und ein fast regelmäßig etwa in Zweidrittel der Wand-
höhe befindliches Zahnschnittgesims plastisch in Stuck ausgear-
beitet wurden. In dem glänzendsten der so dekorirten Häuser,
der casa del Fauno, waren die Fußböden mit den herrlichsten
Mosaiken, z. B. dem der Alexanderschlacht, geschmückt. Indem
dann, etwa im Jahrhundert v. Ehr., in Pompeji mit der Zeit
der römischen Kolonie (80 v. Ehr.) wohl aus Sparsamkeits-
rücksichten die plastische Stückarbeit fortgelassen und sowohl die
Marrnorplatten als das Gesims nur durch Malerei nachgeahmt
wurden, ferner aber das durch jenes Gesims vertretene archi-
tektonische Element weiter entwickelt ward, entstand ein zweiter
Stil, der als derjenige der Architekturmalerei bezeichnet werden
kann. Da man zugleich, auch wohl mit Rücksicht auf die Kosten,
die Ausführung von Mosaiken nach Art der Alexanderschlacht
unterließ, so begann man wieder statt dessen die Wände mit
figürlichen Darstellungen zu schmücken, die sich nun jedoch als
Nachahmungen von Tafelgemälden geben. Erst in der Zeit des
Augustus entwickelte sich hieraus ein wirklich ornamentaler Stil,
indem den einzelnen Theilen der Wand ihre architektonische
Lharakteristik genommen, die architektonischen Glieder durch
Drnamentstreifen ersetzt, die Wand einfach als zu ornamentirende
Fläche gefaßt und mit reichen und geschmackvollen Drnamenten
bedeckt wurde. Der Vortragende bezeichnete diesen Stil als die
Blüthe der antiken Dekorationskunst, der gegenüber die Mehr-
zahl der Pompejanischen Wände, welche in den letzten Zeiten
vor der Katastrophe von 79 n. Ehr. gemalt sind, schon einen
rnerklichen verfall zeigen. Einige von ihm ausgestellte probe-
blätter aus einem demnächst über diesen Gegenstand zu xubli-
zirenden Werke, von der Loeillot'schen chromolithographischen
Anstalt in Berlin nach Zeichnungen des Architekten Hrn. Sikkard
in Pompeji ausgeführt, erregten allgemeine Bewunderung. (A. Z.)
WZ- Diesem Defte liegt das Mtgliederverzeichniß des b. Kunstgewerbevereins für bei.
verantw. Redakt.: vr. S. Lichtenstein. — Verlag von G.Hirth in Leipzig & München. — Druck von Knorr & Hirth in München.
Diese Mittheilungen über das Ausstellungswesen bezeugen
die vor wenigen Jahren noch ungeahnte Zunahme des Inter-
esses für die kfebung des deutsch en Runstgew erb es. Wie
anregend in dieser Hinsicht die Münchener Ausstellung im
Jahre ;876 wirkte, bezeugt auch folgende, der „Allgemeinen
Zeitung" entnommene Notiz: Auf der Münchener Jubiläums-
ausstellung int Jahre ;876 wurde der Gedanke angeregt, alle
fünf oder sechs Jahre in verschiedenen Städten eine deutsch,
ö st e r r e i ch i s ch e K u n st - und k u n st g e w e r b l i ch e A u s-
ftellung, und zwar zunächst in Berlin, zu veranstalten. Auf
den Antrag des geh. Regierungsrathes Lüders hat jetzt der Vor-
stand des deutschen Gewerbemuseums, dessen Sammlungen bis
zum Frühjahr J882 j,as neue Gebäude werden translocirt
werden, vor einigen Tagen unter dem Vorsitze des Herzogs
v. Ratibor die Ausführung dieses Gedankens berathen und eine
Kommission beauftragt, dem Vorstand einen plan für die Ver-
anstaltung einer solchen Ausstellung im Jahre ^882 in Berlin
zur Feier der Vollendung des Museums baldigst vorzulegen. In
die Kommission wurden die Museumsdirektoren Grunow, Vr.
Lessing und Professor Ewald, der geh. Regierungsrath Lüders,
der Historienmaler A. v. Heyden, der Bildhauer Sußmann-Hel-
born, der Architekt Professor Gropius und der Fabrikant Halske,
von der Firma Siemens & Halske, gewählt.
Neue Jchnrelzfarbeu für Majolica - Malerei ic.
Künstlern und Kunstfreunden wird es interessant sein, von einer
neuen Sorte Schmelzfarben zu erfahren, welche nicht nur die
Vorzüge der bisher bekannten Porzellan- und die der Delfarben
in sich vereinigen, sondern beide noch an Haltbarkeit, Kraft,
Tiefe und Klarheit übertressen sollen. Ls sind dies Ulrich's
neue Zchmelzfarben (bis jetzt unter dem Namen des Erfinders
„Kosch's Emailfarben in Tuben" bekannt). Diese neuen Schmelz,
färben sollen sich von den alten Schmelz- oder Porzellanfarben
noch durch folgende Vorzüge auszeichnen: Sie lassen sich gleich
Gelfarben miteinander mischen, ohne daß sich der Ton im
Brennen ändert, oder ein ganz anderer, als der beabsichtigte,
entsteht, wie dies so häufig bei den alten Porzellanfarben der
Fall ist. Die neuen Farben behalten überhaupt den ursprüng-
lichen Ton im Brennen bei, gleichviel ob er ein gemischter oder
Griginalton ist. Es ist durch diese Eigenschaft dem Künstler
das fast endlose Erperimentiren erspart, welches bei den alten
Farben nöthig ist, um zu erfahren, inwiefern die unzähligen
Töne durch das Feuer verändert werden. Ein weiterer, ebenso
bedeutender Vorzug der Farben ist der, daß sie ganz verschieden
von gewöhnlichen Porzellanfarben behandelt werden können.
Letztere müssen sehr dünn und glatt aufgetragen werden, sollen
sie nicht im Feuer reißen oder sich abschälen; die neuen dagegen
können ohne jede Gefahr des Reißens oder der Abschälung
gleich Gelsarben dick oder pastös aufgetragen werden; sie ge-
winnen dadurch noch an Glanz und Feuer. Zur Herstellung
eines Schmelzgemäldes ist also nicht mehr, wie bisher, ein langes
Studium nöthig. Der an anderes Material gewöhnte Künstler
braucht nun nicht erst seine beliebte freie und derbe Manier des
Malens abzulegen und sich an die Tüftelei und unendlich mi-
nutiöse Arbeit des Porzellanmalens zu gewöhnen; er darf viel-
mehr bei seiner alten Manier bleiben und wird doch gleich mit
Erfolg arbeiten. Aus den angeführten Eigenschaften der Farben
ergibt sich von selbst, daß es nun möglich ist, ein Schmelzfarben-
gemälde ziemlich ebenso rasch herzustellen, wie ein Gelgemälde,
wogegen bis jetzt mindestens sechsmal so viel Zeit erforderlich
war. lieber die weitere Behandlung der Farben ist als sehr
wesentlich hervorzuheben, daß sie auf der Palette mit etwas
Dicköl vermittelst einer Horn-, nicht Stahlspachtel, so lange zu
verreiben sind, bis sich eine vollkommen zusammenhängende
Masse gebildet hat. Als weitere Verdünnungsmittel dienen Dick-
und Terpentinöl. Beim Anlegen größerer Flächen ist ein grö-
ßerer Zusatz von Dicköl nöthig. Zum Zwecke des Schattirens
braucht man nicht, wie in der Gelmalerei, die helleren oder
dünkleren Töne vorher auf der Palette herzustellen; das Schat-
tiren geschieht vielmehr einfach durch das Aufträgen einer dün-
neren oder dickeren Farbfchichte. Auch find diese neuen Farben
in viel mannigfaltigerer Weise zu verwenden, als alle anderen
ähnlichen Lharakters; man kann sie nicht nur auf Porzellan,
sondern auch auf Majolika, Siderolith, Steingut und Thon ge-
brauchen. Da die Farben außer auf genanntem Material auch
noch auf emaillirtem Eisenblech zu verwenden sind, so ist hie-
durch zugleich das schwierige Räthsel gelöst, Gemälde herzu-
stellen, welche der Einwirkung der Zeit sowohl, wie der der
Witterung widerstehen. Die Adresse des Fabrikanten der neuen
Schmelzfarben ist: p. A. Ulrich, Wien (Stadt), Himmelpfortgaffe
Nr. 22. von der Firma werden auch alle weiter erforderlichen
Materialien geliefert und das Einbrennen der Gemälde besorgt.
Zur Geschichte der Dekorationsmalerei. In der Fest-
sitzung des deutschen archäologischen Instituts in Rom
hielt Or. Mau einen sehr interessanten Vortrag über die Ge-
schichte der Dekorationsmalerei im Alterthum. Er zeigte, wie
wir die Entwicklung dieser Kunst nur für eine verhältnißmäßig
kurze Zeit, ungefähr vom 2. Jahrhundert v. Ehr. bis zum Unter-
gänge pomxeji's, verfolgen können. Etwa im 2. Jahrhundert
v. Ehr. muß ein System polychromer Marmorbekleidung all-
gemeine Verbreitung gefunden und die alte Sitte figürlicher
Darstellung auf den Wänden zurückgedrängt haben. Der Grund
dieser Erscheinung liege theils darin, daß es um jene Zeit durch
die vielfachen Verbindungen zwischen den Küsten des Mittel-
meeres und den Reichthum der hellenistischen Städte leicht war,
sich vielerlei bunten Marmor zu verschaffen, theils in der Er-
findung des Mosaiks, indem jetzt statt der Wände die Fußböden
mit figürlichen Darstellungen geschmückt wurden. Die älteste der
in Pompeji vorhandenen Dekorationsarten ist nichts als die
Nachahmung dieser Marmordekoration in Stuck, wobei der Fugen-
schnitt und ein fast regelmäßig etwa in Zweidrittel der Wand-
höhe befindliches Zahnschnittgesims plastisch in Stuck ausgear-
beitet wurden. In dem glänzendsten der so dekorirten Häuser,
der casa del Fauno, waren die Fußböden mit den herrlichsten
Mosaiken, z. B. dem der Alexanderschlacht, geschmückt. Indem
dann, etwa im Jahrhundert v. Ehr., in Pompeji mit der Zeit
der römischen Kolonie (80 v. Ehr.) wohl aus Sparsamkeits-
rücksichten die plastische Stückarbeit fortgelassen und sowohl die
Marrnorplatten als das Gesims nur durch Malerei nachgeahmt
wurden, ferner aber das durch jenes Gesims vertretene archi-
tektonische Element weiter entwickelt ward, entstand ein zweiter
Stil, der als derjenige der Architekturmalerei bezeichnet werden
kann. Da man zugleich, auch wohl mit Rücksicht auf die Kosten,
die Ausführung von Mosaiken nach Art der Alexanderschlacht
unterließ, so begann man wieder statt dessen die Wände mit
figürlichen Darstellungen zu schmücken, die sich nun jedoch als
Nachahmungen von Tafelgemälden geben. Erst in der Zeit des
Augustus entwickelte sich hieraus ein wirklich ornamentaler Stil,
indem den einzelnen Theilen der Wand ihre architektonische
Lharakteristik genommen, die architektonischen Glieder durch
Drnamentstreifen ersetzt, die Wand einfach als zu ornamentirende
Fläche gefaßt und mit reichen und geschmackvollen Drnamenten
bedeckt wurde. Der Vortragende bezeichnete diesen Stil als die
Blüthe der antiken Dekorationskunst, der gegenüber die Mehr-
zahl der Pompejanischen Wände, welche in den letzten Zeiten
vor der Katastrophe von 79 n. Ehr. gemalt sind, schon einen
rnerklichen verfall zeigen. Einige von ihm ausgestellte probe-
blätter aus einem demnächst über diesen Gegenstand zu xubli-
zirenden Werke, von der Loeillot'schen chromolithographischen
Anstalt in Berlin nach Zeichnungen des Architekten Hrn. Sikkard
in Pompeji ausgeführt, erregten allgemeine Bewunderung. (A. Z.)
WZ- Diesem Defte liegt das Mtgliederverzeichniß des b. Kunstgewerbevereins für bei.
verantw. Redakt.: vr. S. Lichtenstein. — Verlag von G.Hirth in Leipzig & München. — Druck von Knorr & Hirth in München.