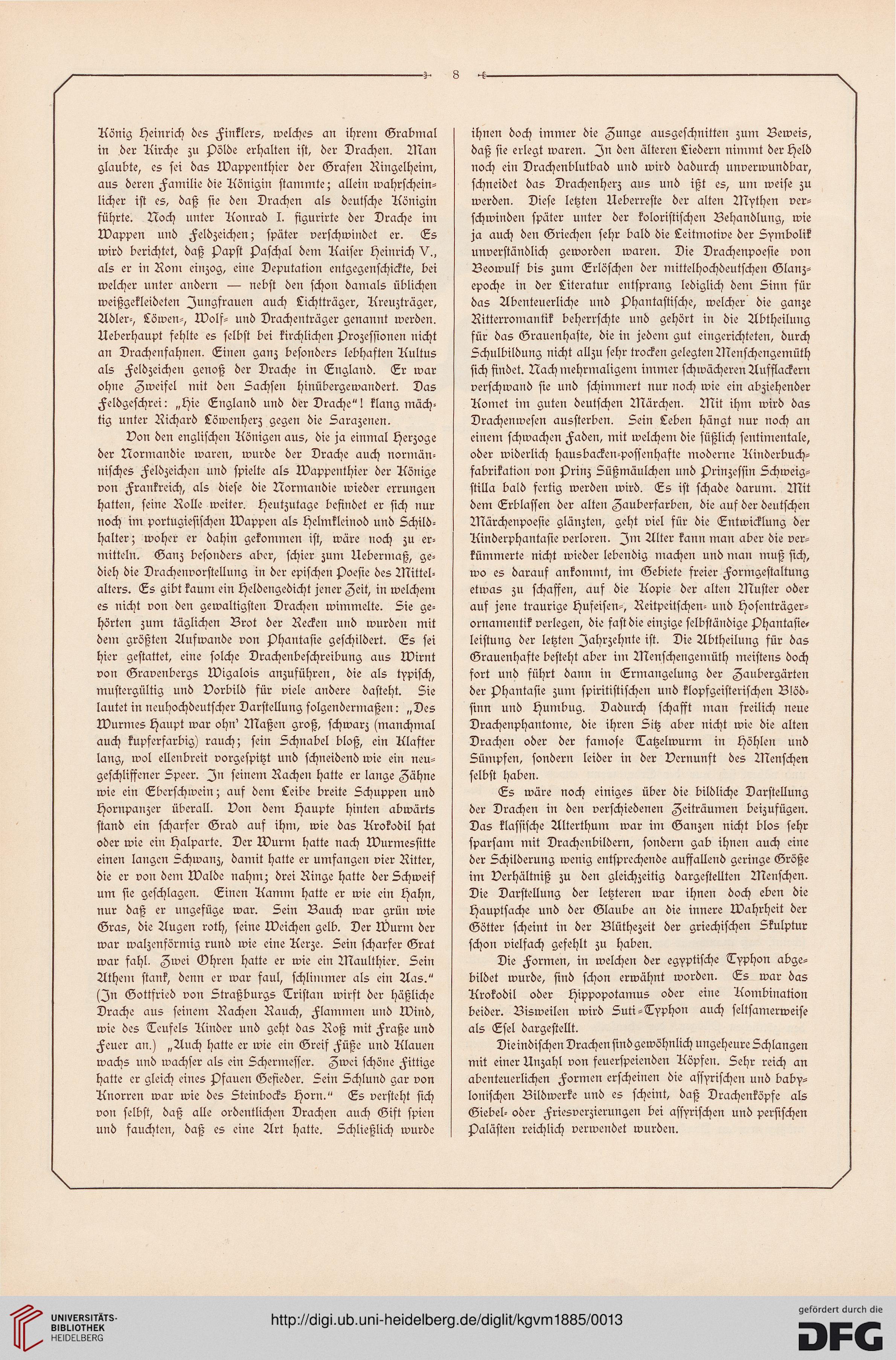König Heinrich des Finklers, welches an ihrem Grabmal
in her Kirche zu pölde erhalten ist, der Drachen. Man
glaubte, es sei das Wappenthier der Grafen Ringelheim,
aus deren Familie die Königin stammte; allein wahrschein-
licher ist es, daß sie den Drachen als deutsche Königin
führte. Noch unter Konrad I. sigurirte der Drache im
Wappen und Feldzeichen; später verschwindet er. Es
wird berichtet, daß Papst Pascha! dem Kaiser Heinrich V.,
als er in Rom einzog, eine Deputation entgegenschickte, bei
welcher unter andern — nebst den schon damals üblichen
weißgekleideten Jungfrauen auch Lichtträger, Kreuzträger,
Adler-, Löwen-, Wolf- und Drachenträger genannt werden.
Keberhaupt fehlte es selbst bei kirchlichen Prozessionen nicht
an Drachenfahnen. Einen ganz besonders lebhaften Kultus
als Feldzeichen genoß der Drache in England. Er war
ohne Zweifel mit den wachsen hinübergewandert. Das
Feldgeschrei: „Hie England und der Drache"! klang mäch-
tig unter Richard Löwenherz gegen die Sarazenen.
Non den englischen Königen aus, die ja einmal Herzoge
der Normandie waren, wurde der Drache auch normän-
nisches Feldzeichen und spielte als Wappenthier der Könige
von Frankreich, als diese die Normandie wieder errungen
hatten, seine Rolle weiter. Heutzutage befindet er sich nur
noch im portugiesischen Wappen als Helmkleinod und Schild-
Halter; woher er dahin gekommen ist, wäre noch zu er-
mitteln. Ganz besonders aber, schier zum Uebermaß, ge-
dieh die Drachenvorstellung in der epischen Poesie des Mittel-
alters. Es gibt kaum ein Heldengedicht jener Zeit, in welchem
es nicht von den gewaltigsten Drachen wimmelte. Sie ge-
hörten zum täglichen Brot der Recken und wurden niit
dem größten Aufwands von Phantasie geschildert. Es sei
hier gestattet, eine solche Drachenbeschreibung aus Wirnt
von Gravenbergs Wigalois anzuführen, die als typisch,
mustergültig und Norbild für viele andere dasteht. Sie
lautet in neuhochdeutscher Darstellung folgendermaßen: „Des
Wurmes Haupt war ohn' Maßen groß, schwarz (manchmal
auch kupferfarbig) rauch; sein Schnabel bloß, ein Klafter
lang, wol ellenbreit vorgespitzt und schneidend wie ein neu-
geschliffener Speer. Zn seinem Rachen hatte er lange Zähne
wie ein Eberschwein; auf dem Leibe breite Schuppen und
Hornpanzer überall. Von dem Haupte hinten abwärts
stand ein scharfer Grad auf ihni, wie das Krokodil hat
oder wie ein Halparte. Der Wurm hatte nach Wurmessitte
einen langen Schwanz, damit hatte er umfangen vier Ritter,
die er von dem Walde nahm; drei Ringe hatte der Schweif
um sie geschlagen. Einen Kamm hatte er wie ein Hahn,
nur daß er ungefüge war. Sein Bauch war grün wie
Gras, die Augen roth, seine Weichen gelb. Der Wurm der
war walzenförmig rund wie eine Kerze. Sein scharfer Grat
war fahl. Zwei Vhren hatte er wie ein Maulthier. Sein
Athem stank, denn er war faul, schlimmer als ein Aas."
(Zn Gottfried von Straßburgs Tristan wirft der häßliche
Drache aus seinem Rachen Rauch, Flammen und Wind,
wie des Teufels Kinder und geht das Roß mit Fräße und
Feuer an.) „Auch hatte er wie ein Greif Füße und Klauen
wachs und wachser als ein Schermeffer. Zwei schöne Fittige
hatte er gleich eines Pfauen Gefieder. Sein Schlund gar von
Knorren war wie des Steinbocks Horn." Es versteht sich
von selbst, daß alle ordentlichen Drachen auch Gift spien
und fauchten, daß es eine Art hatte. Schließlich wurde
ihnen doch immer die Zunge ausgeschnitten zum Beweis,
daß sie erlegt waren. Zn den älteren Liedern nimmt der Held
noch ein Drachenblutbad und wird dadurch unverwundbar,
schneidet das Drachenherz aus und ißt es, um weise zu
werden. Diese letzten Neberreste der alten Mythen ver-
schwinden später unter der koloristischen Behandlung, wie
ja auch den Griechen sehr bald die Leitmotive der Symbolik
unverständlich geworden waren. Die Drachenpoesie von
Beowulf bis zum Erlöschen der mittelhochdeutschen Glanz-
epoche in der Literatur entsprang lediglich dem Sinn für
das Abenteuerliche und phantastische, welcher die ganze
Ritterromantik beherrschte und gehört in die Abtheilung
für das Grauenhafte, die in jedem gut eingerichteten, durch
Schulbildung nicht allzu sehr trocken gelegten Menschengemüth
sich findet. Nach mehrmaligem immer schwächeren Aufsiackern
verschwand sie und schimmert nur noch wie ein abziehender
Komet im guten deutschen Märchen. Mit ihm wird das
Drachenwesen aussterben. Sein Leben hängt nur noch an
einem schwachen Faden, mit welchem die süßlich sentimentale,
oder widerlich hausbacken-possenhafte moderne Kinderbuch-
fabrikation von Prinz Süßmäulchen und Prinzessin Schweig-
stilla bald fertig werden wird. Es ist schade darum. Mit
dem Erblassen der alten Zauberfarben, die auf der deutschen
Märchenpoesie glänzten, geht viel für die Entwicklung der
Kinderphantasie verloren. Zm Alter kann man aber die ver-
kümmerte nicht wieder lebendig nmchen und man muß sich,
wo es darauf ankommt, im Gebiete freier Formgestaltung
etwas zu schaffen, auf die Kopie der alten Muster oder
auf jene traurige Hufeisen-, Reitpeitschen- und Hosenträger-
ornamentik verlegen, die fast die einzige selbständige Phantasie-
leistung der letzten Zahrzehnte ist. Die Abtheilung für das
Grauenhafte besteht aber im Menschengemüth meistens doch
fort und führt dann in Ermangelung der Zaubergärten
der Phantasie zum spiritistischen und klopfgeisterischen Blöd-
sinn und Humbug. Dadurch schafft man freilich neue
Drachenphantome, die ihren Sitz aber nicht wie die alten
Drachen oder der faniose Tatzelwurm in Höhlen und
Sümpfen, sondern leider in der Vernunft des Menschen
selbst haben.
Es wäre noch einiges über die bildliche Darstellung
der Drachen in den verschiedenen Zeiträumen beizufügen.
Das klassische Alterthunr war im Ganzen nicht blos sehr
sparsam mit Drachenbildern, sondern gab ihnen auch eine
der Schilderung wenig entsprechende auffallend geringe Größe
im Verhältniß zu den gleichzeitig dargestellten Menschen.
Die Darstellung der letzteren war ihnen doch eben die
Hauptsache und der Glaube an die innere Wahrheit der
Götter scheint in der Blüthezeit der griechischen Skulptur
schon vielfach gefehlt zu haben.
Die Formen, in welchen der egyptische Typhon abge-
bildet wurde, sind schon erwähnt worden. Es war das
Krokodil oder Hippopotamus oder eine Kombination
beider. Bisweilen wird Suti-Typhon auch seltsamerweise
als Esel dargestellt.
Die indischen Drachen sind gewöhnlich ungeheure Schlangen
mit einer Unzahl von feuerspeienden Köpfen. Sehr reich an
abenteuerlichen Formen erscheinen die assyrischen und baby-
lonischen Bildwerke und es scheint, daß Drachenköpfe als
Giebel- oder Friesverzierungen bei assyrischen und persischen
Palästen reichlich verwendet wurden.
in her Kirche zu pölde erhalten ist, der Drachen. Man
glaubte, es sei das Wappenthier der Grafen Ringelheim,
aus deren Familie die Königin stammte; allein wahrschein-
licher ist es, daß sie den Drachen als deutsche Königin
führte. Noch unter Konrad I. sigurirte der Drache im
Wappen und Feldzeichen; später verschwindet er. Es
wird berichtet, daß Papst Pascha! dem Kaiser Heinrich V.,
als er in Rom einzog, eine Deputation entgegenschickte, bei
welcher unter andern — nebst den schon damals üblichen
weißgekleideten Jungfrauen auch Lichtträger, Kreuzträger,
Adler-, Löwen-, Wolf- und Drachenträger genannt werden.
Keberhaupt fehlte es selbst bei kirchlichen Prozessionen nicht
an Drachenfahnen. Einen ganz besonders lebhaften Kultus
als Feldzeichen genoß der Drache in England. Er war
ohne Zweifel mit den wachsen hinübergewandert. Das
Feldgeschrei: „Hie England und der Drache"! klang mäch-
tig unter Richard Löwenherz gegen die Sarazenen.
Non den englischen Königen aus, die ja einmal Herzoge
der Normandie waren, wurde der Drache auch normän-
nisches Feldzeichen und spielte als Wappenthier der Könige
von Frankreich, als diese die Normandie wieder errungen
hatten, seine Rolle weiter. Heutzutage befindet er sich nur
noch im portugiesischen Wappen als Helmkleinod und Schild-
Halter; woher er dahin gekommen ist, wäre noch zu er-
mitteln. Ganz besonders aber, schier zum Uebermaß, ge-
dieh die Drachenvorstellung in der epischen Poesie des Mittel-
alters. Es gibt kaum ein Heldengedicht jener Zeit, in welchem
es nicht von den gewaltigsten Drachen wimmelte. Sie ge-
hörten zum täglichen Brot der Recken und wurden niit
dem größten Aufwands von Phantasie geschildert. Es sei
hier gestattet, eine solche Drachenbeschreibung aus Wirnt
von Gravenbergs Wigalois anzuführen, die als typisch,
mustergültig und Norbild für viele andere dasteht. Sie
lautet in neuhochdeutscher Darstellung folgendermaßen: „Des
Wurmes Haupt war ohn' Maßen groß, schwarz (manchmal
auch kupferfarbig) rauch; sein Schnabel bloß, ein Klafter
lang, wol ellenbreit vorgespitzt und schneidend wie ein neu-
geschliffener Speer. Zn seinem Rachen hatte er lange Zähne
wie ein Eberschwein; auf dem Leibe breite Schuppen und
Hornpanzer überall. Von dem Haupte hinten abwärts
stand ein scharfer Grad auf ihni, wie das Krokodil hat
oder wie ein Halparte. Der Wurm hatte nach Wurmessitte
einen langen Schwanz, damit hatte er umfangen vier Ritter,
die er von dem Walde nahm; drei Ringe hatte der Schweif
um sie geschlagen. Einen Kamm hatte er wie ein Hahn,
nur daß er ungefüge war. Sein Bauch war grün wie
Gras, die Augen roth, seine Weichen gelb. Der Wurm der
war walzenförmig rund wie eine Kerze. Sein scharfer Grat
war fahl. Zwei Vhren hatte er wie ein Maulthier. Sein
Athem stank, denn er war faul, schlimmer als ein Aas."
(Zn Gottfried von Straßburgs Tristan wirft der häßliche
Drache aus seinem Rachen Rauch, Flammen und Wind,
wie des Teufels Kinder und geht das Roß mit Fräße und
Feuer an.) „Auch hatte er wie ein Greif Füße und Klauen
wachs und wachser als ein Schermeffer. Zwei schöne Fittige
hatte er gleich eines Pfauen Gefieder. Sein Schlund gar von
Knorren war wie des Steinbocks Horn." Es versteht sich
von selbst, daß alle ordentlichen Drachen auch Gift spien
und fauchten, daß es eine Art hatte. Schließlich wurde
ihnen doch immer die Zunge ausgeschnitten zum Beweis,
daß sie erlegt waren. Zn den älteren Liedern nimmt der Held
noch ein Drachenblutbad und wird dadurch unverwundbar,
schneidet das Drachenherz aus und ißt es, um weise zu
werden. Diese letzten Neberreste der alten Mythen ver-
schwinden später unter der koloristischen Behandlung, wie
ja auch den Griechen sehr bald die Leitmotive der Symbolik
unverständlich geworden waren. Die Drachenpoesie von
Beowulf bis zum Erlöschen der mittelhochdeutschen Glanz-
epoche in der Literatur entsprang lediglich dem Sinn für
das Abenteuerliche und phantastische, welcher die ganze
Ritterromantik beherrschte und gehört in die Abtheilung
für das Grauenhafte, die in jedem gut eingerichteten, durch
Schulbildung nicht allzu sehr trocken gelegten Menschengemüth
sich findet. Nach mehrmaligem immer schwächeren Aufsiackern
verschwand sie und schimmert nur noch wie ein abziehender
Komet im guten deutschen Märchen. Mit ihm wird das
Drachenwesen aussterben. Sein Leben hängt nur noch an
einem schwachen Faden, mit welchem die süßlich sentimentale,
oder widerlich hausbacken-possenhafte moderne Kinderbuch-
fabrikation von Prinz Süßmäulchen und Prinzessin Schweig-
stilla bald fertig werden wird. Es ist schade darum. Mit
dem Erblassen der alten Zauberfarben, die auf der deutschen
Märchenpoesie glänzten, geht viel für die Entwicklung der
Kinderphantasie verloren. Zm Alter kann man aber die ver-
kümmerte nicht wieder lebendig nmchen und man muß sich,
wo es darauf ankommt, im Gebiete freier Formgestaltung
etwas zu schaffen, auf die Kopie der alten Muster oder
auf jene traurige Hufeisen-, Reitpeitschen- und Hosenträger-
ornamentik verlegen, die fast die einzige selbständige Phantasie-
leistung der letzten Zahrzehnte ist. Die Abtheilung für das
Grauenhafte besteht aber im Menschengemüth meistens doch
fort und führt dann in Ermangelung der Zaubergärten
der Phantasie zum spiritistischen und klopfgeisterischen Blöd-
sinn und Humbug. Dadurch schafft man freilich neue
Drachenphantome, die ihren Sitz aber nicht wie die alten
Drachen oder der faniose Tatzelwurm in Höhlen und
Sümpfen, sondern leider in der Vernunft des Menschen
selbst haben.
Es wäre noch einiges über die bildliche Darstellung
der Drachen in den verschiedenen Zeiträumen beizufügen.
Das klassische Alterthunr war im Ganzen nicht blos sehr
sparsam mit Drachenbildern, sondern gab ihnen auch eine
der Schilderung wenig entsprechende auffallend geringe Größe
im Verhältniß zu den gleichzeitig dargestellten Menschen.
Die Darstellung der letzteren war ihnen doch eben die
Hauptsache und der Glaube an die innere Wahrheit der
Götter scheint in der Blüthezeit der griechischen Skulptur
schon vielfach gefehlt zu haben.
Die Formen, in welchen der egyptische Typhon abge-
bildet wurde, sind schon erwähnt worden. Es war das
Krokodil oder Hippopotamus oder eine Kombination
beider. Bisweilen wird Suti-Typhon auch seltsamerweise
als Esel dargestellt.
Die indischen Drachen sind gewöhnlich ungeheure Schlangen
mit einer Unzahl von feuerspeienden Köpfen. Sehr reich an
abenteuerlichen Formen erscheinen die assyrischen und baby-
lonischen Bildwerke und es scheint, daß Drachenköpfe als
Giebel- oder Friesverzierungen bei assyrischen und persischen
Palästen reichlich verwendet wurden.