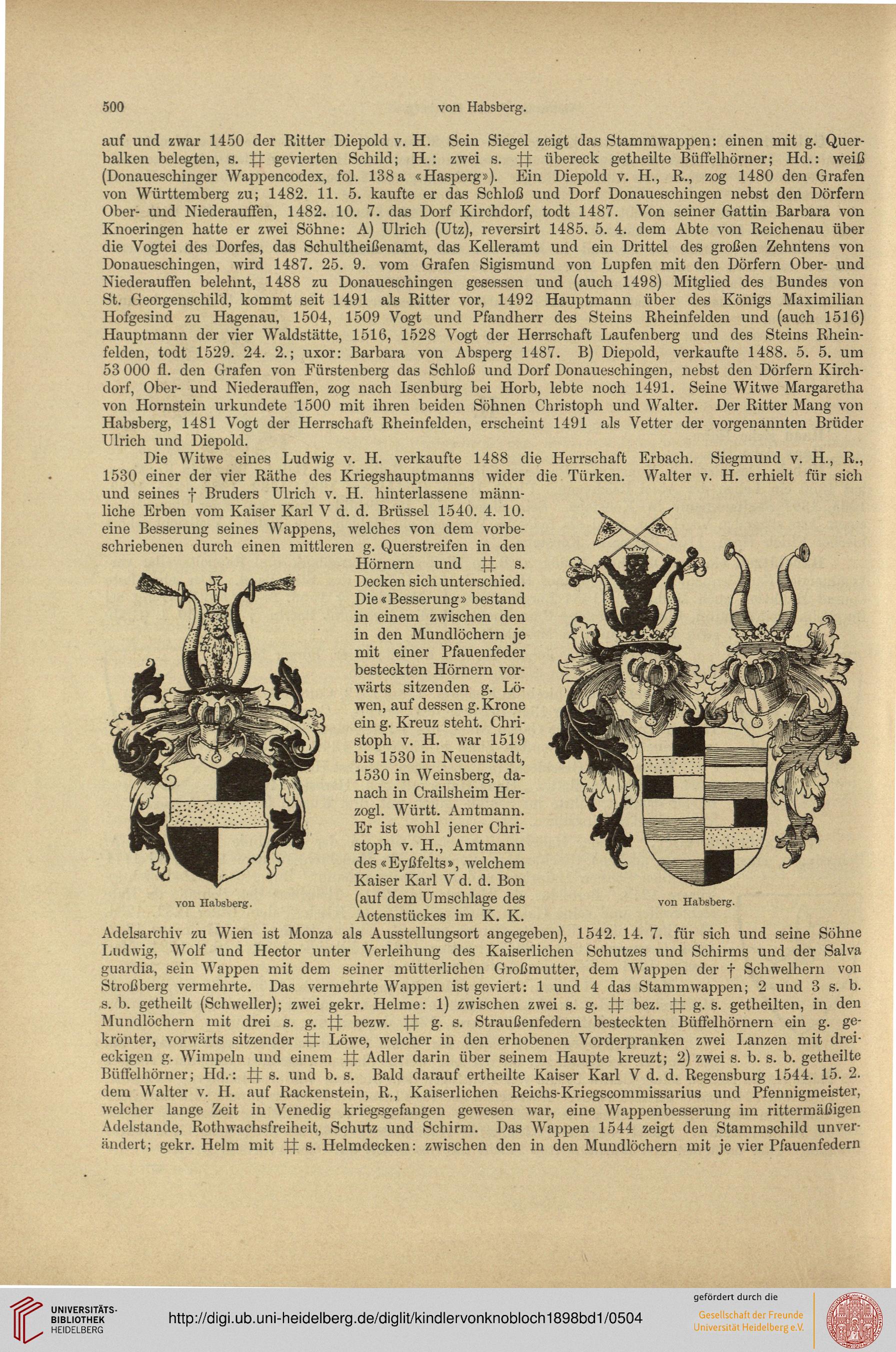500
von Habsberg.
auf und zwar 1450 der Ritter Diepold v. H. Sein Siegel zeigt das Stammwappen: einen mit g. Quer-
balken belegten, s. fl: gevierten Schild; H.: zwei s. fl: übereck getheilte Büffelhörner; Hd.: weiß
(Donaueschinger Wappencodex, fol. 138 a «Hasperg»). Ein Diepold v. H., R., zog 1480 den Grafen
von Württemberg zu; 1482. 11. 5. kaufte er das Schloß und Dorf Donaueschingen nebst den Dörfern
Ober- und Niederauffen, 1482. 10. 7. das Dorf Kirchdorf, todt 1487. Von seiner Gattin Barbara von
Knoeringen hatte er zwei Söhne: A) Ulrich (Utz), reversirt 1485. 5. 4. dem Abte von Reichenau über
die Vogtei des Dorfes, das Schultheißenamt, das Kelleramt und ein Drittel des großen Zehntens von
Donaueschingen, wird 1487. 25. 9. vom Grafen Sigismund von Lupfen mit den Dörfern Ober- und
Niederauffen belehnt, 1488 zu Donaueschingen gesessen und (auch 1498) Mitglied des Bundes von
St. Georgenschild, kommt seit 1491 als Ritter vor, 1492 Hauptmann über des Königs Maximilian
Hofgesind zu Hagenau, 1504, 1509 Vogt und Pfandherr des Steins Rheinfelden und (auch 1516)
Hauptmann der vier Waldstätte, 1516, 1528 Vogt der Herrschaft Laufenberg und des Steins Rhein-
felden, todt 1529. 24. 2.; uxor: Barbara von Absperg 1487. B) Diepold, verkaufte 1488. 5. 5. um
53 000 fl. den Grafen von Fürstenberg das Schloß und Dorf Donaueschingen, nebst den Dörfern Kirch-
dorf, Ober- und Niederauffen, zog nach Isenburg bei Horb, lebte noch 1491. Seine Witwe Margaretria
von Hornstein urkundete 1500 mit ihren beiden Söhnen Christoph und Walter. Der Ritter Mang von
Habsberg, 1481 Vogt der Herrschaft Rheinfelden, erscheint 1491 als Vetter der vorgenannten Brüder
Lirich und Diepold.
Die Witwe eines Ludwig v. H. verkaufte 1488 die Herrschaft Erbach. Siegmund v. H, R.,
1530 einer der vier Räthe des Kriegshauptmanns wider die Türken. Walter v. H. erhielt für sich
und seines f Bruders Ulrich v. H. hinterlassene männ-
liche Erben vom Kaiser Karl V d. d. Brüssel 1540. 4. 10.
eine Besserung seines Wappens, welches von dem vorbe-
schriebenen durch einen mittleren g. Querstreifen in den
Hörnern und ^ s-
Decken sich unterschied.
Die «Besserung» bestand
in einem zwischen den
in den Mundlöchern je
mit einer Pfauenfeder
besteckten Hörnern vor-
wärts sitzenden g. Lö-
wen, auf dessen g. Krone
ein g. Kreuz steht. Chri-
stoph v. H. war 1519
bis 1530 in Neuenstadt,
1530 in Weinsberg, da-
nach in Crailsheim Her-
zogl. Württ. Amtmann.
Er ist wohl jener Chri-
stoph v. H., Amtmann
des«Eyßfelts», welchem
Kaiser Karl V d. d. Bon
(auf dem Umschlage des
Actenstückes im K. K.
Adelsarchiv zu Wien ist Monza als Ausstellungsort angegeben), 1542. 14. 7. für sich und seine Söhne
Ludwig, Wolf und Hector unter Verleihung des Kaiserlichen Schutzes und Schirms und der Salva
guardia, sein Wappen mit dem seiner mütterlichen Großmutter, dem Wappen der f Schwelhern von
Stroßberg vermehrte. Das vermehrte Wappen ist geviert: 1 und 4 das Stammwappen; 2 und 3 s. b.
s. b. getheilt (Schweller); zwei gekr. Helme: 1) zwischen zwei s. g. $~ bez. rj^ g. s. getheilten, in den
Mundlöchern mit drei s. g. pj: bezw. :ft g. s. Straußenfedern besteckten Büffelhörnern ein g. ge-
krönter, vorwärts sitzender # Löwe, welcher in den erhobenen Vorderpranken zwei Lanzen mit drei-
eckigen g. Wimpeln und einem pf Adler darin über seinem Haupte kreuzt; 2) zwei s. b. s. b. getheilte
Büffelhörner; Hd.: :f£ s. und b. s. Bald darauf ertheilte Kaiser Karl V d. d. Regensburg 1544. 15. 2.
dem Walter v. H. auf Rackenstein, R., Kaiserlichen Reichs-Kriegscommissarius und Pfennigmeister,
welcher lange Zeit in Venedig kriegsgefangen gewesen war, eine Wappenbesserung im rittermäßigen
Adelstande, Rothwachsfreiheit, Schutz und Schirm. Das Wappen 1544 zeigt den Stammschild unver-
ändert; gekr. Helm mit j$L s. Helmdecken: zwischen den in den Mundlöchern mit je vier Pfauenfedern
von Habsberg.
von Habsberg.
von Habsberg.
auf und zwar 1450 der Ritter Diepold v. H. Sein Siegel zeigt das Stammwappen: einen mit g. Quer-
balken belegten, s. fl: gevierten Schild; H.: zwei s. fl: übereck getheilte Büffelhörner; Hd.: weiß
(Donaueschinger Wappencodex, fol. 138 a «Hasperg»). Ein Diepold v. H., R., zog 1480 den Grafen
von Württemberg zu; 1482. 11. 5. kaufte er das Schloß und Dorf Donaueschingen nebst den Dörfern
Ober- und Niederauffen, 1482. 10. 7. das Dorf Kirchdorf, todt 1487. Von seiner Gattin Barbara von
Knoeringen hatte er zwei Söhne: A) Ulrich (Utz), reversirt 1485. 5. 4. dem Abte von Reichenau über
die Vogtei des Dorfes, das Schultheißenamt, das Kelleramt und ein Drittel des großen Zehntens von
Donaueschingen, wird 1487. 25. 9. vom Grafen Sigismund von Lupfen mit den Dörfern Ober- und
Niederauffen belehnt, 1488 zu Donaueschingen gesessen und (auch 1498) Mitglied des Bundes von
St. Georgenschild, kommt seit 1491 als Ritter vor, 1492 Hauptmann über des Königs Maximilian
Hofgesind zu Hagenau, 1504, 1509 Vogt und Pfandherr des Steins Rheinfelden und (auch 1516)
Hauptmann der vier Waldstätte, 1516, 1528 Vogt der Herrschaft Laufenberg und des Steins Rhein-
felden, todt 1529. 24. 2.; uxor: Barbara von Absperg 1487. B) Diepold, verkaufte 1488. 5. 5. um
53 000 fl. den Grafen von Fürstenberg das Schloß und Dorf Donaueschingen, nebst den Dörfern Kirch-
dorf, Ober- und Niederauffen, zog nach Isenburg bei Horb, lebte noch 1491. Seine Witwe Margaretria
von Hornstein urkundete 1500 mit ihren beiden Söhnen Christoph und Walter. Der Ritter Mang von
Habsberg, 1481 Vogt der Herrschaft Rheinfelden, erscheint 1491 als Vetter der vorgenannten Brüder
Lirich und Diepold.
Die Witwe eines Ludwig v. H. verkaufte 1488 die Herrschaft Erbach. Siegmund v. H, R.,
1530 einer der vier Räthe des Kriegshauptmanns wider die Türken. Walter v. H. erhielt für sich
und seines f Bruders Ulrich v. H. hinterlassene männ-
liche Erben vom Kaiser Karl V d. d. Brüssel 1540. 4. 10.
eine Besserung seines Wappens, welches von dem vorbe-
schriebenen durch einen mittleren g. Querstreifen in den
Hörnern und ^ s-
Decken sich unterschied.
Die «Besserung» bestand
in einem zwischen den
in den Mundlöchern je
mit einer Pfauenfeder
besteckten Hörnern vor-
wärts sitzenden g. Lö-
wen, auf dessen g. Krone
ein g. Kreuz steht. Chri-
stoph v. H. war 1519
bis 1530 in Neuenstadt,
1530 in Weinsberg, da-
nach in Crailsheim Her-
zogl. Württ. Amtmann.
Er ist wohl jener Chri-
stoph v. H., Amtmann
des«Eyßfelts», welchem
Kaiser Karl V d. d. Bon
(auf dem Umschlage des
Actenstückes im K. K.
Adelsarchiv zu Wien ist Monza als Ausstellungsort angegeben), 1542. 14. 7. für sich und seine Söhne
Ludwig, Wolf und Hector unter Verleihung des Kaiserlichen Schutzes und Schirms und der Salva
guardia, sein Wappen mit dem seiner mütterlichen Großmutter, dem Wappen der f Schwelhern von
Stroßberg vermehrte. Das vermehrte Wappen ist geviert: 1 und 4 das Stammwappen; 2 und 3 s. b.
s. b. getheilt (Schweller); zwei gekr. Helme: 1) zwischen zwei s. g. $~ bez. rj^ g. s. getheilten, in den
Mundlöchern mit drei s. g. pj: bezw. :ft g. s. Straußenfedern besteckten Büffelhörnern ein g. ge-
krönter, vorwärts sitzender # Löwe, welcher in den erhobenen Vorderpranken zwei Lanzen mit drei-
eckigen g. Wimpeln und einem pf Adler darin über seinem Haupte kreuzt; 2) zwei s. b. s. b. getheilte
Büffelhörner; Hd.: :f£ s. und b. s. Bald darauf ertheilte Kaiser Karl V d. d. Regensburg 1544. 15. 2.
dem Walter v. H. auf Rackenstein, R., Kaiserlichen Reichs-Kriegscommissarius und Pfennigmeister,
welcher lange Zeit in Venedig kriegsgefangen gewesen war, eine Wappenbesserung im rittermäßigen
Adelstande, Rothwachsfreiheit, Schutz und Schirm. Das Wappen 1544 zeigt den Stammschild unver-
ändert; gekr. Helm mit j$L s. Helmdecken: zwischen den in den Mundlöchern mit je vier Pfauenfedern
von Habsberg.
von Habsberg.