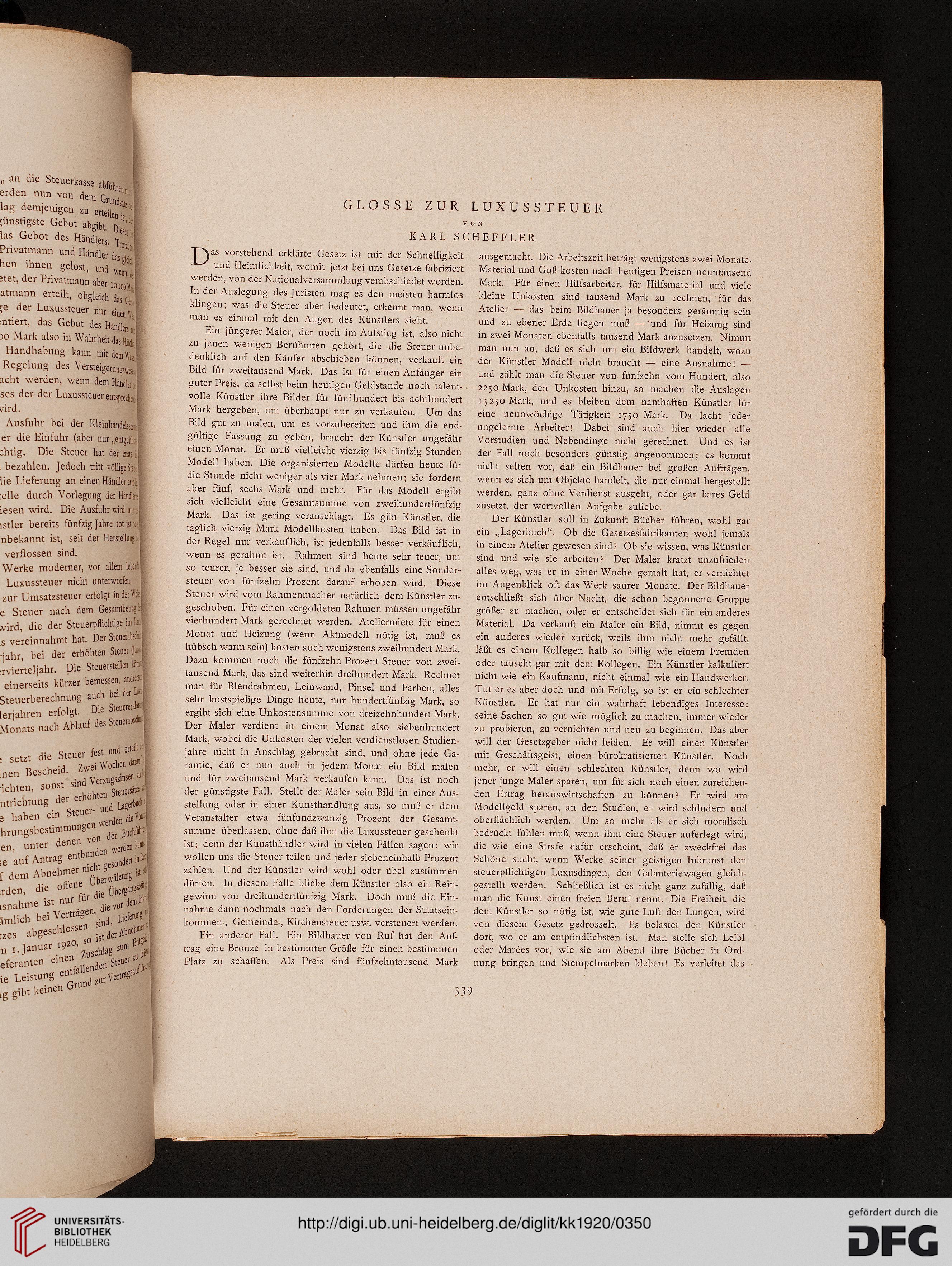„ an die Steuerkasse abfüW
erden nun von dem Gru^
lag demjenigen zu erteile^;
;ünstigste Gebot abgibt. DiKes
las Gebot des Händlers. TrT
Privatmann und Händler fei
hen ihnen gelost, und ^
:tet, der Privatmann aber iOl00«..
atmann erteilt, obgleich das 1
re der Luxussteuer nur einend
mtiert, das Gebot des Händlers r
10 Mark also in Wahrheit das Hödtt
Handhabung kann mit dem%
Regelung des Versteigerung
acht werden, wenn dem Händlt
ses der der Luxussteuer entsprecht:
i'ird.
Ausfuhr bei der _
er die Einfuhr (aber nur „entj
chtig. Die Steuer hat der er« i
i bezahlen. Jedoch tritt völligeSitat
lie Lieferung an einen Händler eft
;elle durch Vorlegung der Händler:
iesen wird. Die Ausfuhr wird nurk
istler bereits fünfzig Jahre tot ista
nbekannt ist, seit der Herstellung!;
verflossen sind.
Werke moderner, vor allem leben::
Luxussteuer nicht unterworfen,
zur Umsatzsteuer erfolgt in der Ves
e Steuer nach dem Gesamtbenag i
ivird, die der Steuerpflichtige ira k
s vereinnahmt hat. Der Steuerabsck
■jähr bei der erhöhten Steuer 0*
Vierteljahr. Die Steuerstellente
einerseits kürzer bemessen and*
Steuerberechnung auch bet
Monats nach AD«ui u
B haben ein Steuer &Y*
hrungsbestimmungenj ^
en, unter i^™^»
f dem Abnehmer«g^tf
:rden, die offene ^ ^1
.snahme ********
inilich bei Vertragen, ,
tzes abgeschlosse drAb^
GLOSSE ZUR LUXUSSTEUER
g gibt keinen Grun
VON
KARL SCHEFFLER
T~Y1S vorstellend erklärte Gesetz ist mit der Schnelligkeit
und Heimlichkeit, womit jetzt bei uns Gesetze fabriziert
werden, von der Nationalversammlung verabschiedet worden.
In der Auslegung des Juristen mag es den meisten harmlos
klingen; was die Steuer aber bedeutet, erkennt man, wenn
man es einmal mit den Augen des Künstlers sieht.
Ein jüngerer Maler, der noch im Aufstieg ist, also nicht
zu jenen wenigen Berühmten gehört, die die Steuer unbe-
denklich auf den Käufer abschieben können, verkauft ein
Bild für zweitausend Mark. Das ist für einen Anfänger ein
guter Preis, da selbst beim heutigen Geldstande noch talent-
volle Künstler ihre Bilder für fünfhundert bis achthundert
Mark hergeben, um überhaupt nur zu verkaufen. Um das
Bild gut zu malen, um es vorzubereiten und ihm die end-
gültige Fassung zu geben, braucht der Künstler ungefähr
einen Monat. Er muß vielleicht vierzig bis fünfzig Stunden
Modell haben. Die organisierten Modelle dürfen heute für
die Stunde nicht weniger als vier Mark nehmen; sie fordern
aber fünf, sechs Mark und mehr. Für das Modell ergibt
sich vielleicht eine Gesamtsumme von zweihundertlünfzig
Mark. Das ist gering veranschlagt. Es gibt Künstler, die
täglich vierzig Mark Modellkosten haben. Das Bild ist in
der Regel nur verkäuflich, ist jedenfalls besser verkäuflich,
wenn es gerahmt ist. Rahmen sind heute sehr teuer, um
so teurer, je besser sie sind, und da ebenfalls eine Sonder-
steuer von fünfzehn Prozent darauf erhoben wird. Diese
Steuer wird vom Rahmenmacher natürlich dem Künstler zu-
geschoben. Für einen vergoldeten Rahmen müssen ungefähr
vierhundert Mark gerechnet werden. Ateliermiete für einen
Monat und Heizung (wenn Aktmodell nötig ist, muß es
hübsch warm sein) kosten auch wenigstens zweihundert Mark.
Dazu kommen noch die fünfzehn Prozent Steuer von zwei-
tausend Mark, das sind weiterhin dreihundert Mark. Rechnet
man für Blendrahmen, Leinwand, Pinsel und Farben, alles
sehr kostspielige Dinge heute, nur hundertfünfzig Mark, so
ergibt sich eine Unkostensumme von dreizehnhundert Mark.
Der Maler verdient in einem Monat also siebenhundert
Mark, wobei die Unkosten der vielen verdienstlosen Studien-
jahre nicht in Anschlag gebracht sind, und ohne jede Ga-
rantie, daß er nun auch in jedem Monat ein Bild malen
und für zweitausend Mark verkaufen kann. Das ist noch
der günstigste Fall. Stellt der Maler sein Bild in einer Aus-
stellung oder in einer Kunsthandlung aus, so muß er dem
Veranstalter etwa fünfundzwanzig Prozent der Gesamt-
summe überlassen, ohne daß ihm die Luxussteuer geschenkt
ist; denn der Kunsthändler wird in vielen Fällen sagen: wir
wollen uns die Steuer teilen und jeder siebeneinhalb Prozent
zahlen. Und der Künstler wird wohl oder übel zustimmen
dürfen. In diesem Falle bliebe dem Künstler also ein Rein-
gewinn von dreihundertfünfzig Mark. Doch muß die Ein-
nahme dann nochmals nach den Forderungen der Staatsein-
kommen-, Gemeinde-, Kirchensteuer usw. versteuert werden.
Ein anderer Fall. Ein Bildhauer von Ruf hat den Auf-
trag eine Bronze in bestimmter Größe für einen bestimmten
Platz zu schaffen. Als Preis sind fünfzehntausend Mark
ausgemacht. Die Arbeitszeit beträgt wenigstens zwei Monate.
Material und Guß kosten nach heutigen Preisen neuntausend
Mark. Für einen Hilfsarbeiter, für Hilfsmaterial und viele
kleine Unkosten sind tausend Mark zu rechnen, für das
Atelier — das beim Bildhauer ja besonders geräumig sein
und zu ebener Erde liegen muß —'und für Heizung sind
in zwei Monaten ebenfalls tausend Mark anzusetzen. Nimmt
man nun an, daß es sich um ein Bildwerk handelt, wozu
der Künstler Modell nicht braucht — eine Ausnahme! —
und zählt man die Steuer von fünfzehn vom Hundert, also
2250 Mark, den Unkosten hinzu, so machen die Auslagen
13250 Mark, und es bleiben dem namhaften Künstler für
eine neunwöchige Tätigkeit 1750 Mark. Da lacht jeder
ungelernte Arbeiter! Dabei sind auch hier wieder alle
Vorstudien und Nebendinge nicht gerechnet. Und es ist
der Fall noch besonders günstig angenommen; es kommt
nicht selten vor, daß ein Bildhauer bei großen Aufträgen,
wenn es sich um Objekte handelt, die nur einmal hergestellt
werden, ganz ohne Verdienst ausgeht, oder gar bares Geld
zusetzt, der wertvollen Aufgabe zuliebe.
Der Künstler soll in Zukunft Bücher führen, wohl gar
ein „Lagerbuch". Ob die Gesetzesfabrikanten wohl jemals
in einem Atelier gewesen sind? Ob sie wissen, was Künstler
sind und wie sie arbeiten? Der Maler kratzt unzufrieden
alles weg, was er in einer Woche gemalt hat, er vernichtet
im Augenblick oft das Werk saurer Monate. Der Bildhauer
entschließt sich über Nacht, die schon begonnene Gruppe
größer zu machen, oder er entscheidet sich für ein anderes
Material. Da verkauft ein Maler ein Bild, nimmt es gegen
ein anderes wieder zurück, weils ihm nicht mehr gefällt,
läßt es einem Kollegen halb so billig wie einem Fremden
oder tauscht gar mit dem Kollegen. Ein Künstler kalkuliert
nicht wie ein Kaufmann, nicht einmal wie ein Handwerker.
Tut er es aber doch und mit Erfolg, so ist er ein schlechter
Künstler. Er hat nur ein wahrhaft lebendiges Interesse:
seine Sachen so gut wie möglich zu machen, immer wieder
zu probieren, zu vernichten und neu zu beginnen. Das aber
will der Gesetzgeber nicht leiden. Er will einen Künstler
mit Geschäftsgeist, einen bürokratisierten Künstler. Noch
mehr, er will einen schlechten Künstler, denn wo wird
jener junge Maler sparen, um für sich noch einen zureichen-
den Ertrag herauswirtschaften zu können? Er wird am
Modellgeld sparen, an den Studien, er wird schludern und
oberflächlich werden. Um so mehr als er sich moralisch
bedrückt fühlen muß, wenn ihm eine Steuer auferlegt wird,
die wie eine Strafe dafür erscheint, daß er zweckfrei das
Schöne sucht, wenn Werke seiner geistigen Inbrunst den
steuerpflichtigen Luxusdingen, den Galanteriewagen gleich-
gestellt werden. Schließlich ist es nicht ganz zufällig, daß
man die Kunst einen freien Beruf nennt. Die Freiheit, die
dem Künstler so nötig ist, wie gute Luft den Lungen, wird
von diesem Gesetz gedrosselt. Es belastet den Künstler
dort, wo er am empfindlichsten ist. Man stelle sich Leibi
oder Marees vor, wie sie am Abend ihre Bücher in Ord-
nung bringen und Stempelmarken kleben! Es verleitet das
?39
erden nun von dem Gru^
lag demjenigen zu erteile^;
;ünstigste Gebot abgibt. DiKes
las Gebot des Händlers. TrT
Privatmann und Händler fei
hen ihnen gelost, und ^
:tet, der Privatmann aber iOl00«..
atmann erteilt, obgleich das 1
re der Luxussteuer nur einend
mtiert, das Gebot des Händlers r
10 Mark also in Wahrheit das Hödtt
Handhabung kann mit dem%
Regelung des Versteigerung
acht werden, wenn dem Händlt
ses der der Luxussteuer entsprecht:
i'ird.
Ausfuhr bei der _
er die Einfuhr (aber nur „entj
chtig. Die Steuer hat der er« i
i bezahlen. Jedoch tritt völligeSitat
lie Lieferung an einen Händler eft
;elle durch Vorlegung der Händler:
iesen wird. Die Ausfuhr wird nurk
istler bereits fünfzig Jahre tot ista
nbekannt ist, seit der Herstellung!;
verflossen sind.
Werke moderner, vor allem leben::
Luxussteuer nicht unterworfen,
zur Umsatzsteuer erfolgt in der Ves
e Steuer nach dem Gesamtbenag i
ivird, die der Steuerpflichtige ira k
s vereinnahmt hat. Der Steuerabsck
■jähr bei der erhöhten Steuer 0*
Vierteljahr. Die Steuerstellente
einerseits kürzer bemessen and*
Steuerberechnung auch bet
Monats nach AD«ui u
B haben ein Steuer &Y*
hrungsbestimmungenj ^
en, unter i^™^»
f dem Abnehmer«g^tf
:rden, die offene ^ ^1
.snahme ********
inilich bei Vertragen, ,
tzes abgeschlosse drAb^
GLOSSE ZUR LUXUSSTEUER
g gibt keinen Grun
VON
KARL SCHEFFLER
T~Y1S vorstellend erklärte Gesetz ist mit der Schnelligkeit
und Heimlichkeit, womit jetzt bei uns Gesetze fabriziert
werden, von der Nationalversammlung verabschiedet worden.
In der Auslegung des Juristen mag es den meisten harmlos
klingen; was die Steuer aber bedeutet, erkennt man, wenn
man es einmal mit den Augen des Künstlers sieht.
Ein jüngerer Maler, der noch im Aufstieg ist, also nicht
zu jenen wenigen Berühmten gehört, die die Steuer unbe-
denklich auf den Käufer abschieben können, verkauft ein
Bild für zweitausend Mark. Das ist für einen Anfänger ein
guter Preis, da selbst beim heutigen Geldstande noch talent-
volle Künstler ihre Bilder für fünfhundert bis achthundert
Mark hergeben, um überhaupt nur zu verkaufen. Um das
Bild gut zu malen, um es vorzubereiten und ihm die end-
gültige Fassung zu geben, braucht der Künstler ungefähr
einen Monat. Er muß vielleicht vierzig bis fünfzig Stunden
Modell haben. Die organisierten Modelle dürfen heute für
die Stunde nicht weniger als vier Mark nehmen; sie fordern
aber fünf, sechs Mark und mehr. Für das Modell ergibt
sich vielleicht eine Gesamtsumme von zweihundertlünfzig
Mark. Das ist gering veranschlagt. Es gibt Künstler, die
täglich vierzig Mark Modellkosten haben. Das Bild ist in
der Regel nur verkäuflich, ist jedenfalls besser verkäuflich,
wenn es gerahmt ist. Rahmen sind heute sehr teuer, um
so teurer, je besser sie sind, und da ebenfalls eine Sonder-
steuer von fünfzehn Prozent darauf erhoben wird. Diese
Steuer wird vom Rahmenmacher natürlich dem Künstler zu-
geschoben. Für einen vergoldeten Rahmen müssen ungefähr
vierhundert Mark gerechnet werden. Ateliermiete für einen
Monat und Heizung (wenn Aktmodell nötig ist, muß es
hübsch warm sein) kosten auch wenigstens zweihundert Mark.
Dazu kommen noch die fünfzehn Prozent Steuer von zwei-
tausend Mark, das sind weiterhin dreihundert Mark. Rechnet
man für Blendrahmen, Leinwand, Pinsel und Farben, alles
sehr kostspielige Dinge heute, nur hundertfünfzig Mark, so
ergibt sich eine Unkostensumme von dreizehnhundert Mark.
Der Maler verdient in einem Monat also siebenhundert
Mark, wobei die Unkosten der vielen verdienstlosen Studien-
jahre nicht in Anschlag gebracht sind, und ohne jede Ga-
rantie, daß er nun auch in jedem Monat ein Bild malen
und für zweitausend Mark verkaufen kann. Das ist noch
der günstigste Fall. Stellt der Maler sein Bild in einer Aus-
stellung oder in einer Kunsthandlung aus, so muß er dem
Veranstalter etwa fünfundzwanzig Prozent der Gesamt-
summe überlassen, ohne daß ihm die Luxussteuer geschenkt
ist; denn der Kunsthändler wird in vielen Fällen sagen: wir
wollen uns die Steuer teilen und jeder siebeneinhalb Prozent
zahlen. Und der Künstler wird wohl oder übel zustimmen
dürfen. In diesem Falle bliebe dem Künstler also ein Rein-
gewinn von dreihundertfünfzig Mark. Doch muß die Ein-
nahme dann nochmals nach den Forderungen der Staatsein-
kommen-, Gemeinde-, Kirchensteuer usw. versteuert werden.
Ein anderer Fall. Ein Bildhauer von Ruf hat den Auf-
trag eine Bronze in bestimmter Größe für einen bestimmten
Platz zu schaffen. Als Preis sind fünfzehntausend Mark
ausgemacht. Die Arbeitszeit beträgt wenigstens zwei Monate.
Material und Guß kosten nach heutigen Preisen neuntausend
Mark. Für einen Hilfsarbeiter, für Hilfsmaterial und viele
kleine Unkosten sind tausend Mark zu rechnen, für das
Atelier — das beim Bildhauer ja besonders geräumig sein
und zu ebener Erde liegen muß —'und für Heizung sind
in zwei Monaten ebenfalls tausend Mark anzusetzen. Nimmt
man nun an, daß es sich um ein Bildwerk handelt, wozu
der Künstler Modell nicht braucht — eine Ausnahme! —
und zählt man die Steuer von fünfzehn vom Hundert, also
2250 Mark, den Unkosten hinzu, so machen die Auslagen
13250 Mark, und es bleiben dem namhaften Künstler für
eine neunwöchige Tätigkeit 1750 Mark. Da lacht jeder
ungelernte Arbeiter! Dabei sind auch hier wieder alle
Vorstudien und Nebendinge nicht gerechnet. Und es ist
der Fall noch besonders günstig angenommen; es kommt
nicht selten vor, daß ein Bildhauer bei großen Aufträgen,
wenn es sich um Objekte handelt, die nur einmal hergestellt
werden, ganz ohne Verdienst ausgeht, oder gar bares Geld
zusetzt, der wertvollen Aufgabe zuliebe.
Der Künstler soll in Zukunft Bücher führen, wohl gar
ein „Lagerbuch". Ob die Gesetzesfabrikanten wohl jemals
in einem Atelier gewesen sind? Ob sie wissen, was Künstler
sind und wie sie arbeiten? Der Maler kratzt unzufrieden
alles weg, was er in einer Woche gemalt hat, er vernichtet
im Augenblick oft das Werk saurer Monate. Der Bildhauer
entschließt sich über Nacht, die schon begonnene Gruppe
größer zu machen, oder er entscheidet sich für ein anderes
Material. Da verkauft ein Maler ein Bild, nimmt es gegen
ein anderes wieder zurück, weils ihm nicht mehr gefällt,
läßt es einem Kollegen halb so billig wie einem Fremden
oder tauscht gar mit dem Kollegen. Ein Künstler kalkuliert
nicht wie ein Kaufmann, nicht einmal wie ein Handwerker.
Tut er es aber doch und mit Erfolg, so ist er ein schlechter
Künstler. Er hat nur ein wahrhaft lebendiges Interesse:
seine Sachen so gut wie möglich zu machen, immer wieder
zu probieren, zu vernichten und neu zu beginnen. Das aber
will der Gesetzgeber nicht leiden. Er will einen Künstler
mit Geschäftsgeist, einen bürokratisierten Künstler. Noch
mehr, er will einen schlechten Künstler, denn wo wird
jener junge Maler sparen, um für sich noch einen zureichen-
den Ertrag herauswirtschaften zu können? Er wird am
Modellgeld sparen, an den Studien, er wird schludern und
oberflächlich werden. Um so mehr als er sich moralisch
bedrückt fühlen muß, wenn ihm eine Steuer auferlegt wird,
die wie eine Strafe dafür erscheint, daß er zweckfrei das
Schöne sucht, wenn Werke seiner geistigen Inbrunst den
steuerpflichtigen Luxusdingen, den Galanteriewagen gleich-
gestellt werden. Schließlich ist es nicht ganz zufällig, daß
man die Kunst einen freien Beruf nennt. Die Freiheit, die
dem Künstler so nötig ist, wie gute Luft den Lungen, wird
von diesem Gesetz gedrosselt. Es belastet den Künstler
dort, wo er am empfindlichsten ist. Man stelle sich Leibi
oder Marees vor, wie sie am Abend ihre Bücher in Ord-
nung bringen und Stempelmarken kleben! Es verleitet das
?39