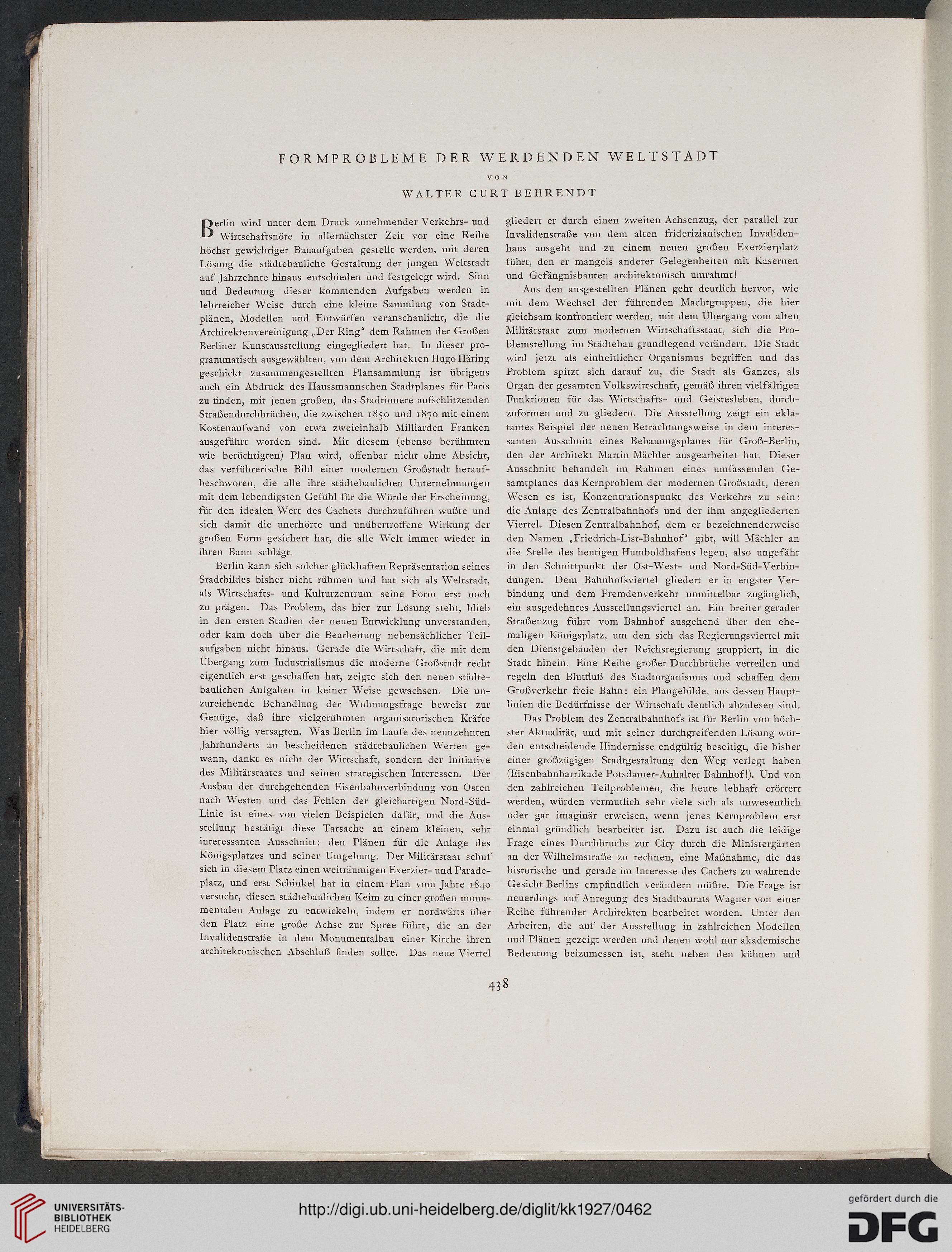FORMPROBLEME DER WERDENDEN WELTSTADT
WALTER CURT BEHRENDT
Berlin wird unter dem Druck zunehmender Verkehrs- und
Wirtschaftsnöte in allernächster Zeit vor eine Reihe
höchst gewichtiger Bauaufgaben gestellt werden, mit deren
Lösung die städtebauliche Gestaltung der jungen Weltstadt
auf Jahrzehnte hinaus entschieden und festgelegt wird. Sinn
und Bedeutung dieser kommenden Aufgaben werden in
lehrreicher Weise durch eine kleine Sammlung von Stadt-
plänen, Modellen und Entwürfen veranschaulicht, die die
Architektenvereinigung „Der Ring" dem Rahmen der Großen
Berliner Kunstausstellung eingegliedert hat. In dieser pro-
grammatisch ausgewählten, von dem Architekten Hugo Häring
geschickt zusammengestellten Plansammlung ist übrigens
auch ein Abdruck des Haussmannschen Stadtplanes für Paris
zu finden, mit jenen großen, das Stadtinnere aufschlitzenden
Straßendurchbrüchen, die zwischen 1850 und 1870 mit einem
Kostenaufwand von etwa zweieinhalb Milliarden Franken
ausgeführt worden sind. Mit diesem (ebenso berühmten
wie berüchtigten) Plan wird, offenbar nicht ohne Absicht,
das verführerische Bild einer modernen Großstadt herauf-
beschworen, die alle ihre städtebaulichen Unternehmungen
mit dem lebendigsten Gefühl für die Würde der Erscheinung,
für den idealen Wert des Cachets durchzuführen wußte und
sich damit die unerhörte und unübertroffene Wirkung der
großen Form gesichert hat, die alle Welt immer wieder in
ihren Bann schlägt.
Berlin kann sich solcher glückhaften Repräsentation seines
Stadtbildes bisher nicht rühmen und hat sich als Weltstadt,
als Wirtschafts- und Kulturzentrum seine Form erst noch
zu prägen. Das Problem, das hier zur Lösung steht, blieb
in den ersten Stadien der neuen Entwicklung unverstanden,
oder kam doch über die Bearbeitung nebensächlicher Teil-
aufgaben nicht hinaus. Gerade die Wirtschaft, die mit dem
Übergang zum Industrialismus die moderne Großstadt recht
eigentlich erst geschaffen hat, zeigte sich den neuen städte-
baulichen Aufgaben in keiner Weise gewachsen. Die un-
zureichende Behandlung der Wohnungsfrage beweist zur
Genüge, daß ihre vielgerühmten organisatorischen Kräfte
hier völlig versagten. Was Berlin im Laufe des neunzehnten
Jahrhunderts an bescheidenen städtebaulichen Werten ge-
wann, dankt es nicht der Wirtschaft, sondern der Initiative
des Militärstaates und seinen strategischen Interessen. Der
Ausbau der durchgehenden Eisenbahnverbindung von Osten
nach Westen und das Fehlen der gleichartigen Nord-Süd-
Linie ist eines von vielen Beispielen dafür, und die Aus-
stellung bestätigt diese Tatsache an einem kleinen, sehr
interessanten Ausschnitt: den Plänen für die Anlage des
Königsplatzes und seiner Umgebung. Der Militärstaat schuf
sich in diesem Platz einen weiträumigen Exerzier- und Parade-
platz, und erst Schinkel hat in einem Plan vom Jahre 1840
versucht, diesen städtebaulichen Keim zu einer großen monu-
mentalen Anlage zu entwickeln, indem er nordwärts über
den Platz eine große Achse zur Spree führt, die an der
Invalidenstraße in dem Monumentalbau einer Kirche ihren
architektonischen Abschluß finden sollte. Das neue Viertel
gliedert er durch einen zweiten Achsenzug, der parallel zur
Invalidenstraße von dem alten friderizianischen Invaliden-
haus ausgeht und zu einem neuen großen Exerzierplatz
führt, den er mangels anderer Gelegenheiten mit Kasernen
und Gefängnisbauten architektonisch umrahmt!
Aus den ausgestellten Plänen geht deutlich hervor, wie
mit dem Wechsel der führenden Machtgruppen, die hier
gleichsam konfrontiert werden, mit dem Übergang vom alten
Militärstaat zum modernen Wirtschaftsstaat, sich die Pro-
blemstellung im Städtebau grundlegend verändert. Die Stadt
wird jetzt als einheitlicher Organismus begriffen und das
Problem spitzt sich darauf zu, die Stadt als Ganzes, als
Organ der gesamten Volkswirtschaft, gemäß ihren vielfältigen
Funktionen für das Wirtschafts- und Geistesleben, durch-
zuformen und zu gliedern. Die Ausstellung zeigt ein ekla-
tantes Beispiel der neuen Betrachtungsweise in dem interes-
santen Ausschnitt eines Bebauungsplanes für Groß-Berlin,
den der Architekt Martin Mächler ausgearbeitet hat. Dieser
Ausschnitt behandelt im Rahmen eines umfassenden Ge-
samtplanes das Kernproblem der modernen Großstadt, deren
Wesen es ist, Konzentrationspunkt des Verkehrs zu sein:
die Anlage des Zentralbahnhofs und der ihm angegliederten
Viertel. Diesen Zentralbahnhof, dem er bezeichnenderweise
den Namen „Friedrich-List-Bahnhof" gibt, will Mächler an
die Stelle des heutigen Humboldhafens legen, also ungefähr
in den Schnittpunkt der Ost-West- und Nord-Süd-Verbin-
dungen. Dem Bahnhofsviertel gliedert er in engster Ver-
bindung und dem Fremdenverkehr unmittelbar zugänglich,
ein ausgedehntes Ausstellungsviertel an. Ein breiter gerader
Straßenzug führt vom Bahnhof ausgehend über den ehe-
maligen Königsplatz, um den sich das Regierungsviertel mit
den Dienstgebäuden der Reichsregierung gruppiert, in die
Stadt hinein. Eine Reihe großer Durchbrüche verteilen und
regeln den Blutfluß des Stadtorganismus und schaffen dem
Großverkehr freie Bahn: ein Plangebilde, aus dessen Haupt-
linien die Bedürfnisse der Wirtschaft deutlich abzulesen sind.
Das Problem des Zentralbahnhofs ist für Berlin von höch-
ster Aktualität, und mit seiner durchgreifenden Lösung wür-
den entscheidende Hindernisse endgültig beseitigt, die bisher
einer großzügigen Stadtgestaltung den Weg verlegt haben
(Eisenbahnbarrikade Potsdamer-Anhalter Bahnhof!). Und von
den zahlreichen Teilproblemen, die heute lebhaft erörtert
werden, würden vermutlich sehr viele sich als unwesentlich
oder gar imaginär erweisen, wenn jenes Kernproblem erst
einmal gründlich bearbeitet ist. Dazu ist auch die leidige
Frage eines Durchbruchs zur City durch die Ministergärten
an der Wilhelmstraße zu rechnen, eine Maßnahme, die das
historische und gerade im Interesse des Cachets zu wahrende
Gesicht Berlins empfindlich verändern müßte. Die Frage ist
neuerdings auf Anregung des Stadtbaurats Wagner von einer
Reihe führender Architekten bearbeitet worden. Unter den
Arbeiten, die auf der Ausstellung in zahlreichen Modellen
und Plänen gezeigt werden und denen wohl nur akademische
Bedeutung beizumessen ist, steht neben den kühnen und
438
WALTER CURT BEHRENDT
Berlin wird unter dem Druck zunehmender Verkehrs- und
Wirtschaftsnöte in allernächster Zeit vor eine Reihe
höchst gewichtiger Bauaufgaben gestellt werden, mit deren
Lösung die städtebauliche Gestaltung der jungen Weltstadt
auf Jahrzehnte hinaus entschieden und festgelegt wird. Sinn
und Bedeutung dieser kommenden Aufgaben werden in
lehrreicher Weise durch eine kleine Sammlung von Stadt-
plänen, Modellen und Entwürfen veranschaulicht, die die
Architektenvereinigung „Der Ring" dem Rahmen der Großen
Berliner Kunstausstellung eingegliedert hat. In dieser pro-
grammatisch ausgewählten, von dem Architekten Hugo Häring
geschickt zusammengestellten Plansammlung ist übrigens
auch ein Abdruck des Haussmannschen Stadtplanes für Paris
zu finden, mit jenen großen, das Stadtinnere aufschlitzenden
Straßendurchbrüchen, die zwischen 1850 und 1870 mit einem
Kostenaufwand von etwa zweieinhalb Milliarden Franken
ausgeführt worden sind. Mit diesem (ebenso berühmten
wie berüchtigten) Plan wird, offenbar nicht ohne Absicht,
das verführerische Bild einer modernen Großstadt herauf-
beschworen, die alle ihre städtebaulichen Unternehmungen
mit dem lebendigsten Gefühl für die Würde der Erscheinung,
für den idealen Wert des Cachets durchzuführen wußte und
sich damit die unerhörte und unübertroffene Wirkung der
großen Form gesichert hat, die alle Welt immer wieder in
ihren Bann schlägt.
Berlin kann sich solcher glückhaften Repräsentation seines
Stadtbildes bisher nicht rühmen und hat sich als Weltstadt,
als Wirtschafts- und Kulturzentrum seine Form erst noch
zu prägen. Das Problem, das hier zur Lösung steht, blieb
in den ersten Stadien der neuen Entwicklung unverstanden,
oder kam doch über die Bearbeitung nebensächlicher Teil-
aufgaben nicht hinaus. Gerade die Wirtschaft, die mit dem
Übergang zum Industrialismus die moderne Großstadt recht
eigentlich erst geschaffen hat, zeigte sich den neuen städte-
baulichen Aufgaben in keiner Weise gewachsen. Die un-
zureichende Behandlung der Wohnungsfrage beweist zur
Genüge, daß ihre vielgerühmten organisatorischen Kräfte
hier völlig versagten. Was Berlin im Laufe des neunzehnten
Jahrhunderts an bescheidenen städtebaulichen Werten ge-
wann, dankt es nicht der Wirtschaft, sondern der Initiative
des Militärstaates und seinen strategischen Interessen. Der
Ausbau der durchgehenden Eisenbahnverbindung von Osten
nach Westen und das Fehlen der gleichartigen Nord-Süd-
Linie ist eines von vielen Beispielen dafür, und die Aus-
stellung bestätigt diese Tatsache an einem kleinen, sehr
interessanten Ausschnitt: den Plänen für die Anlage des
Königsplatzes und seiner Umgebung. Der Militärstaat schuf
sich in diesem Platz einen weiträumigen Exerzier- und Parade-
platz, und erst Schinkel hat in einem Plan vom Jahre 1840
versucht, diesen städtebaulichen Keim zu einer großen monu-
mentalen Anlage zu entwickeln, indem er nordwärts über
den Platz eine große Achse zur Spree führt, die an der
Invalidenstraße in dem Monumentalbau einer Kirche ihren
architektonischen Abschluß finden sollte. Das neue Viertel
gliedert er durch einen zweiten Achsenzug, der parallel zur
Invalidenstraße von dem alten friderizianischen Invaliden-
haus ausgeht und zu einem neuen großen Exerzierplatz
führt, den er mangels anderer Gelegenheiten mit Kasernen
und Gefängnisbauten architektonisch umrahmt!
Aus den ausgestellten Plänen geht deutlich hervor, wie
mit dem Wechsel der führenden Machtgruppen, die hier
gleichsam konfrontiert werden, mit dem Übergang vom alten
Militärstaat zum modernen Wirtschaftsstaat, sich die Pro-
blemstellung im Städtebau grundlegend verändert. Die Stadt
wird jetzt als einheitlicher Organismus begriffen und das
Problem spitzt sich darauf zu, die Stadt als Ganzes, als
Organ der gesamten Volkswirtschaft, gemäß ihren vielfältigen
Funktionen für das Wirtschafts- und Geistesleben, durch-
zuformen und zu gliedern. Die Ausstellung zeigt ein ekla-
tantes Beispiel der neuen Betrachtungsweise in dem interes-
santen Ausschnitt eines Bebauungsplanes für Groß-Berlin,
den der Architekt Martin Mächler ausgearbeitet hat. Dieser
Ausschnitt behandelt im Rahmen eines umfassenden Ge-
samtplanes das Kernproblem der modernen Großstadt, deren
Wesen es ist, Konzentrationspunkt des Verkehrs zu sein:
die Anlage des Zentralbahnhofs und der ihm angegliederten
Viertel. Diesen Zentralbahnhof, dem er bezeichnenderweise
den Namen „Friedrich-List-Bahnhof" gibt, will Mächler an
die Stelle des heutigen Humboldhafens legen, also ungefähr
in den Schnittpunkt der Ost-West- und Nord-Süd-Verbin-
dungen. Dem Bahnhofsviertel gliedert er in engster Ver-
bindung und dem Fremdenverkehr unmittelbar zugänglich,
ein ausgedehntes Ausstellungsviertel an. Ein breiter gerader
Straßenzug führt vom Bahnhof ausgehend über den ehe-
maligen Königsplatz, um den sich das Regierungsviertel mit
den Dienstgebäuden der Reichsregierung gruppiert, in die
Stadt hinein. Eine Reihe großer Durchbrüche verteilen und
regeln den Blutfluß des Stadtorganismus und schaffen dem
Großverkehr freie Bahn: ein Plangebilde, aus dessen Haupt-
linien die Bedürfnisse der Wirtschaft deutlich abzulesen sind.
Das Problem des Zentralbahnhofs ist für Berlin von höch-
ster Aktualität, und mit seiner durchgreifenden Lösung wür-
den entscheidende Hindernisse endgültig beseitigt, die bisher
einer großzügigen Stadtgestaltung den Weg verlegt haben
(Eisenbahnbarrikade Potsdamer-Anhalter Bahnhof!). Und von
den zahlreichen Teilproblemen, die heute lebhaft erörtert
werden, würden vermutlich sehr viele sich als unwesentlich
oder gar imaginär erweisen, wenn jenes Kernproblem erst
einmal gründlich bearbeitet ist. Dazu ist auch die leidige
Frage eines Durchbruchs zur City durch die Ministergärten
an der Wilhelmstraße zu rechnen, eine Maßnahme, die das
historische und gerade im Interesse des Cachets zu wahrende
Gesicht Berlins empfindlich verändern müßte. Die Frage ist
neuerdings auf Anregung des Stadtbaurats Wagner von einer
Reihe führender Architekten bearbeitet worden. Unter den
Arbeiten, die auf der Ausstellung in zahlreichen Modellen
und Plänen gezeigt werden und denen wohl nur akademische
Bedeutung beizumessen ist, steht neben den kühnen und
438