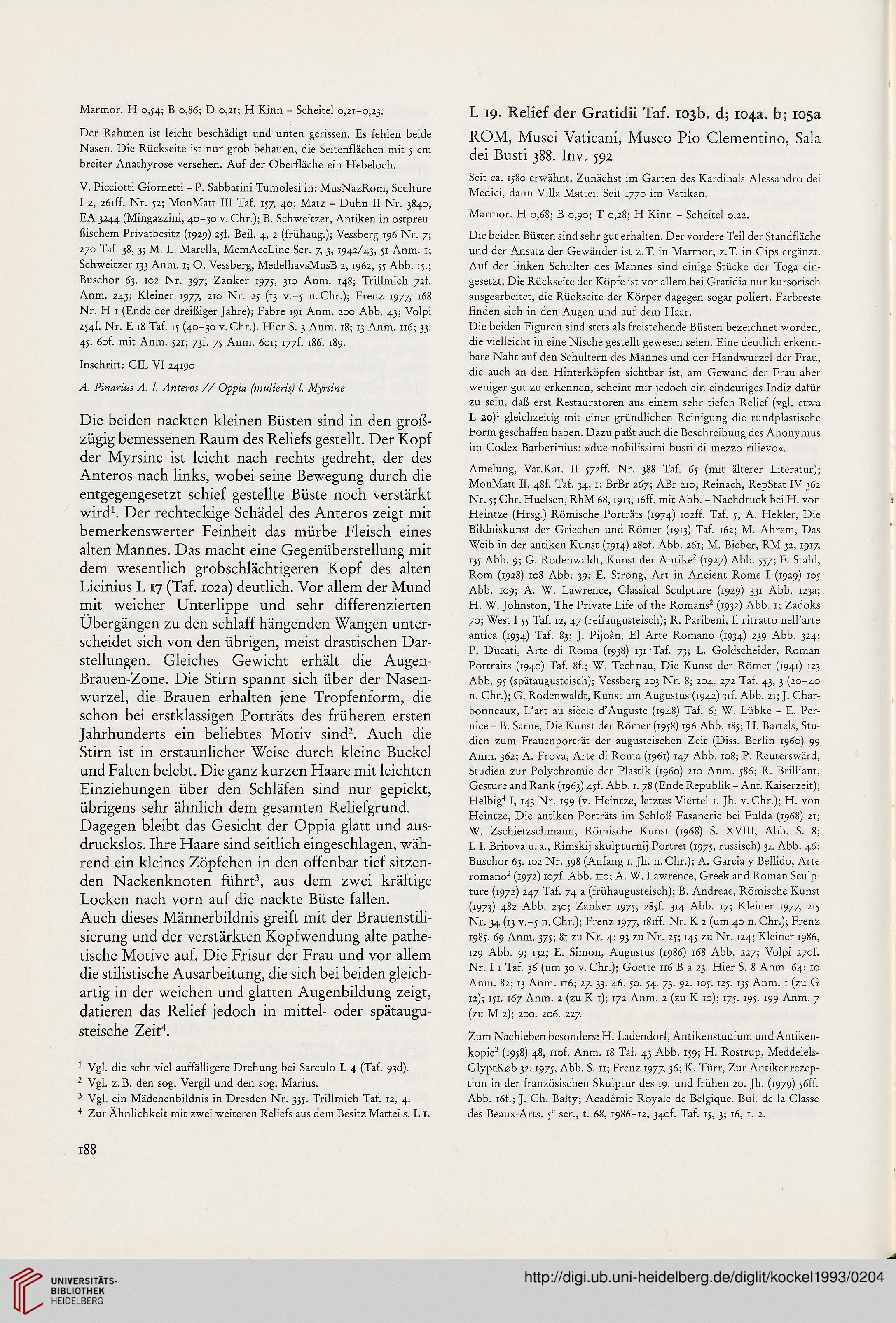Marmor. H 0,54; B 0,86; D 0,21; H Kinn - Scheitel 0,21-0,23.
Der Rahmen ist leicht beschädigt und unten gerissen. Es fehlen beide
Nasen. Die Rückseite ist nur grob behauen, die Seitenflächen mit 5 cm
breiter Anathyrose versehen. Auf der Oberfläche ein Hebeloch.
V. Picciotti Giornetti - P. Sabbatini Tumolesi in: MusNazRom, Sculture
I 2, 26iff. Nr. 52; MonMatt III Taf. 157, 40; Matz - Duhn II Nr. 3840;
EA 3244 (Mingazzini, 40-30 v. Chr.); B. Schweitzer, Antiken in ostpreu-
ßischem Privatbesitz (1929) 2yf. Beil. 4, 2 (frühaug.); Vessberg 196 Nr. 7;
270 Taf. 38, 3; M. L. Marella, MemAccLinc Ser. 7, 3, 1942/43, 51 Anm. 1;
Schweitzer 133 Anm. 1; O. Vessberg, MedelhavsMusB 2,1962, 55 Abb. 15.;
Buschor 63. 102 Nr. 397; Zänker 1975, 310 Anm. 148; Trillmich 72h
Anm. 243; Kleiner 1977, 210 Nr. 23 (13 V.-5 n. Chr.); Frenz 1977, 168
Nr. H 1 (Ende der dreißiger Jahre); Fahre 191 Anm. 200 Abb. 43; Volpi
254h Nr. E 18 Taf. 15 (40-30 v. Chr.). Hier S. 3 Anm. 18; 13 Anm. 116; 33.
45. 6of. mit Anm. 521; 73h 75 Anm. 601; 177h 186. 189.
Inschrift: CIL VI 24190
A. Pinarius A. I. Anteros // Oppia (mulieris) l. Myrsine
Die beiden nackten kleinen Büsten sind in den groß-
zügig bemessenen Raum des Reliefs gestellt. Der Kopf
der Myrsine ist leicht nach rechts gedreht, der des
Anteros nach links, wobei seine Bewegung durch die
entgegengesetzt schief gestellte Büste noch verstärkt
wird1. Der rechteckige Schädel des Anteros zeigt mit
bemerkenswerter Feinheit das mürbe Fleisch eines
alten Mannes. Das macht eine Gegenüberstellung mit
dem wesentlich grobschlächtigeren Kopf des alten
Licinius L 17 (Taf. 102a) deutlich. Vor allem der Mund
mit weicher Unterlippe und sehr differenzierten
Übergängen zu den schlaff hängenden Wangen unter-
scheidet sich von den übrigen, meist drastischen Dar-
stellungen. Gleiches Gewicht erhält die Augen-
Brauen-Zone. Die Stirn spannt sich über der Nasen-
wurzel, die Brauen erhalten jene Tropfenform, die
schon bei erstklassigen Porträts des früheren ersten
Jahrhunderts ein beliebtes Motiv sind1 2. Auch die
Stirn ist in erstaunlicher Weise durch kleine Buckel
und Falten belebt. Die ganz kurzen Haare mit leichten
Einziehungen über den Schläfen sind nur gepickt,
übrigens sehr ähnlich dem gesamten Reliefgrund.
Dagegen bleibt das Gesicht der Oppia glatt und aus-
druckslos. Ihre Haare sind seitlich eingeschlagen, wäh-
rend ein kleines Zöpfchen in den offenbar tief sitzen-
den Nackenknoten führt3, aus dem zwei kräftige
Locken nach vorn auf die nackte Büste fallen.
Auch dieses Männerbildnis greift mit der Brauenstili-
sierung und der verstärkten Kopfwendung alte pathe-
tische Motive auf. Die Frisur der Frau und vor allem
die stilistische Ausarbeitung, die sich bei beiden gleich-
artig in der weichen und glatten Augenbildung zeigt,
datieren das Relief jedoch in mittel- oder spätaugu-
steische Zeit4.
1 Vgl. die sehr viel auffälligere Drehung bei Sarculo L 4 (Taf. 93d).
2 Vgl. z. B. den sog. Vergil und den sog. Marius.
3 Vgl. ein Mädchenbildnis in Dresden Nr. 335. Trillmich Taf. 12, 4.
4 Zur Ähnlichkeit mit zwei weiteren Reliefs aus dem Besitz Mattei s. LI.
L 19. Relief der Gratidii Taf. 103b. d; 104a. b; 105a
ROM, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, Sala
dei Busti 388. Inv. 592
Seit ca. 1580 erwähnt. Zunächst im Garten des Kardinals Alessandro dei
Medici, dann Villa Mattei. Seit 1770 im Vatikan.
Marmor. H 0,68; B 0,90; T 0,28; H Kinn - Scheitel 0,22.
Die beiden Büsten sind sehr gut erhalten. Der vordere Teil der Standfläche
und der Ansatz der Gewänder ist z.T. in Marmor, z.T. in Gips ergänzt.
Auf der linken Schulter des Mannes sind einige Stücke der Toga ein-
gesetzt. Die Rückseite der Köpfe ist vor allem bei Gratidia nur kursorisch
ausgearbeitet, die Rückseite der Körper dagegen sogar poliert. Farbreste
finden sich in den Augen und auf dem Haar.
Die beiden Figuren sind stets als freistehende Büsten bezeichnet worden,
die vielleicht in eine Nische gestellt gewesen seien. Eine deutlich erkenn-
bare Naht auf den Schultern des Mannes und der Handwurzel der Frau,
die auch an den Hinterköpfen sichtbar ist, am Gewand der Frau aber
weniger gut zu erkennen, scheint mir jedoch ein eindeutiges Indiz dafür
zu sein, daß erst Restauratoren aus einem sehr tiefen Relief (vgl. etwa
L 20)1 gleichzeitig mit einer gründlichen Reinigung die rundplastische
Form geschaffen haben. Dazu paßt auch die Beschreibung des Anonymus
im Codex Barberinius: »due nobilissimi busti di mezzo rilievo«.
Amelung, Vat.Kat. II 572ff. Nr. 388 Taf. 65 (mit älterer Literatur);
MonMatt II, 48L Taf. 34, 1; BrBr 267; ABr 210; Reinach, RepStat IV 362
Nr. 5; Chr. Huelsen, RhM 68,1913, i6ff. mit Abb. - Nachdruck bei H. von
Heintze (Hrsg.) Römische Porträts (1974) i02ff. Taf. 5; A. Hekler, Die
Bildniskunst der Griechen und Römer (1913) Taf. 162; M. Ahrem, Das
Weib in der antiken Kunst (1914) 28of. Abb. 261; M. Bieber, RM 32, 1917,
135 Abb. 9; G. Rodenwaldt, Kunst der Antike2 (1927) Abb. 557; F. Stahl,
Rom (1928) 108 Abb. 39; E. Strong, Art in Ancient Rome I (1929) 105
Abb. 109; A. W. Lawrence, Classical Sculpture (1929) 331 Abb. 123a;
H. W. Johnston, The Private Life of the Romans2 (1932) Abb. 1; Zadoks
70; West I 55 Taf. 12, 47 (reifaugusteisch); R. Paribeni, II ritratto nell’arte
antica (1934) Taf. 83; J. Pijoän, El Arte Romano (1934) 239 Abb. 324;
P. Ducati, Arte di Roma (1938) 131 Taf. 73; L. Goldscheider, Roman
Portraits (1940) Taf. 8f.; W. Technau, Die Kunst der Römer (1941) 123
Abb. 95 (spätaugusteisch); Vessberg 203 Nr. 8; 204. 272 Taf. 43, 3 (20-40
n. Chr.); G. Rodenwaldt, Kunst um Augustus (1942) 31L Abb. 21; J. Char-
bonneaux, L’art au siede d’Auguste (1948) Taf. 6; W. Lübke - E. Per-
nice - B. Sarne, Die Kunst der Römer (1958) 196 Abb. 185; H. Bartels, Stu-
dien zum Frauenporträt der augusteischen Zeit (Diss. Berlin i960) 99
Anm. 362; A. Frova, Arte di Roma (1961) 147 Abb. 108; P. Reuterswärd,
Studien zur Polychromie der Plastik (i960) 210 Anm. 586; R. Brilliant,
Gesture and Rank (1963) 45L Abb. 1. 78 (Ende Republik - Anf. Kaiserzeit);
Helbig4 I, 143 Nr. 199 (v. Heintze, letztes Viertel 1. Jh. v. Chr.); H. von
Heintze, Die antiken Porträts im Schloß Fasanerie bei Fulda (1968) 21;
W. Zschietzschmann, Römische Kunst (1968) S. XVIII, Abb. S. 8;
I. I. Britova u. a., Rimskij skulpturnij Portret (1975, russisch) 34 Abb. 46;
Buschor 63.102 Nr. 398 (Anfang 1. Jh. n. Chr.); A. Garcia y Beilido, Arte
romano2 (1972) 107L Abb. 110; A. W. Lawrence, Greek and Roman Sculp-
ture (1972) 247 Taf. 74 a (frühaugusteisch); B. Andreae, Römische Kunst
(1973) 482 Abb. 230; Zänker 1975, 285L 314 Abb. 17; Kleiner 1977, 215
Nr. 34 (13 V.-5 n. Chr.); Frenz 1977, i8iff. Nr. K 2 (um 40 n. Chr.); Frenz
1985, 69 Anm. 375; 81 zu Nr. 4; 93 zu Nr. 25; 145 zu Nr. 124; Kleiner 1986,
129 Abb. 9; 132; E. Simon, Augustus (1986) 168 Abb. 227; Volpi 270L
Nr. 11 Taf. 36 (um 30 v. Chr.); Goette 116 B a 23. Hier S. 8 Anm. 64; 10
Anm. 82; 13 Anm. 116; 27. 33. 46. 50. 54. 73. 92. 105. 125. 135 Anm. 1 (zu G
12); 151. 167 Anm. 2 (zu K 1); 172 Anm. 2 (zu K 10); 175. 195. 199 Anm. 7
(zu M 2); 200. 206. 227.
Zum Nachleben besonders: H. Ladendorf, Antikenstudium und Antiken-
kopie2 (1958) 48, iiof. Anm. 18 Taf. 43 Abb. 159; H. Rostrup, Meddelels-
GlyptKob 32,1975, Abb. S. 11; Frenz 1977, 36; K. Türr, Zur Antikenrezep-
tion in der französischen Skulptur des 19. und frühen 20. Jh. (1979) 56ff.
Abb. i6f.; J. Ch. Balty; Academie Royale de Belgique. Bul. de la Classe
des Beaux-Arts. 5e ser., t. 68, 1986-12, 340L Taf. 15, 3; 16, 1. 2.
188
Der Rahmen ist leicht beschädigt und unten gerissen. Es fehlen beide
Nasen. Die Rückseite ist nur grob behauen, die Seitenflächen mit 5 cm
breiter Anathyrose versehen. Auf der Oberfläche ein Hebeloch.
V. Picciotti Giornetti - P. Sabbatini Tumolesi in: MusNazRom, Sculture
I 2, 26iff. Nr. 52; MonMatt III Taf. 157, 40; Matz - Duhn II Nr. 3840;
EA 3244 (Mingazzini, 40-30 v. Chr.); B. Schweitzer, Antiken in ostpreu-
ßischem Privatbesitz (1929) 2yf. Beil. 4, 2 (frühaug.); Vessberg 196 Nr. 7;
270 Taf. 38, 3; M. L. Marella, MemAccLinc Ser. 7, 3, 1942/43, 51 Anm. 1;
Schweitzer 133 Anm. 1; O. Vessberg, MedelhavsMusB 2,1962, 55 Abb. 15.;
Buschor 63. 102 Nr. 397; Zänker 1975, 310 Anm. 148; Trillmich 72h
Anm. 243; Kleiner 1977, 210 Nr. 23 (13 V.-5 n. Chr.); Frenz 1977, 168
Nr. H 1 (Ende der dreißiger Jahre); Fahre 191 Anm. 200 Abb. 43; Volpi
254h Nr. E 18 Taf. 15 (40-30 v. Chr.). Hier S. 3 Anm. 18; 13 Anm. 116; 33.
45. 6of. mit Anm. 521; 73h 75 Anm. 601; 177h 186. 189.
Inschrift: CIL VI 24190
A. Pinarius A. I. Anteros // Oppia (mulieris) l. Myrsine
Die beiden nackten kleinen Büsten sind in den groß-
zügig bemessenen Raum des Reliefs gestellt. Der Kopf
der Myrsine ist leicht nach rechts gedreht, der des
Anteros nach links, wobei seine Bewegung durch die
entgegengesetzt schief gestellte Büste noch verstärkt
wird1. Der rechteckige Schädel des Anteros zeigt mit
bemerkenswerter Feinheit das mürbe Fleisch eines
alten Mannes. Das macht eine Gegenüberstellung mit
dem wesentlich grobschlächtigeren Kopf des alten
Licinius L 17 (Taf. 102a) deutlich. Vor allem der Mund
mit weicher Unterlippe und sehr differenzierten
Übergängen zu den schlaff hängenden Wangen unter-
scheidet sich von den übrigen, meist drastischen Dar-
stellungen. Gleiches Gewicht erhält die Augen-
Brauen-Zone. Die Stirn spannt sich über der Nasen-
wurzel, die Brauen erhalten jene Tropfenform, die
schon bei erstklassigen Porträts des früheren ersten
Jahrhunderts ein beliebtes Motiv sind1 2. Auch die
Stirn ist in erstaunlicher Weise durch kleine Buckel
und Falten belebt. Die ganz kurzen Haare mit leichten
Einziehungen über den Schläfen sind nur gepickt,
übrigens sehr ähnlich dem gesamten Reliefgrund.
Dagegen bleibt das Gesicht der Oppia glatt und aus-
druckslos. Ihre Haare sind seitlich eingeschlagen, wäh-
rend ein kleines Zöpfchen in den offenbar tief sitzen-
den Nackenknoten führt3, aus dem zwei kräftige
Locken nach vorn auf die nackte Büste fallen.
Auch dieses Männerbildnis greift mit der Brauenstili-
sierung und der verstärkten Kopfwendung alte pathe-
tische Motive auf. Die Frisur der Frau und vor allem
die stilistische Ausarbeitung, die sich bei beiden gleich-
artig in der weichen und glatten Augenbildung zeigt,
datieren das Relief jedoch in mittel- oder spätaugu-
steische Zeit4.
1 Vgl. die sehr viel auffälligere Drehung bei Sarculo L 4 (Taf. 93d).
2 Vgl. z. B. den sog. Vergil und den sog. Marius.
3 Vgl. ein Mädchenbildnis in Dresden Nr. 335. Trillmich Taf. 12, 4.
4 Zur Ähnlichkeit mit zwei weiteren Reliefs aus dem Besitz Mattei s. LI.
L 19. Relief der Gratidii Taf. 103b. d; 104a. b; 105a
ROM, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, Sala
dei Busti 388. Inv. 592
Seit ca. 1580 erwähnt. Zunächst im Garten des Kardinals Alessandro dei
Medici, dann Villa Mattei. Seit 1770 im Vatikan.
Marmor. H 0,68; B 0,90; T 0,28; H Kinn - Scheitel 0,22.
Die beiden Büsten sind sehr gut erhalten. Der vordere Teil der Standfläche
und der Ansatz der Gewänder ist z.T. in Marmor, z.T. in Gips ergänzt.
Auf der linken Schulter des Mannes sind einige Stücke der Toga ein-
gesetzt. Die Rückseite der Köpfe ist vor allem bei Gratidia nur kursorisch
ausgearbeitet, die Rückseite der Körper dagegen sogar poliert. Farbreste
finden sich in den Augen und auf dem Haar.
Die beiden Figuren sind stets als freistehende Büsten bezeichnet worden,
die vielleicht in eine Nische gestellt gewesen seien. Eine deutlich erkenn-
bare Naht auf den Schultern des Mannes und der Handwurzel der Frau,
die auch an den Hinterköpfen sichtbar ist, am Gewand der Frau aber
weniger gut zu erkennen, scheint mir jedoch ein eindeutiges Indiz dafür
zu sein, daß erst Restauratoren aus einem sehr tiefen Relief (vgl. etwa
L 20)1 gleichzeitig mit einer gründlichen Reinigung die rundplastische
Form geschaffen haben. Dazu paßt auch die Beschreibung des Anonymus
im Codex Barberinius: »due nobilissimi busti di mezzo rilievo«.
Amelung, Vat.Kat. II 572ff. Nr. 388 Taf. 65 (mit älterer Literatur);
MonMatt II, 48L Taf. 34, 1; BrBr 267; ABr 210; Reinach, RepStat IV 362
Nr. 5; Chr. Huelsen, RhM 68,1913, i6ff. mit Abb. - Nachdruck bei H. von
Heintze (Hrsg.) Römische Porträts (1974) i02ff. Taf. 5; A. Hekler, Die
Bildniskunst der Griechen und Römer (1913) Taf. 162; M. Ahrem, Das
Weib in der antiken Kunst (1914) 28of. Abb. 261; M. Bieber, RM 32, 1917,
135 Abb. 9; G. Rodenwaldt, Kunst der Antike2 (1927) Abb. 557; F. Stahl,
Rom (1928) 108 Abb. 39; E. Strong, Art in Ancient Rome I (1929) 105
Abb. 109; A. W. Lawrence, Classical Sculpture (1929) 331 Abb. 123a;
H. W. Johnston, The Private Life of the Romans2 (1932) Abb. 1; Zadoks
70; West I 55 Taf. 12, 47 (reifaugusteisch); R. Paribeni, II ritratto nell’arte
antica (1934) Taf. 83; J. Pijoän, El Arte Romano (1934) 239 Abb. 324;
P. Ducati, Arte di Roma (1938) 131 Taf. 73; L. Goldscheider, Roman
Portraits (1940) Taf. 8f.; W. Technau, Die Kunst der Römer (1941) 123
Abb. 95 (spätaugusteisch); Vessberg 203 Nr. 8; 204. 272 Taf. 43, 3 (20-40
n. Chr.); G. Rodenwaldt, Kunst um Augustus (1942) 31L Abb. 21; J. Char-
bonneaux, L’art au siede d’Auguste (1948) Taf. 6; W. Lübke - E. Per-
nice - B. Sarne, Die Kunst der Römer (1958) 196 Abb. 185; H. Bartels, Stu-
dien zum Frauenporträt der augusteischen Zeit (Diss. Berlin i960) 99
Anm. 362; A. Frova, Arte di Roma (1961) 147 Abb. 108; P. Reuterswärd,
Studien zur Polychromie der Plastik (i960) 210 Anm. 586; R. Brilliant,
Gesture and Rank (1963) 45L Abb. 1. 78 (Ende Republik - Anf. Kaiserzeit);
Helbig4 I, 143 Nr. 199 (v. Heintze, letztes Viertel 1. Jh. v. Chr.); H. von
Heintze, Die antiken Porträts im Schloß Fasanerie bei Fulda (1968) 21;
W. Zschietzschmann, Römische Kunst (1968) S. XVIII, Abb. S. 8;
I. I. Britova u. a., Rimskij skulpturnij Portret (1975, russisch) 34 Abb. 46;
Buschor 63.102 Nr. 398 (Anfang 1. Jh. n. Chr.); A. Garcia y Beilido, Arte
romano2 (1972) 107L Abb. 110; A. W. Lawrence, Greek and Roman Sculp-
ture (1972) 247 Taf. 74 a (frühaugusteisch); B. Andreae, Römische Kunst
(1973) 482 Abb. 230; Zänker 1975, 285L 314 Abb. 17; Kleiner 1977, 215
Nr. 34 (13 V.-5 n. Chr.); Frenz 1977, i8iff. Nr. K 2 (um 40 n. Chr.); Frenz
1985, 69 Anm. 375; 81 zu Nr. 4; 93 zu Nr. 25; 145 zu Nr. 124; Kleiner 1986,
129 Abb. 9; 132; E. Simon, Augustus (1986) 168 Abb. 227; Volpi 270L
Nr. 11 Taf. 36 (um 30 v. Chr.); Goette 116 B a 23. Hier S. 8 Anm. 64; 10
Anm. 82; 13 Anm. 116; 27. 33. 46. 50. 54. 73. 92. 105. 125. 135 Anm. 1 (zu G
12); 151. 167 Anm. 2 (zu K 1); 172 Anm. 2 (zu K 10); 175. 195. 199 Anm. 7
(zu M 2); 200. 206. 227.
Zum Nachleben besonders: H. Ladendorf, Antikenstudium und Antiken-
kopie2 (1958) 48, iiof. Anm. 18 Taf. 43 Abb. 159; H. Rostrup, Meddelels-
GlyptKob 32,1975, Abb. S. 11; Frenz 1977, 36; K. Türr, Zur Antikenrezep-
tion in der französischen Skulptur des 19. und frühen 20. Jh. (1979) 56ff.
Abb. i6f.; J. Ch. Balty; Academie Royale de Belgique. Bul. de la Classe
des Beaux-Arts. 5e ser., t. 68, 1986-12, 340L Taf. 15, 3; 16, 1. 2.
188