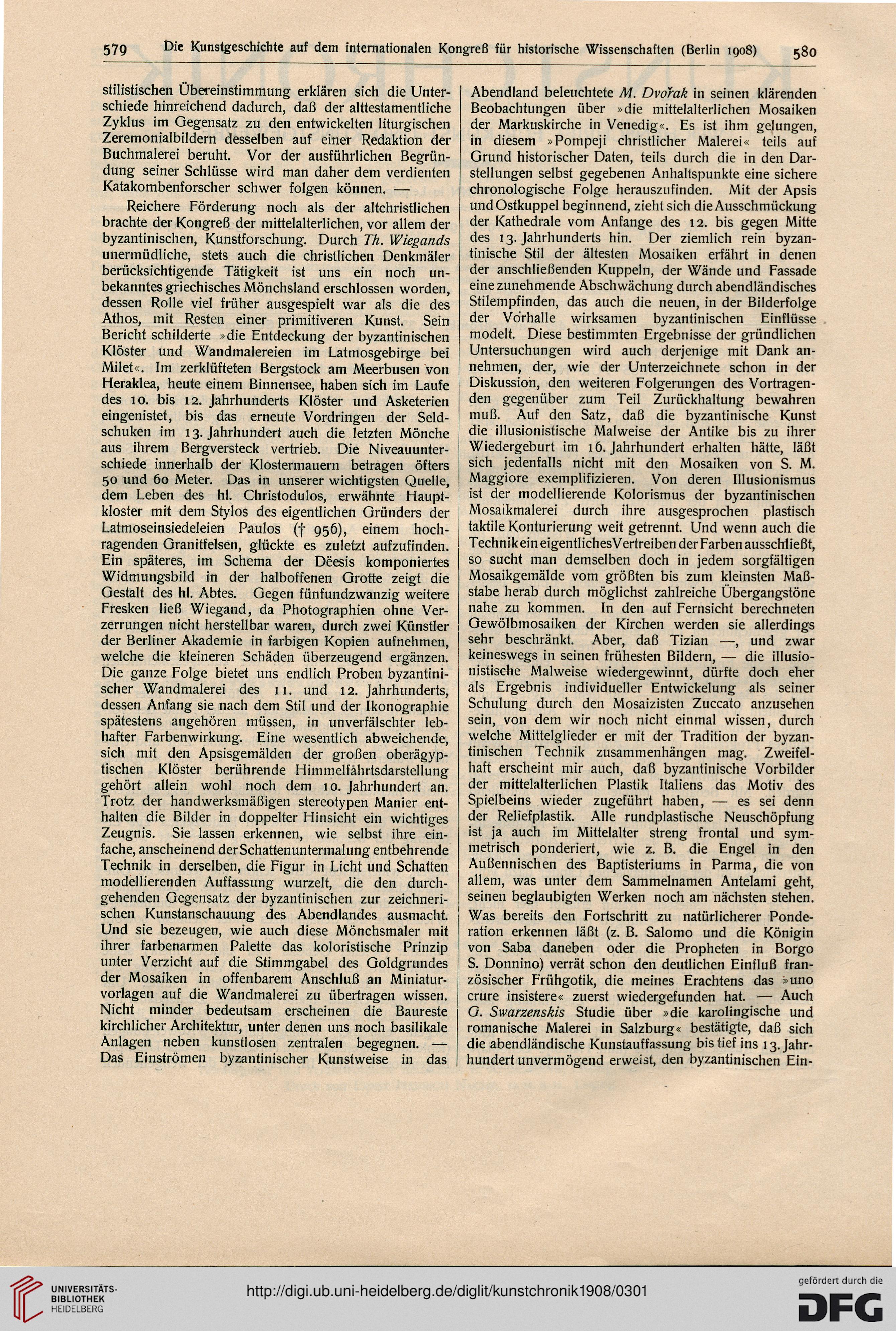579 Die Kunstgeschichte auf dem internationalen Kongreß für historische Wissenschaften (Berlin 1908) 580
stilistischen Übereinstimmung erklären sich die Unter-
schiede hinreichend dadurch, daß der alttestamentliche
Zyklus im Gegensatz zu den entwickelten liturgischen
Zeremonialbildern desselben auf einer Redaktion der
Buchmalerei beruht. Vor der ausführlichen Begrün-
dung seiner Schlüsse wird man daher dem verdienten
Katakombenforscher schwer folgen können. —
Reichere Förderung noch als der altchristlichen
brachte der Kongreß der mittelalterlichen, vor allem der
byzantinischen, Kunstforschung. Durch Th. Wiegands
unermüdliche, stets auch die christlichen Denkmäler
berücksichtigende Tätigkeit ist uns ein noch un-
bekanntes griechisches Mönchsland erschlossen worden,
dessen Rolle viel früher ausgespielt war als die des
Athos, mit Resten einer primitiveren Kunst. Sein
Bericht schilderte »die Entdeckung der byzantinischen
Klöster und Wandmalereien im Latmosgebirge bei
Milet«. Im zerklüfteten Bergstock am Meerbusen von
Heraklea, heute einem Binnensee, haben sich im Laufe
des 10. bis 12. Jahrhunderts Klöster und Asketerien
eingenistet, bis das erneute Vordringen der Seld-
schuken im 13. Jahrhundert auch die letzten Mönche
aus ihrem Bergversteck vertrieb. Die Niveauunter-
schiede innerhalb der Klostermauern betragen öfters
50 und 60 Meter. Das in unserer wichtigsten Quelle,
dem Leben des hl. Christodulos, erwähnte Haupt-
kloster mit dem Stylos des eigentlichen Gründers der
Latmoseinsiedeleien Paulos (f 956), einem hoch-
ragenden Granitfelsen, glückte es zuletzt aufzufinden.
Ein späteres, im Schema der Deesis komponiertes
Widmungsbild in der halboffenen Grotte zeigt die
Gestalt des hl. Abtes. Gegen fünfundzwanzig weitere
Fresken ließ Wiegand, da Photographien ohne Ver-
zerrungen nicht herstellbar waren, durch zwei Künstler
der Berliner Akademie in farbigen Kopien aufnehmen,
welche die kleineren Schäden überzeugend ergänzen.
Die ganze Folge bietet uns endlich Proben byzantini-
scher Wandmalerei des 11. und 12. Jahrhunderts,
dessen Anfang sie nach dem Stil und der Ikonographie
spätestens angehören müssen, in unverfälschter leb-
hafter Farbenwirkung. Eine wesentlich abweichende,
sich mit den Apsisgemälden der großen oberägyp-
tischen Klöster berührende Himmelfahrtsdarstellung
gehört allein wohl noch dem jo. Jahrhundert an.
Trotz der handwerksmäßigen stereotypen Manier ent-
halten die Bilder in doppelter Hinsicht ein wichtiges
Zeugnis. Sie lassen erkennen, wie selbst ihre ein-
fache, anscheinend derSchattenuntermalung entbehrende
Technik in derselben, die Figur in Licht und Schatten
modellierenden Auffassung wurzelt, die den durch-
gehenden Gegensatz der byzantinischen zur zeichneri-
schen Kunstanschauung des Abendlandes ausmacht.
Und sie bezeugen, wie auch diese Mönchsmaler mit
ihrer farbenarmen Palette das koloristische Prinzip
unter Verzicht auf die Stimmgabel des Goldgrundes
der Mosaiken in offenbarem Anschluß an Miniatur-
vorlagen auf die Wandmalerei zu übertragen wissen.
Nicht minder bedeutsam erscheinen die Baureste
kirchlicher Architektur, unter denen uns noch basilikale
Anlagen neben kunstlosen zentralen begegnen. —
Das Einströmen byzantinischer Kunstweise in das
Abendland beleuchtete M. Dvorak in seinen klärenden
Beobachtungen über »die mittelalterlichen Mosaiken
der Markuskirche in Venedig«. Es ist ihm gelungen,
in diesem »Pompeji christlicher Malerei« teils auf
Grund historischer Daten, teils durch die in den Dar-
stellungen selbst gegebenen Anhaltspunkte eine sichere
chronologische Folge herauszufinden. Mit der Apsis
undOstkuppel beginnend, zieht sich die Ausschmückung
der Kathedrale vom Anfange des 12. bis gegen Mitte
des 13. Jahrhunderts hin. Der ziemlich rein byzan-
tinische Stil der ältesten Mosaiken erfährt in denen
der anschließenden Kuppeln, der Wände und Fassade
eine zunehmende Abschwächung durch abendländisches
Stilempfinden, das auch die neuen, in der Bilderfolge
der Vorhalle wirksamen byzantinischen Einflüsse
modelt. Diese bestimmten Ergebnisse der gründlichen
Untersuchungen wird auch derjenige mit Dank an-
nehmen, der, wie der Unterzeichnete schon in der
Diskussion, den weiteren Folgerungen des Vortragen-
den gegenüber zum Teil Zurückhaltung bewahren
muß. Auf den Satz, daß die byzantinische Kunst
die illusionistische Malweise der Antike bis zu ihrer
Wiedergeburt im 16. Jahrhundert erhalten hätte, läßt
sich jedenfalls nicht mit den Mosaiken von S. M.
Maggiore exemplifizieren. Von deren Illusionismus
ist der modellierende Kolorismus der byzantinischen
Mosaikmalerei durch ihre ausgesprochen plastisch
taktile Konturierung weit getrennt. Und wenn auch die
Technik ein eigentlichesVertreiben der Farben ausschließt,
so sucht man demselben doch in jedem sorgfältigen
Mosaikgemälde vom größten bis zum kleinsten Maß-
stabe herab durch möglichst zahlreiche Übergangstöne
nahe zu kommen. In den auf Fernsicht berechneten
Gewölbmosaiken der Kirchen werden sie allerdings
sehr beschränkt. Aber, daß Tizian —, und zwar
keineswegs in seinen frühesten Bildern, — die illusio-
nistische Malweise wiedergewinnt, dürfte doch eher
als Ergebnis individueller Entwickelung als seiner
Schulung durch den Mosaizisten Zuccato anzusehen
sein, von dem wir noch nicht einmal wissen, durch
welche Mittelglieder er mit der Tradition der byzan-
tinischen Technik zusammenhängen mag. Zweifel-
haft erscheint mir auch, daß byzantinische Vorbilder
der mittelalterlichen Plastik Italiens das Motiv des
Spielbeins wieder zugeführt haben, — es sei denn
der Reliefplastik. Alle rundplastische Neuschöpfung
ist ja auch im Mittelalter streng frontal und sym-
metrisch ponderiert, wie z. B. die Engel in den
Außennischen des Baptisteriums in Parma, die von
allem, was unter dem Sammelnamen Antelami geht,
seinen beglaubigten Werken noch am nächsten stehen.
Was bereits den Fortschritt zu natürlicherer Ponde-
ration erkennen läßt (z. B. Salomo und die Königin
von Saba daneben oder die Propheten in Borgo
S. Donnino) verrät schon den deutlichen Einfluß fran-
zösischer Frühgotik, die meines Erachtens das »uno
crure insistere« zuerst wiedergefunden hat. — Auch
G. Swarzenskis Studie über »die karolingische und
romanische Malerei in Salzburg« bestätigte, daß sich
die abendländische Kunstauffassung bis tief ins ^.Jahr-
hundert unvermögend erweist, den byzantinischen Ein-
stilistischen Übereinstimmung erklären sich die Unter-
schiede hinreichend dadurch, daß der alttestamentliche
Zyklus im Gegensatz zu den entwickelten liturgischen
Zeremonialbildern desselben auf einer Redaktion der
Buchmalerei beruht. Vor der ausführlichen Begrün-
dung seiner Schlüsse wird man daher dem verdienten
Katakombenforscher schwer folgen können. —
Reichere Förderung noch als der altchristlichen
brachte der Kongreß der mittelalterlichen, vor allem der
byzantinischen, Kunstforschung. Durch Th. Wiegands
unermüdliche, stets auch die christlichen Denkmäler
berücksichtigende Tätigkeit ist uns ein noch un-
bekanntes griechisches Mönchsland erschlossen worden,
dessen Rolle viel früher ausgespielt war als die des
Athos, mit Resten einer primitiveren Kunst. Sein
Bericht schilderte »die Entdeckung der byzantinischen
Klöster und Wandmalereien im Latmosgebirge bei
Milet«. Im zerklüfteten Bergstock am Meerbusen von
Heraklea, heute einem Binnensee, haben sich im Laufe
des 10. bis 12. Jahrhunderts Klöster und Asketerien
eingenistet, bis das erneute Vordringen der Seld-
schuken im 13. Jahrhundert auch die letzten Mönche
aus ihrem Bergversteck vertrieb. Die Niveauunter-
schiede innerhalb der Klostermauern betragen öfters
50 und 60 Meter. Das in unserer wichtigsten Quelle,
dem Leben des hl. Christodulos, erwähnte Haupt-
kloster mit dem Stylos des eigentlichen Gründers der
Latmoseinsiedeleien Paulos (f 956), einem hoch-
ragenden Granitfelsen, glückte es zuletzt aufzufinden.
Ein späteres, im Schema der Deesis komponiertes
Widmungsbild in der halboffenen Grotte zeigt die
Gestalt des hl. Abtes. Gegen fünfundzwanzig weitere
Fresken ließ Wiegand, da Photographien ohne Ver-
zerrungen nicht herstellbar waren, durch zwei Künstler
der Berliner Akademie in farbigen Kopien aufnehmen,
welche die kleineren Schäden überzeugend ergänzen.
Die ganze Folge bietet uns endlich Proben byzantini-
scher Wandmalerei des 11. und 12. Jahrhunderts,
dessen Anfang sie nach dem Stil und der Ikonographie
spätestens angehören müssen, in unverfälschter leb-
hafter Farbenwirkung. Eine wesentlich abweichende,
sich mit den Apsisgemälden der großen oberägyp-
tischen Klöster berührende Himmelfahrtsdarstellung
gehört allein wohl noch dem jo. Jahrhundert an.
Trotz der handwerksmäßigen stereotypen Manier ent-
halten die Bilder in doppelter Hinsicht ein wichtiges
Zeugnis. Sie lassen erkennen, wie selbst ihre ein-
fache, anscheinend derSchattenuntermalung entbehrende
Technik in derselben, die Figur in Licht und Schatten
modellierenden Auffassung wurzelt, die den durch-
gehenden Gegensatz der byzantinischen zur zeichneri-
schen Kunstanschauung des Abendlandes ausmacht.
Und sie bezeugen, wie auch diese Mönchsmaler mit
ihrer farbenarmen Palette das koloristische Prinzip
unter Verzicht auf die Stimmgabel des Goldgrundes
der Mosaiken in offenbarem Anschluß an Miniatur-
vorlagen auf die Wandmalerei zu übertragen wissen.
Nicht minder bedeutsam erscheinen die Baureste
kirchlicher Architektur, unter denen uns noch basilikale
Anlagen neben kunstlosen zentralen begegnen. —
Das Einströmen byzantinischer Kunstweise in das
Abendland beleuchtete M. Dvorak in seinen klärenden
Beobachtungen über »die mittelalterlichen Mosaiken
der Markuskirche in Venedig«. Es ist ihm gelungen,
in diesem »Pompeji christlicher Malerei« teils auf
Grund historischer Daten, teils durch die in den Dar-
stellungen selbst gegebenen Anhaltspunkte eine sichere
chronologische Folge herauszufinden. Mit der Apsis
undOstkuppel beginnend, zieht sich die Ausschmückung
der Kathedrale vom Anfange des 12. bis gegen Mitte
des 13. Jahrhunderts hin. Der ziemlich rein byzan-
tinische Stil der ältesten Mosaiken erfährt in denen
der anschließenden Kuppeln, der Wände und Fassade
eine zunehmende Abschwächung durch abendländisches
Stilempfinden, das auch die neuen, in der Bilderfolge
der Vorhalle wirksamen byzantinischen Einflüsse
modelt. Diese bestimmten Ergebnisse der gründlichen
Untersuchungen wird auch derjenige mit Dank an-
nehmen, der, wie der Unterzeichnete schon in der
Diskussion, den weiteren Folgerungen des Vortragen-
den gegenüber zum Teil Zurückhaltung bewahren
muß. Auf den Satz, daß die byzantinische Kunst
die illusionistische Malweise der Antike bis zu ihrer
Wiedergeburt im 16. Jahrhundert erhalten hätte, läßt
sich jedenfalls nicht mit den Mosaiken von S. M.
Maggiore exemplifizieren. Von deren Illusionismus
ist der modellierende Kolorismus der byzantinischen
Mosaikmalerei durch ihre ausgesprochen plastisch
taktile Konturierung weit getrennt. Und wenn auch die
Technik ein eigentlichesVertreiben der Farben ausschließt,
so sucht man demselben doch in jedem sorgfältigen
Mosaikgemälde vom größten bis zum kleinsten Maß-
stabe herab durch möglichst zahlreiche Übergangstöne
nahe zu kommen. In den auf Fernsicht berechneten
Gewölbmosaiken der Kirchen werden sie allerdings
sehr beschränkt. Aber, daß Tizian —, und zwar
keineswegs in seinen frühesten Bildern, — die illusio-
nistische Malweise wiedergewinnt, dürfte doch eher
als Ergebnis individueller Entwickelung als seiner
Schulung durch den Mosaizisten Zuccato anzusehen
sein, von dem wir noch nicht einmal wissen, durch
welche Mittelglieder er mit der Tradition der byzan-
tinischen Technik zusammenhängen mag. Zweifel-
haft erscheint mir auch, daß byzantinische Vorbilder
der mittelalterlichen Plastik Italiens das Motiv des
Spielbeins wieder zugeführt haben, — es sei denn
der Reliefplastik. Alle rundplastische Neuschöpfung
ist ja auch im Mittelalter streng frontal und sym-
metrisch ponderiert, wie z. B. die Engel in den
Außennischen des Baptisteriums in Parma, die von
allem, was unter dem Sammelnamen Antelami geht,
seinen beglaubigten Werken noch am nächsten stehen.
Was bereits den Fortschritt zu natürlicherer Ponde-
ration erkennen läßt (z. B. Salomo und die Königin
von Saba daneben oder die Propheten in Borgo
S. Donnino) verrät schon den deutlichen Einfluß fran-
zösischer Frühgotik, die meines Erachtens das »uno
crure insistere« zuerst wiedergefunden hat. — Auch
G. Swarzenskis Studie über »die karolingische und
romanische Malerei in Salzburg« bestätigte, daß sich
die abendländische Kunstauffassung bis tief ins ^.Jahr-
hundert unvermögend erweist, den byzantinischen Ein-