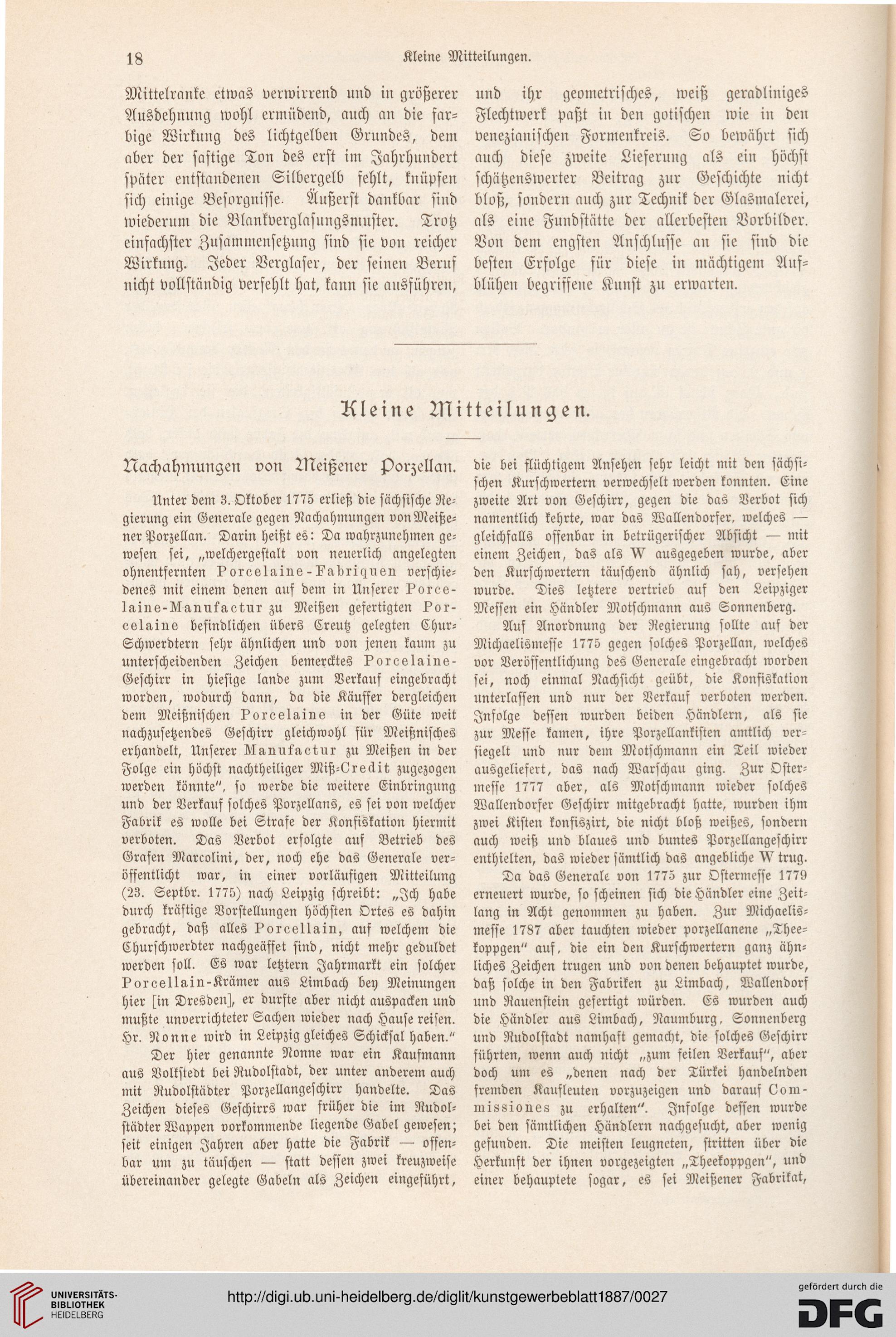18
Kleine Mitteilungen.
Mittelrcmke etwns verwirrend und in größerer
Ausdehnung wohl ermndend, auch an die fnr-
bige Wirkung des lichtgelben Grnndes, dem
aber der saftige Ton des erst im Jahrhundert
später entstandenen Silbergelb fehlt, knüpfen
sich einige Besorgnisfe. Äußerst dankbar sind
wiederuni die Blankverglasungsninster. Trotz
einfachster Zusammcusetznng sind sie von reicher
Wirkung. Jeder Verglaser, der seinen Beruf
nicht vollständig verfehlt hat, kann sie ausfnhren,
und ihr geometrisches, weiß geradliniges
Flechtwerk paßt in den gotischen wie in den
venezianischen Formenkreis. So bewährt sich
auch diese zweite Lieferung als eiu höchst
schätzenswerter Beitrag zur Geschichte nicht
bloß, sondern auch zur Technik der Glasmalerei,
als eine Fundstätte der allerbesten Vorbilder.
Von dem engsten Anschlusse an sie sind die
besten Erfolge für diese in mächtigem Auf-
blühen begrisfene Kunst zu erwarten.
Kleine Mitteilnngen.
Nachahmungen von Nleißener j)orzellan.
Unter dem Z. Oktober 1775 erließ die sächsische Re-
gierung ein Generale gegen Nachahnmngen vonMeiße-
ner Porzellan. Darin heißt es: Da wahrzunehmen ge-
wesen sei, „welchsrgestalt von neuerlich angelegten
ohnentfernten koroslains-lkAviigusn verschie-
denes mit einem denen auf dem in Unserer l?oros-
lainö-Uanutaotni zu Meißen gefertigten l'or-
sslains befindlichen übers Creutz gelegten Chur-
Schwerdtern sehr ähnlichen und von jenen kaum zu
unterschsidenden Zeichen bemercktes koioslaillö-
Geschirr in hiesige lande zum Verkauf eingebracht
worden, wodurch dann, da die Käuffer dergleichen
dem Meißnischen koioslaillo in der Güte weit
nachzusetzendes Geschirr gleichwohl für Meißnisches
erhandelt, Unserer Ns.llnkaotni zu Meißen in der
Folge ein höchst nachtheiliger Miß-6rsäit zugezogen
werden könnts". so werde die weitere Einbringung
und der Verkauf solches Porzellans, es sei von welcher
Fabrik es wolle bei Strafe der Konfiskation hiermit
verboten. Das Verbot erfolgte auf Betrieb des
Grafen Marcolini, der, noch ehe das Generale ver-
öffentlicht war, in einer vorläufigen Mitteilung
(23. Septbr. 1775) nach Leipzig schreibt: „Jch habe
durch kräftige Vorstellungen höchsten Ortes es dahin
gebracht, daß alles ?oros1ls.ill, auf welchem die
Churschwerdter nachgeäsfet sind, nicht mehr geduldet
werden soll. Es war letztern Jahrmarkt ein solcher
?oroölls.in-Krämer aus Limbach bey Meinungsn
hier sin Dresdens, er durfte aber nicht auspacken und
mutzte unverrichteter Sachen wieder nach Hause reisen.
Hr. Nonne wird in Leipzig gleichss Schicksal haben."
Der hier genannte Nonne war ein Kaufmann
aus Volkstedt bei Rudolstadt, der unter anderem auch
mit Rudolstädter Porzellangeschirr handelte. Das
Zeichen dieses Geschirrs war früher die im Rudol-
städter Wappen vorkommende liegende Gabel gewesen;
seit einigen Jahren aber hatte die Fabrik — offen-
bar um zu tüuschen — statt dessen zwei kreuzweise
übereinander gelegte Gabeln als Zeichen eingeführt,
die bei flllchtigem Ansehen sehr leicht mit den sächsi-
schen Kurschwertern verwechsslt werden konnten. Eine
zweite Art von Geschirr, gegen die das Verbot sich
namentlich kehrte, war das Wallsndorfer, welches —
glsichfalls offenbar in betrügerischer Absicht — mit
einem Zeichen, das als IV ausgegeben wurde, aber
den Kurschwertern täuschend ähnlich sah, versehen
wurde. Dies letztere vertrieb auf den Leipziger
Messen ein Händler Motschmann aus Sonnenberg.
Auf Anordnung der Regierung sollte auf der
Michaelismesss 1775 gegen solches Porzellan, welches
vor Veröffentlichung des Generale eingsbracht worden
sei, noch einmal Nachsicht geübt, die Konfiskation
unterlassen und nur der Verkauf verboten werden.
Jnfolge dessen wurden beiden Händlern, als sie
zur Messe kamen, ihre Porzellankisten amtlich ver-
siegelt und nur dem Motschmann ein Teil wieder
ausgeliefert, das nach Warschau ging. Zur Oster-
messe 1777 aber, als Motschmann wieder solches
Wallendorfer Geschirr mitgebracht hatte, wurden ihm
zwsi Kisten konfiszirt, die nicht bloß weißes, sondern
auch weiß und blaues und buntes Porzellangeschirr
enthielten, das wieder sämtlich das angebliche W trug.
Da das Generale von 1775 zur Ostermesse 1779
erneuert wurde, so scheinen sich die Händler eine Zeit-
lang in Acht genommen zu haben. Zur Michaelis-
messe 1787 aber tauchten wieder porzellanene „Thee-
koppgen" auf, die ein den Kurschwertern ganz ähn-
liches Zeichen trugen und von denen behauptet wurde,
daß solche in den Fabriken zu Limbach, Wallendorf
und Rauenstein gefertigt würden. Es wurden auch
die Händler aus Limbach, Naumburg, Sonnenberg
und Rudolstadt namhaft gemacht, die solches Geschirr
führten, wenn auch nicht „zum feilen Verkauf", aber
doch um es „denen nach der Türkei handelndsn
frsmden Kaufleuten vorzuzsigen und darauf 6om-
missiolles zu erhalten". Jnfolge dessen wurds
bei den sämtlichen Händlern nachgesucht, aber wenig
gefunden. Die meistsn leugnetsn, strittsn über die
Hsrkunft der ihnen vorgezeigten „Theekoppgen", und
einer behauptete sogar, es sei Meißener Fabrikat,
Kleine Mitteilungen.
Mittelrcmke etwns verwirrend und in größerer
Ausdehnung wohl ermndend, auch an die fnr-
bige Wirkung des lichtgelben Grnndes, dem
aber der saftige Ton des erst im Jahrhundert
später entstandenen Silbergelb fehlt, knüpfen
sich einige Besorgnisfe. Äußerst dankbar sind
wiederuni die Blankverglasungsninster. Trotz
einfachster Zusammcusetznng sind sie von reicher
Wirkung. Jeder Verglaser, der seinen Beruf
nicht vollständig verfehlt hat, kann sie ausfnhren,
und ihr geometrisches, weiß geradliniges
Flechtwerk paßt in den gotischen wie in den
venezianischen Formenkreis. So bewährt sich
auch diese zweite Lieferung als eiu höchst
schätzenswerter Beitrag zur Geschichte nicht
bloß, sondern auch zur Technik der Glasmalerei,
als eine Fundstätte der allerbesten Vorbilder.
Von dem engsten Anschlusse an sie sind die
besten Erfolge für diese in mächtigem Auf-
blühen begrisfene Kunst zu erwarten.
Kleine Mitteilnngen.
Nachahmungen von Nleißener j)orzellan.
Unter dem Z. Oktober 1775 erließ die sächsische Re-
gierung ein Generale gegen Nachahnmngen vonMeiße-
ner Porzellan. Darin heißt es: Da wahrzunehmen ge-
wesen sei, „welchsrgestalt von neuerlich angelegten
ohnentfernten koroslains-lkAviigusn verschie-
denes mit einem denen auf dem in Unserer l?oros-
lainö-Uanutaotni zu Meißen gefertigten l'or-
sslains befindlichen übers Creutz gelegten Chur-
Schwerdtern sehr ähnlichen und von jenen kaum zu
unterschsidenden Zeichen bemercktes koioslaillö-
Geschirr in hiesige lande zum Verkauf eingebracht
worden, wodurch dann, da die Käuffer dergleichen
dem Meißnischen koioslaillo in der Güte weit
nachzusetzendes Geschirr gleichwohl für Meißnisches
erhandelt, Unserer Ns.llnkaotni zu Meißen in der
Folge ein höchst nachtheiliger Miß-6rsäit zugezogen
werden könnts". so werde die weitere Einbringung
und der Verkauf solches Porzellans, es sei von welcher
Fabrik es wolle bei Strafe der Konfiskation hiermit
verboten. Das Verbot erfolgte auf Betrieb des
Grafen Marcolini, der, noch ehe das Generale ver-
öffentlicht war, in einer vorläufigen Mitteilung
(23. Septbr. 1775) nach Leipzig schreibt: „Jch habe
durch kräftige Vorstellungen höchsten Ortes es dahin
gebracht, daß alles ?oros1ls.ill, auf welchem die
Churschwerdter nachgeäsfet sind, nicht mehr geduldet
werden soll. Es war letztern Jahrmarkt ein solcher
?oroölls.in-Krämer aus Limbach bey Meinungsn
hier sin Dresdens, er durfte aber nicht auspacken und
mutzte unverrichteter Sachen wieder nach Hause reisen.
Hr. Nonne wird in Leipzig gleichss Schicksal haben."
Der hier genannte Nonne war ein Kaufmann
aus Volkstedt bei Rudolstadt, der unter anderem auch
mit Rudolstädter Porzellangeschirr handelte. Das
Zeichen dieses Geschirrs war früher die im Rudol-
städter Wappen vorkommende liegende Gabel gewesen;
seit einigen Jahren aber hatte die Fabrik — offen-
bar um zu tüuschen — statt dessen zwei kreuzweise
übereinander gelegte Gabeln als Zeichen eingeführt,
die bei flllchtigem Ansehen sehr leicht mit den sächsi-
schen Kurschwertern verwechsslt werden konnten. Eine
zweite Art von Geschirr, gegen die das Verbot sich
namentlich kehrte, war das Wallsndorfer, welches —
glsichfalls offenbar in betrügerischer Absicht — mit
einem Zeichen, das als IV ausgegeben wurde, aber
den Kurschwertern täuschend ähnlich sah, versehen
wurde. Dies letztere vertrieb auf den Leipziger
Messen ein Händler Motschmann aus Sonnenberg.
Auf Anordnung der Regierung sollte auf der
Michaelismesss 1775 gegen solches Porzellan, welches
vor Veröffentlichung des Generale eingsbracht worden
sei, noch einmal Nachsicht geübt, die Konfiskation
unterlassen und nur der Verkauf verboten werden.
Jnfolge dessen wurden beiden Händlern, als sie
zur Messe kamen, ihre Porzellankisten amtlich ver-
siegelt und nur dem Motschmann ein Teil wieder
ausgeliefert, das nach Warschau ging. Zur Oster-
messe 1777 aber, als Motschmann wieder solches
Wallendorfer Geschirr mitgebracht hatte, wurden ihm
zwsi Kisten konfiszirt, die nicht bloß weißes, sondern
auch weiß und blaues und buntes Porzellangeschirr
enthielten, das wieder sämtlich das angebliche W trug.
Da das Generale von 1775 zur Ostermesse 1779
erneuert wurde, so scheinen sich die Händler eine Zeit-
lang in Acht genommen zu haben. Zur Michaelis-
messe 1787 aber tauchten wieder porzellanene „Thee-
koppgen" auf, die ein den Kurschwertern ganz ähn-
liches Zeichen trugen und von denen behauptet wurde,
daß solche in den Fabriken zu Limbach, Wallendorf
und Rauenstein gefertigt würden. Es wurden auch
die Händler aus Limbach, Naumburg, Sonnenberg
und Rudolstadt namhaft gemacht, die solches Geschirr
führten, wenn auch nicht „zum feilen Verkauf", aber
doch um es „denen nach der Türkei handelndsn
frsmden Kaufleuten vorzuzsigen und darauf 6om-
missiolles zu erhalten". Jnfolge dessen wurds
bei den sämtlichen Händlern nachgesucht, aber wenig
gefunden. Die meistsn leugnetsn, strittsn über die
Hsrkunft der ihnen vorgezeigten „Theekoppgen", und
einer behauptete sogar, es sei Meißener Fabrikat,