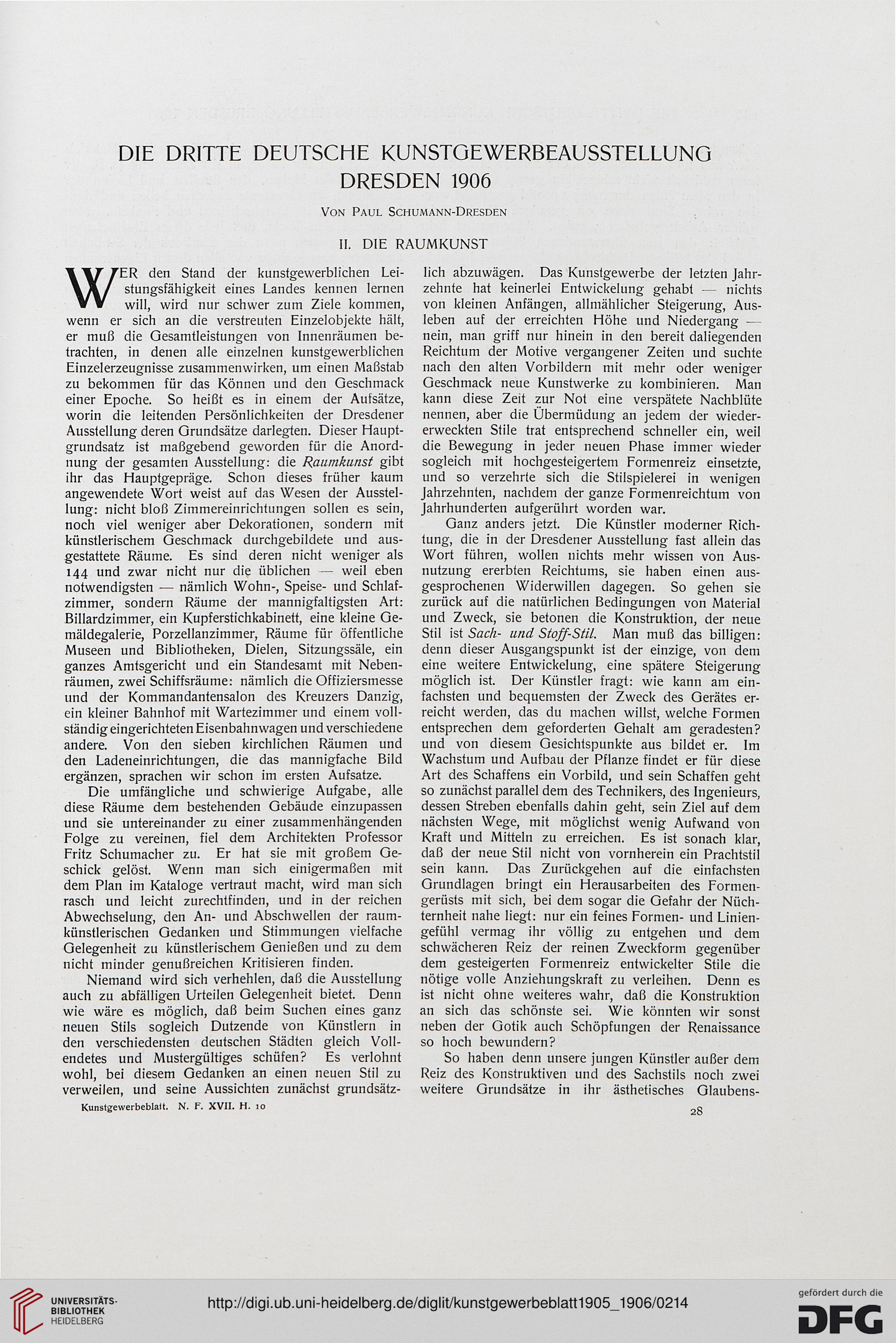DIE DRITTE DEUTSCHE KUNSTGEWERBEAUSSTELLUNG
DRESDEN 1906
Von Paul Schumann-Dresden
II. DIE RAUMKUNST
WER den Stand der kunstgewerblichen Lei-
stungsfähigkeit eines Landes kennen lernen
will, wird nur schwer zum Ziele kommen,
wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,
er muß die Gesamtleistungen von Innenräumen be-
trachten, in denen alle einzelnen kunstgewerblichen
Einzelerzeugnisse zusammenwirken, um einen Maßstab
zu bekommen für das Können und den Geschmack
einer Epoche. So heißt es in einem der Aufsätze,
worin die leitenden Persönlichkeiten der Dresdener
Ausstellung deren Grundsätze darlegten. Dieser Haupt-
grundsatz ist maßgebend geworden für die Anord-
nung der gesamten Ausstellung: die Raumkunst gibt
ihr das Hauptgepräge. Schon dieses früher kaum
angewendete Wort weist auf das Wesen der Ausstel-
lung: nicht bloß Zimmereinrichtungen sollen es sein,
noch viel weniger aber Dekorationen, sondern mit
künstlerischem Geschmack durchgebildete und aus-
gestattete Räume. Es sind deren nicht weniger als
144 und zwar nicht nur die üblichen — weil eben
notwendigsten — nämlich Wohn-, Speise- und Schlaf-
zimmer, sondern Räume der mannigfaltigsten Art:
Billardzimmer, ein Kupferstichkabinett, eine kleine Ge-
mäldegalerie, Porzellanzimmer, Räume für öffentliche
Museen und Bibliotheken, Dielen, Sitzungssäle, ein
ganzes Amtsgericht und ein Standesamt mit Neben-
räumen, zwei Schiffsräume: nämlich die Offiziersmesse
und der Kommandantensalon des Kreuzers Danzig,
ein kleiner Bahnhof mit Wartezimmer und einem voll-
ständig eingerichteten Eisenbahnwagen und verschiedene
andere. Von den sieben kirchlichen Räumen und
den Ladeneinrichtungen, die das mannigfache Bild
ergänzen, sprachen wir schon im ersten Aufsatze.
Die umfängliche und schwierige Aufgabe, alle
diese Räume dem bestehenden Gebäude einzupassen
und sie untereinander zu einer zusammenhängenden
Folge zu vereinen, fiel dem Architekten Professor
Fritz Schumacher zu. Er hat sie mit großem Ge-
schick gelöst. Wenn man sich einigermaßen mit
dem Plan im Kataloge vertraut macht, wird man sich
rasch und leicht zurechtfinden, und in der reichen
Abwechselung, den An- und Abschwellen der raum-
künstlerischen Gedanken und Stimmungen vielfache
Gelegenheit zu künstlerischem Genießen und zu dem
nicht minder genußreichen Kritisieren finden.
Niemand wird sich verhehlen, daß die Ausstellung
auch zu abfälligen Urteilen Gelegenheit bietet. Denn
wie wäre es möglich, daß beim Suchen eines ganz
neuen Stils sogleich Dutzende von Künstlern in
den verschiedensten deutschen Städten gleich Voll-
endetes und Mustergültiges schüfen? Es verlohnt
wohl, bei diesem Gedanken an einen neuen Stil zu
verweilen, und seine Aussichten zunächst grundsätz-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 10
lieh abzuwägen. Das Kunstgewerbe der letzten Jahr-
zehnte hat keinerlei Entwicklung gehabt — nichts
von kleinen Anfängen, allmählicher Steigerung, Aus-
leben auf der erreichten Höhe und Niedergang —
nein, man griff nur hinein in den bereit daliegenden
Reichtum der Motive vergangener Zeiten und suchte
nach den alten Vorbildern mit mehr oder weniger
Geschmack neue Kunstwerke zu kombinieren. Man
kann diese Zeit zur Not eine verspätete Nachblüte
nennen, aber die Übermüdung an jedem der wieder-
erweckten Stile trat entsprechend schneller ein, weil
die Bewegung in jeder neuen Phase immer wieder
sogleich mit hochgesteigertem Formenreiz einsetzte,
und so verzehrte sich die Stilspielerei in wenigen
Jahrzehnten, nachdem der ganze Formenreichtum von
Jahrhunderten aufgerührt worden war.
Ganz anders jetzt. Die Künstler moderner Rich-
tung, die in der Dresdener Ausstellung fast allein das
Wort führen, wollen nichts mehr wissen von Aus-
nutzung ererbten Reichtums, sie haben einen aus-
gesprochenen Widerwillen dagegen. So gehen sie
zurück auf die natürlichen Bedingungen von Material
und Zweck, sie betonen die Konstruktion, der neue
Stil ist Sack- und Stoff-Stil. Man muß das billigen:
denn dieser Ausgangspunkt ist der einzige, von dem
eine weitere Entwickelung, eine spätere Steigerung
möglich ist. Der Künstler fragt: wie kann am ein-
fachsten und bequemsten der Zweck des Gerätes er-
reicht werden, das du machen willst, welche Formen
entsprechen dem geforderten Gehalt am geradesten?
und von diesem Gesichtspunkte aus bildet er. Im
Wachstum und Aufbau der Pflanze findet er für diese
Art des Schaffens ein Vorbild, und sein Schaffen geht
so zunächst parallel dem des Technikers, des Ingenieurs,
dessen Streben ebenfalls dahin geht, sein Ziel auf dem
nächsten Wege, mit möglichst wenig Aufwand von
Kraft und Mitteln zu erreichen. Es ist sonach klar,
daß der neue Stil nicht von vornherein ein Prachtstil
sein kann. Das Zurückgehen auf die einfachsten
Grundlagen bringt ein Herausarbeiten des Formen-
gerüsts mit sich, bei dem sogar die Gefahr der Nüch-
ternheit nahe liegt: nur ein feines Formen- und Linien-
gefühl vermag ihr völlig zu entgehen und dem
schwächeren Reiz der reinen Zweckform gegenüber
dem gesteigerten Formenreiz entwickelter Stile die
nötige volle Anziehungskraft zu verleihen. Denn es
ist nicht ohne weiteres wahr, daß die Konstruktion
an sich das schönste sei. Wie könnten wir sonst
neben der Gotik auch Schöpfungen der Renaissance
so hoch bewundern?
So haben denn unsere jungen Künstler außer dem
Reiz des Konstruktiven und des Sachstils noch zwei
weitere Grundsätze in ihr ästhetisches Glaubens-
28
DRESDEN 1906
Von Paul Schumann-Dresden
II. DIE RAUMKUNST
WER den Stand der kunstgewerblichen Lei-
stungsfähigkeit eines Landes kennen lernen
will, wird nur schwer zum Ziele kommen,
wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,
er muß die Gesamtleistungen von Innenräumen be-
trachten, in denen alle einzelnen kunstgewerblichen
Einzelerzeugnisse zusammenwirken, um einen Maßstab
zu bekommen für das Können und den Geschmack
einer Epoche. So heißt es in einem der Aufsätze,
worin die leitenden Persönlichkeiten der Dresdener
Ausstellung deren Grundsätze darlegten. Dieser Haupt-
grundsatz ist maßgebend geworden für die Anord-
nung der gesamten Ausstellung: die Raumkunst gibt
ihr das Hauptgepräge. Schon dieses früher kaum
angewendete Wort weist auf das Wesen der Ausstel-
lung: nicht bloß Zimmereinrichtungen sollen es sein,
noch viel weniger aber Dekorationen, sondern mit
künstlerischem Geschmack durchgebildete und aus-
gestattete Räume. Es sind deren nicht weniger als
144 und zwar nicht nur die üblichen — weil eben
notwendigsten — nämlich Wohn-, Speise- und Schlaf-
zimmer, sondern Räume der mannigfaltigsten Art:
Billardzimmer, ein Kupferstichkabinett, eine kleine Ge-
mäldegalerie, Porzellanzimmer, Räume für öffentliche
Museen und Bibliotheken, Dielen, Sitzungssäle, ein
ganzes Amtsgericht und ein Standesamt mit Neben-
räumen, zwei Schiffsräume: nämlich die Offiziersmesse
und der Kommandantensalon des Kreuzers Danzig,
ein kleiner Bahnhof mit Wartezimmer und einem voll-
ständig eingerichteten Eisenbahnwagen und verschiedene
andere. Von den sieben kirchlichen Räumen und
den Ladeneinrichtungen, die das mannigfache Bild
ergänzen, sprachen wir schon im ersten Aufsatze.
Die umfängliche und schwierige Aufgabe, alle
diese Räume dem bestehenden Gebäude einzupassen
und sie untereinander zu einer zusammenhängenden
Folge zu vereinen, fiel dem Architekten Professor
Fritz Schumacher zu. Er hat sie mit großem Ge-
schick gelöst. Wenn man sich einigermaßen mit
dem Plan im Kataloge vertraut macht, wird man sich
rasch und leicht zurechtfinden, und in der reichen
Abwechselung, den An- und Abschwellen der raum-
künstlerischen Gedanken und Stimmungen vielfache
Gelegenheit zu künstlerischem Genießen und zu dem
nicht minder genußreichen Kritisieren finden.
Niemand wird sich verhehlen, daß die Ausstellung
auch zu abfälligen Urteilen Gelegenheit bietet. Denn
wie wäre es möglich, daß beim Suchen eines ganz
neuen Stils sogleich Dutzende von Künstlern in
den verschiedensten deutschen Städten gleich Voll-
endetes und Mustergültiges schüfen? Es verlohnt
wohl, bei diesem Gedanken an einen neuen Stil zu
verweilen, und seine Aussichten zunächst grundsätz-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 10
lieh abzuwägen. Das Kunstgewerbe der letzten Jahr-
zehnte hat keinerlei Entwicklung gehabt — nichts
von kleinen Anfängen, allmählicher Steigerung, Aus-
leben auf der erreichten Höhe und Niedergang —
nein, man griff nur hinein in den bereit daliegenden
Reichtum der Motive vergangener Zeiten und suchte
nach den alten Vorbildern mit mehr oder weniger
Geschmack neue Kunstwerke zu kombinieren. Man
kann diese Zeit zur Not eine verspätete Nachblüte
nennen, aber die Übermüdung an jedem der wieder-
erweckten Stile trat entsprechend schneller ein, weil
die Bewegung in jeder neuen Phase immer wieder
sogleich mit hochgesteigertem Formenreiz einsetzte,
und so verzehrte sich die Stilspielerei in wenigen
Jahrzehnten, nachdem der ganze Formenreichtum von
Jahrhunderten aufgerührt worden war.
Ganz anders jetzt. Die Künstler moderner Rich-
tung, die in der Dresdener Ausstellung fast allein das
Wort führen, wollen nichts mehr wissen von Aus-
nutzung ererbten Reichtums, sie haben einen aus-
gesprochenen Widerwillen dagegen. So gehen sie
zurück auf die natürlichen Bedingungen von Material
und Zweck, sie betonen die Konstruktion, der neue
Stil ist Sack- und Stoff-Stil. Man muß das billigen:
denn dieser Ausgangspunkt ist der einzige, von dem
eine weitere Entwickelung, eine spätere Steigerung
möglich ist. Der Künstler fragt: wie kann am ein-
fachsten und bequemsten der Zweck des Gerätes er-
reicht werden, das du machen willst, welche Formen
entsprechen dem geforderten Gehalt am geradesten?
und von diesem Gesichtspunkte aus bildet er. Im
Wachstum und Aufbau der Pflanze findet er für diese
Art des Schaffens ein Vorbild, und sein Schaffen geht
so zunächst parallel dem des Technikers, des Ingenieurs,
dessen Streben ebenfalls dahin geht, sein Ziel auf dem
nächsten Wege, mit möglichst wenig Aufwand von
Kraft und Mitteln zu erreichen. Es ist sonach klar,
daß der neue Stil nicht von vornherein ein Prachtstil
sein kann. Das Zurückgehen auf die einfachsten
Grundlagen bringt ein Herausarbeiten des Formen-
gerüsts mit sich, bei dem sogar die Gefahr der Nüch-
ternheit nahe liegt: nur ein feines Formen- und Linien-
gefühl vermag ihr völlig zu entgehen und dem
schwächeren Reiz der reinen Zweckform gegenüber
dem gesteigerten Formenreiz entwickelter Stile die
nötige volle Anziehungskraft zu verleihen. Denn es
ist nicht ohne weiteres wahr, daß die Konstruktion
an sich das schönste sei. Wie könnten wir sonst
neben der Gotik auch Schöpfungen der Renaissance
so hoch bewundern?
So haben denn unsere jungen Künstler außer dem
Reiz des Konstruktiven und des Sachstils noch zwei
weitere Grundsätze in ihr ästhetisches Glaubens-
28