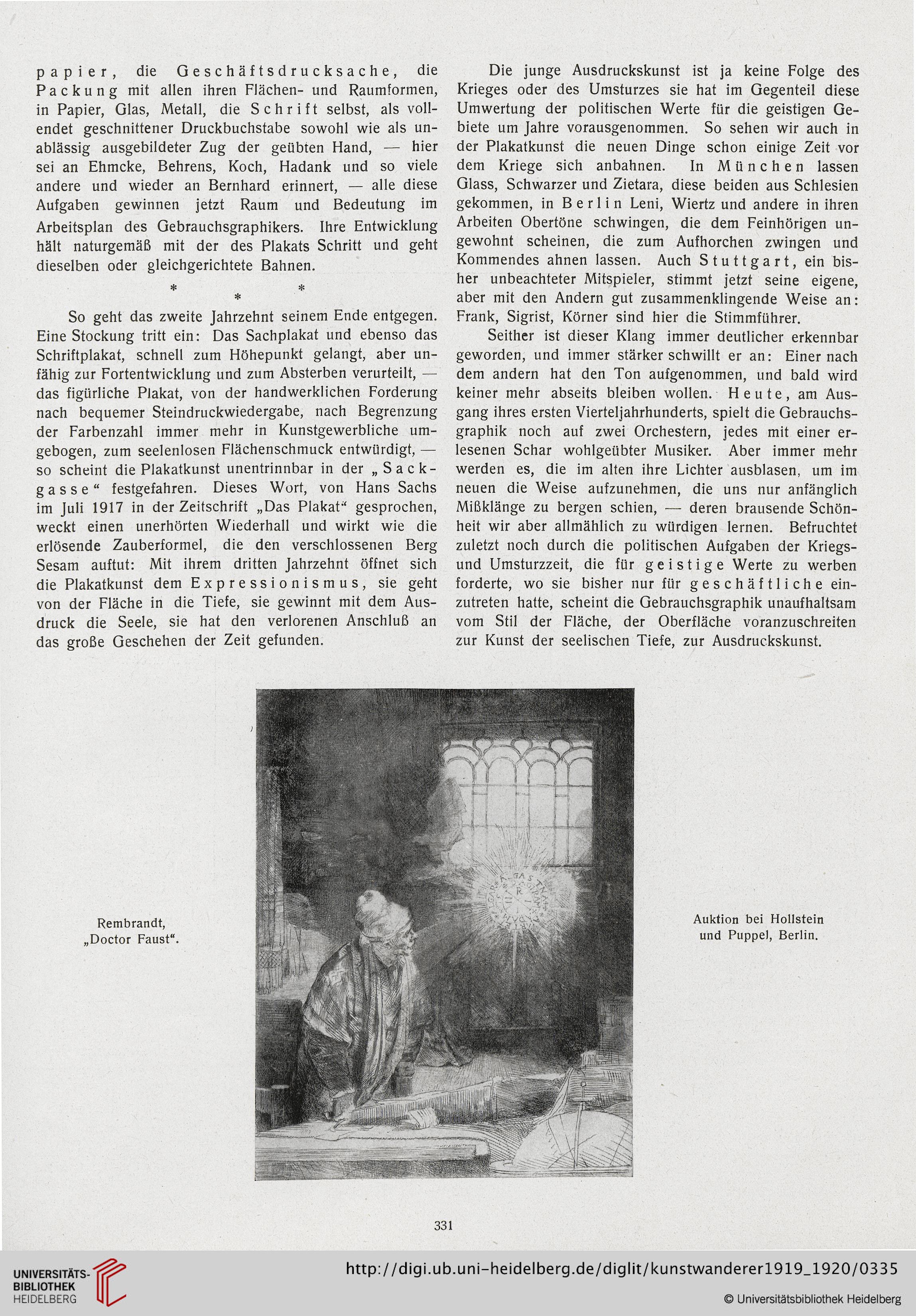papier, die Geschäftsdrucksache, die
Packung mit allen ihren Flächen- und Raumformen,
in Papier, Glas, Metall, die Schrift selbst, als voll-
endet geschnittener Druckbuchstabe sowohl wie als un-
ablässig ausgebildeter Zug der geübten Hand, — hier
sei an Ehmcke, Behrens, Koch, Hadank und so viele
andere und wieder an Bernhard erinnert, — alle diese
Aufgaben gewinnen jetzt Raum und Bedeutung im
Arbeitsplan des Gebrauchsgraphikers. Ihre Entwicklung
hält naturgemäß mit der des Plakats Schritt und geht
dieselben oder gleichgerichtete Bahnen.
* *
*
So geht das zweite Jahrzehnt seinem Ende entgegen.
Eine Stockung tritt ein: Das Sachplakat und ebenso das
Schriftplakat, schnell zum Höhepunkt gelangt, aber un-
fähig zur Fortentwicklung und zum Absterben verurteilt, —
das figürliche Plakat, von der handwerklichen Forderung
nach bequemer Steindruckwiedergabe, nach Begrenzung
der Farbenzahl immer mehr in Kunstgewerbliche um-
gebogen, zum seelenlosen Flächenschmuck entwürdigt, —
so scheint die Plakatkunst unentrinnbar in der „Sack-
gasse“ festgefahren. Dieses Wort, von Hans Sachs
im Juli 1917 in der Zeitschrift „Das Plakat“ gesprochen,
weckt einen unerhörten Wiederhall und wirkt wie die
erlösende Zauberformel, die den verschlossenen Berg
Sesam auftut: Mit ihrem dritten Jahrzehnt öffnet sich
die Plakatkunst dem Expressionismus, sie geht
von der Fläche in die Tiefe, sie gewinnt mit dem Aus-
druck die Seele, sie hat den verlorenen Anschluß an
das große Geschehen der Zeit gefunden.
Die junge Ausdruckskunst ist ja keine Folge des
Krieges oder des Umsturzes sie hat im Gegenteil diese
Umwertung der politischen Werte für die geistigen Ge-
biete um Jahre vorausgenommen. So sehen wir auch in
der Plakatkunst die neuen Dinge schon einige Zeit vor
dem Kriege sich anbahnen. In München lassen
Glass, Schwarzer und Zietara, diese beiden aus Schlesien
gekommen, in Berlin Leni, Wiertz und andere in ihren
Arbeiten Obertöne schwingen, die dem Feinhörigen un-
gewohnt scheinen, die zum Aufhorchen zwingen und
Kommendes ahnen lassen. Auch Stuttgart, ein bis-
her unbeachteter Mitspieler, stimmt jetzt seine eigene,
aber mit den Andern gut zusammenklingende Weise an:
Frank, Sigrist, Körner sind hier die Stimmführer.
Seither ist dieser Klang immer deutlicher erkennbar
geworden, und immer stärker schwillt er an: Einer nach
dem andern hat den Ton aufgenommen, und bald wird
keiner mehr abseits bleiben wollen. Heute, am Aus-
gang ihres ersten Vierteljahrhunderts, spielt die Gebrauchs-
graphik noch auf zwei Orchestern, jedes mit einer er-
lesenen Schar wohlgeübter Musiker. Aber immer mehr
werden es, die im alten ihre Lichter ausblasen, um im
neuen die Weise aufzunehmen, die uns nur anfänglich
Mißklänge zu bergen schien, — deren brausende Schön-
heit wir aber allmählich zu würdigen lernen. Befruchtet
zuletzt noch durch die politischen Aufgaben der Kriegs-
und Umsturzzeit, die für geistige Werte zu werben
forderte, wo sie bisher nur für geschäftliche ein-
zutreten hatte, scheint die Gebrauchsgraphik unaufhaltsam
vom Stil der Fläche, der Oberfläche voranzuschreiten
zur Kunst der seelischen Tiefe, zur Ausdruckskunst.
Rembrandt,
„Doctor Faust“.
Auktion bei Hollstein
und Puppel, Berlin.
331
Packung mit allen ihren Flächen- und Raumformen,
in Papier, Glas, Metall, die Schrift selbst, als voll-
endet geschnittener Druckbuchstabe sowohl wie als un-
ablässig ausgebildeter Zug der geübten Hand, — hier
sei an Ehmcke, Behrens, Koch, Hadank und so viele
andere und wieder an Bernhard erinnert, — alle diese
Aufgaben gewinnen jetzt Raum und Bedeutung im
Arbeitsplan des Gebrauchsgraphikers. Ihre Entwicklung
hält naturgemäß mit der des Plakats Schritt und geht
dieselben oder gleichgerichtete Bahnen.
* *
*
So geht das zweite Jahrzehnt seinem Ende entgegen.
Eine Stockung tritt ein: Das Sachplakat und ebenso das
Schriftplakat, schnell zum Höhepunkt gelangt, aber un-
fähig zur Fortentwicklung und zum Absterben verurteilt, —
das figürliche Plakat, von der handwerklichen Forderung
nach bequemer Steindruckwiedergabe, nach Begrenzung
der Farbenzahl immer mehr in Kunstgewerbliche um-
gebogen, zum seelenlosen Flächenschmuck entwürdigt, —
so scheint die Plakatkunst unentrinnbar in der „Sack-
gasse“ festgefahren. Dieses Wort, von Hans Sachs
im Juli 1917 in der Zeitschrift „Das Plakat“ gesprochen,
weckt einen unerhörten Wiederhall und wirkt wie die
erlösende Zauberformel, die den verschlossenen Berg
Sesam auftut: Mit ihrem dritten Jahrzehnt öffnet sich
die Plakatkunst dem Expressionismus, sie geht
von der Fläche in die Tiefe, sie gewinnt mit dem Aus-
druck die Seele, sie hat den verlorenen Anschluß an
das große Geschehen der Zeit gefunden.
Die junge Ausdruckskunst ist ja keine Folge des
Krieges oder des Umsturzes sie hat im Gegenteil diese
Umwertung der politischen Werte für die geistigen Ge-
biete um Jahre vorausgenommen. So sehen wir auch in
der Plakatkunst die neuen Dinge schon einige Zeit vor
dem Kriege sich anbahnen. In München lassen
Glass, Schwarzer und Zietara, diese beiden aus Schlesien
gekommen, in Berlin Leni, Wiertz und andere in ihren
Arbeiten Obertöne schwingen, die dem Feinhörigen un-
gewohnt scheinen, die zum Aufhorchen zwingen und
Kommendes ahnen lassen. Auch Stuttgart, ein bis-
her unbeachteter Mitspieler, stimmt jetzt seine eigene,
aber mit den Andern gut zusammenklingende Weise an:
Frank, Sigrist, Körner sind hier die Stimmführer.
Seither ist dieser Klang immer deutlicher erkennbar
geworden, und immer stärker schwillt er an: Einer nach
dem andern hat den Ton aufgenommen, und bald wird
keiner mehr abseits bleiben wollen. Heute, am Aus-
gang ihres ersten Vierteljahrhunderts, spielt die Gebrauchs-
graphik noch auf zwei Orchestern, jedes mit einer er-
lesenen Schar wohlgeübter Musiker. Aber immer mehr
werden es, die im alten ihre Lichter ausblasen, um im
neuen die Weise aufzunehmen, die uns nur anfänglich
Mißklänge zu bergen schien, — deren brausende Schön-
heit wir aber allmählich zu würdigen lernen. Befruchtet
zuletzt noch durch die politischen Aufgaben der Kriegs-
und Umsturzzeit, die für geistige Werte zu werben
forderte, wo sie bisher nur für geschäftliche ein-
zutreten hatte, scheint die Gebrauchsgraphik unaufhaltsam
vom Stil der Fläche, der Oberfläche voranzuschreiten
zur Kunst der seelischen Tiefe, zur Ausdruckskunst.
Rembrandt,
„Doctor Faust“.
Auktion bei Hollstein
und Puppel, Berlin.
331