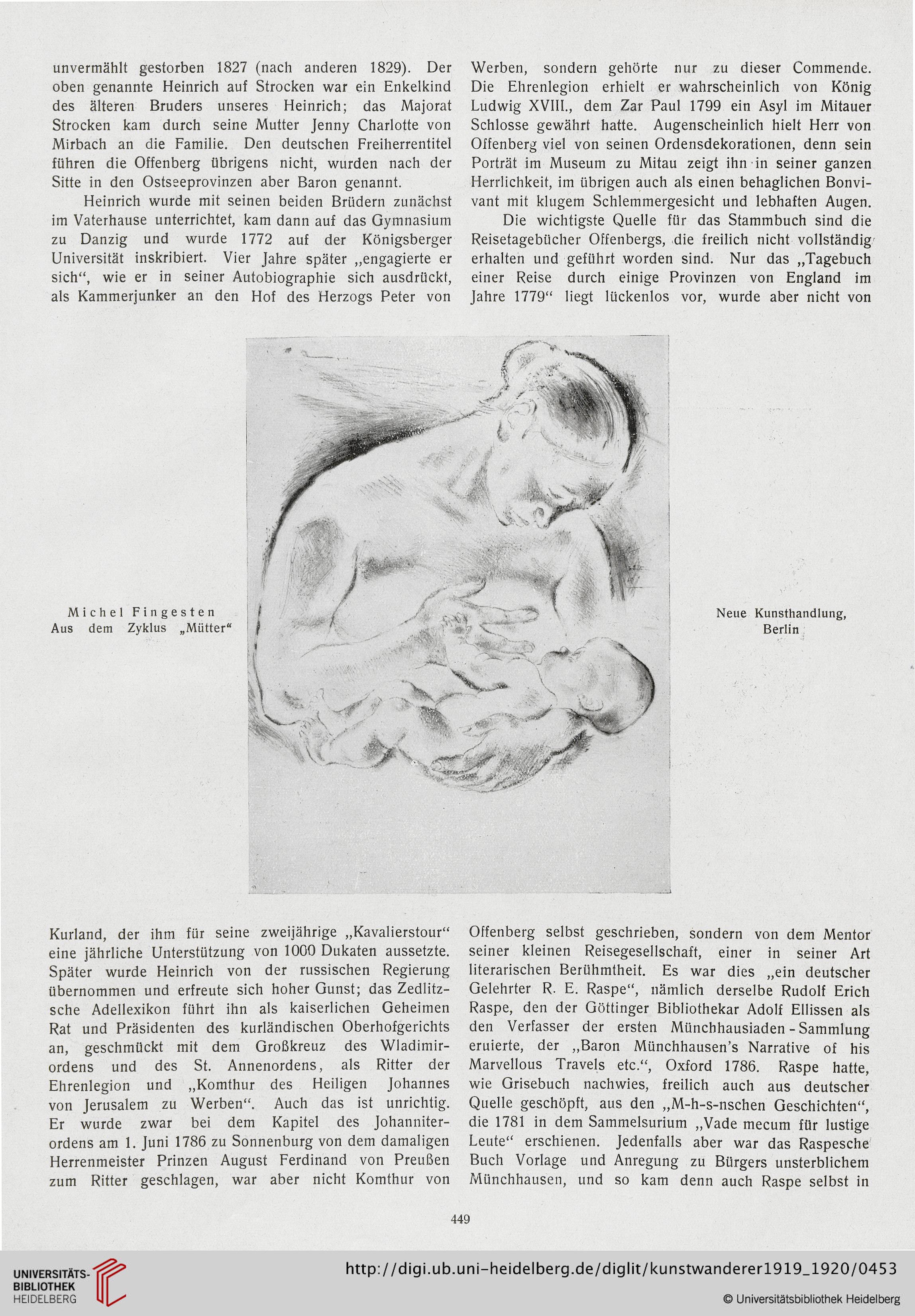unvermählt gestorben 1827 (nach anderen 1829). Der
oben genannte Heinrich auf Strocken war ein Enkelkind
des älteren Bruders unseres Heinrich; das Majorat
Strocken kam durch seine Mutter Jenny Charlotte von
Mirbach an die Familie. Den deutschen Freiherrentitel
führen die Offenberg übrigens nicht, wurden nach der
Sitte in den Ostseeprovinzen aber Baron genannt.
Heinrich wurde mit seinen beiden Brüdern zunächst
im Vaterhause unterrichtet, kam dann auf das Gymnasium
zu Danzig und wurde 1772 auf der Königsberger
Universität inskribiert. Vier Jahre später „engagierte er
sich“, wie er in seiner Autobiographie sich ausdrückf,
als Kammerjunker an den Hof des Herzogs Peter von
Werben, sondern gehörte nur zu dieser Commende.
Die Ehrenlegion erhielt er wahrscheinlich von König
Ludwig XVIII., dem Zar Paul 1799 ein Asyl im Mitauer
Schlosse gewährt hatte. Augenscheinlich hielt Herr von
Offenberg viel von seinen Ordensdekorationen, denn sein
Porträt im Museum zu Mitau zeigt ihn in seiner ganzen
Herrlichkeit, im übrigen auch als einen behaglichen Bonvi-
vant mit klugem Schlemmergesicht und lebhaften Augen.
Die wichtigste Quelle für das Stammbuch sind die
Reisetagebücher Offenbergs, die freilich nicht vollständig
erhalten und geführt worden sind. Nur das „Tagebuch
einer Reise durch einige Provinzen von England im
Jahre 1779“ liegt lückenlos vor, wurde aber nicht von
Kurland, der ihm für seine zweijährige „Kavalierstour“
eine jährliche Unterstützung von 1000 Dukaten aussetzte.
Später wurde Heinrich von der russischen Regierung
übernommen und erfreute sich hoher Gunst; das Zedlitz-
sche Adellexikon führt ihn als kaiserlichen Geheimen
Rat und Präsidenten des kurländischen Oberhofgerichts
an, geschmückt mit dem Großkreuz des Wladimir-
ordens und des St. Annenordens, als Ritter der
Ehrenlegion und „Komthur des Heiligen Johannes
von Jerusalem zu Werben“. Auch das ist unrichtig.
Er wurde zwar bei dem Kapitel des Johanniter-
ordens am 1. Juni 1786 zu Sonnenburg von dem damaligen
Herrenmeister Prinzen August Ferdinand von Preußen
zum Ritter geschlagen, war aber nicht Komthur von
Offenberg selbst geschrieben, sondern von dem Mentor
seiner kleinen Reisegesellschaft, einer in seiner Art
literarischen Berühmtheit. Es war dies „ein deutscher
Gelehrter R. E. Raspe“, nämlich derselbe Rudolf Erich
Raspe, den der Göttinger Bibliothekar Adolf Ellissen als
den Verfasser der ersten Miinchhausiaden-Sammlung
eruierte, der „Baron Münchhausen’s Narrative of his
Marvellous Travels etc.“, Oxford 1786. Raspe hatte,
wie Grisebuch nachwies, freilich auch aus deutscher
Quelle geschöpft, aus den „M-h-s-nschen Geschichten“,
die 1781 in dem Sammelsurium „Vade mecum für lustige
Leute“ erschienen. Jedenfalls aber war das Raspesche
Buch Vorlage und Anregung zu Bürgers unsterblichem
Münchhausen, und so kam denn auch Raspe selbst in
449
oben genannte Heinrich auf Strocken war ein Enkelkind
des älteren Bruders unseres Heinrich; das Majorat
Strocken kam durch seine Mutter Jenny Charlotte von
Mirbach an die Familie. Den deutschen Freiherrentitel
führen die Offenberg übrigens nicht, wurden nach der
Sitte in den Ostseeprovinzen aber Baron genannt.
Heinrich wurde mit seinen beiden Brüdern zunächst
im Vaterhause unterrichtet, kam dann auf das Gymnasium
zu Danzig und wurde 1772 auf der Königsberger
Universität inskribiert. Vier Jahre später „engagierte er
sich“, wie er in seiner Autobiographie sich ausdrückf,
als Kammerjunker an den Hof des Herzogs Peter von
Werben, sondern gehörte nur zu dieser Commende.
Die Ehrenlegion erhielt er wahrscheinlich von König
Ludwig XVIII., dem Zar Paul 1799 ein Asyl im Mitauer
Schlosse gewährt hatte. Augenscheinlich hielt Herr von
Offenberg viel von seinen Ordensdekorationen, denn sein
Porträt im Museum zu Mitau zeigt ihn in seiner ganzen
Herrlichkeit, im übrigen auch als einen behaglichen Bonvi-
vant mit klugem Schlemmergesicht und lebhaften Augen.
Die wichtigste Quelle für das Stammbuch sind die
Reisetagebücher Offenbergs, die freilich nicht vollständig
erhalten und geführt worden sind. Nur das „Tagebuch
einer Reise durch einige Provinzen von England im
Jahre 1779“ liegt lückenlos vor, wurde aber nicht von
Kurland, der ihm für seine zweijährige „Kavalierstour“
eine jährliche Unterstützung von 1000 Dukaten aussetzte.
Später wurde Heinrich von der russischen Regierung
übernommen und erfreute sich hoher Gunst; das Zedlitz-
sche Adellexikon führt ihn als kaiserlichen Geheimen
Rat und Präsidenten des kurländischen Oberhofgerichts
an, geschmückt mit dem Großkreuz des Wladimir-
ordens und des St. Annenordens, als Ritter der
Ehrenlegion und „Komthur des Heiligen Johannes
von Jerusalem zu Werben“. Auch das ist unrichtig.
Er wurde zwar bei dem Kapitel des Johanniter-
ordens am 1. Juni 1786 zu Sonnenburg von dem damaligen
Herrenmeister Prinzen August Ferdinand von Preußen
zum Ritter geschlagen, war aber nicht Komthur von
Offenberg selbst geschrieben, sondern von dem Mentor
seiner kleinen Reisegesellschaft, einer in seiner Art
literarischen Berühmtheit. Es war dies „ein deutscher
Gelehrter R. E. Raspe“, nämlich derselbe Rudolf Erich
Raspe, den der Göttinger Bibliothekar Adolf Ellissen als
den Verfasser der ersten Miinchhausiaden-Sammlung
eruierte, der „Baron Münchhausen’s Narrative of his
Marvellous Travels etc.“, Oxford 1786. Raspe hatte,
wie Grisebuch nachwies, freilich auch aus deutscher
Quelle geschöpft, aus den „M-h-s-nschen Geschichten“,
die 1781 in dem Sammelsurium „Vade mecum für lustige
Leute“ erschienen. Jedenfalls aber war das Raspesche
Buch Vorlage und Anregung zu Bürgers unsterblichem
Münchhausen, und so kam denn auch Raspe selbst in
449