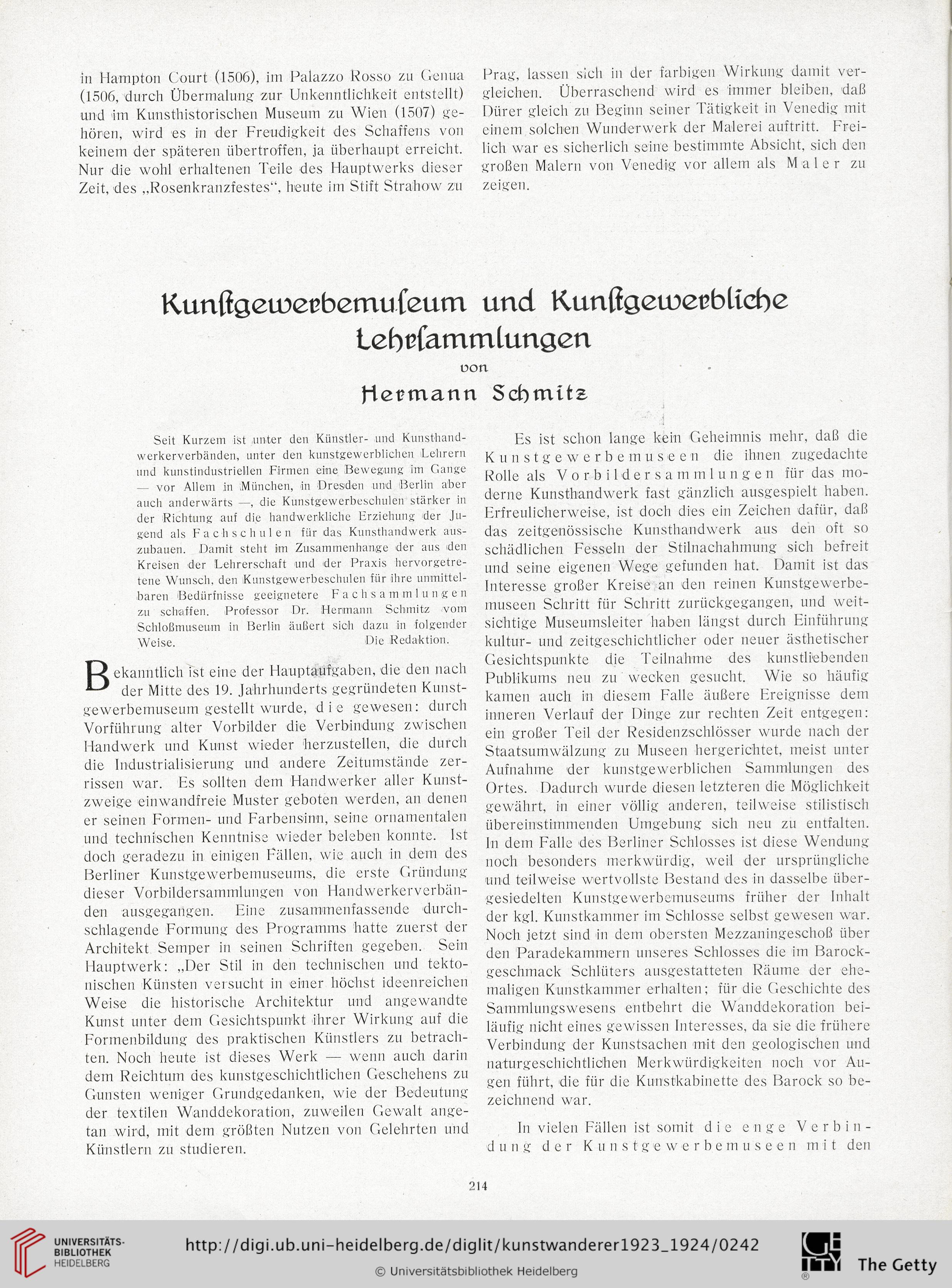in Hampton Court (1506), im Palazzo Rosso zu Genua
(1506, durch Übermalung zur Unkenntlichkeit entstellt)
und 'im Kunsthistorischen Museum zu Wien (1507) ge-
hören, wird es in -der Freudigkeit des Schaffens von
keinem der späteren tibertroffen, ja überhaupt erreicht.
Nur die wohl erhaltenen Teile des Hauptwerks dieser
Zeit, ’des „Rosenkranzfestes“, heute im Stift Strahow zu
Prag, lassen sich in der farbigen Wirkung damit ver-
gleichen. Überraschend wird es imrner bleiben, daß
Ilürer gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Venedig mit
einem solchen Wunderwerk der Malerei auftritt. Frei-
lich war es sicherlich seine bestimmte Absicht, sich den
großen Malern von Venedig vor allem als M a 1 e r zu
zeigen.
Kunffgeiöeübemuleum und KunffgemeübLtcbe
tebrfammtungen
oon
Hetmann Scbmtts
Seit Kurzem ist un-ter den Künstler- und Kunsthand-
werkervefbänden, unter den kunstgewerblichen iLehrern
und kunstindustriellen Firmen eine Beweg.ung im Gange
- vor Allem in iMünchen, in Dresden und iBerlin aber
auch anderwärts —, die Kunstgewerbescliulen stärker in
der 'Richtung auf die handwerfcliche Erziehung der Ju-
g-end als Fachschulen fiir das Kunsthan.dwerk aus-
.zubauen. Damit steht im Zusammen.han.ge der aus den
Kreisen der Lehrerschaft und der Praxis hervorgetre-
tene Wunsch, den Kunstgewerbeschulen für ihre unmittel-
.baren 'Bedürfnisse geeignetere F a c h s a m m 1 u n g e n
zu sch'affen. .Professor Dr. Herimann. Sch.mitz vom
Schloßmuseum in Berlin äußert sich dazu in folgender
Weise. -Die iRedafction.
ekanntlich Tst eine der 1 lauptauf.gaben, die den nach
der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten Kunst-
gewerbemuseum gestellt wurde, di e gewesen: durcli
Vorführung alter Vorbilder die Verbindung zwischen
Handwerk und Kunst wieder herzustellen, die durch
die Industrialisierung und andere Zeitumstände zer-
rissen war. Es sollten dem Handwerker aller Kunst-
zweige einwandfreie Muster geboten werden, an denen
er seinen Formen- und Farbensinn, seine ornamentalen
und technischen Kenntnise wieder beleben konnte. Ist
doch geradezu in einigen Fällen, wie aucli in dem des
Berliner Kunstgewerbemuseums, die erste Gründung
dieser Vorbildersammlungen von Handwerkerverbän-
den ausgegangen. Eine zusanimenfassende durcli-
schlagende Formung des Programms hatte zuerst der
Architekt Semper in seinen Schriften gegeben. Sein
Hauptwerk: „Der Stil in den technischen uud tekto-
nischen Künsten versucht in einer höchst ideenreichen
Weise die historische Architektur und angewandte
Kunst unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkung auf die
Formenbildung des praktischen Künstlers zu betrach-
ten. Noch heute. ist dieses Werk — wenn auc'h darin
dem Reichtum des kunstgeschichtlichen Geschehens zu
Gunsten weniger Grundgedanken, wie der Bedeutung
der textilen W'anddekoration, zuweilen Gewalt ange-
tan wird, mit dem größten Nutzen von Gelehrten und
Ktinstlern zu studiereu.
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß die
Kunstgewerbemuseen die ihnen zugedachte
Rolle als Vorbildersammlungen für das mo-
derne Kunsthandwerk fast gänzlich ausgespielt haben.
Erfreulicherweise, ist doch dies ein Zcichen dafür, daß
das zeitgenössische Kunsthandwerk aus den oft so
schädiichen Fesseln der Stilnachahmung sich befreit
und seine eigenen Wege gefunden hat. Damit ist das
Interesse großer Kreise an den reinen Kunstgewerbe-
museen Schritt für Schritt Zurückgegangen, und weit-
sic'htige Museumsleiter haben längst durch Einführung
kult'ur- und zeitgeschichtlicher oder neuer ästhetischer
Gesichtspunkte die Teilnähme des kunstlfebenden
Publikums neu zu wecken gesucht. Wie so häufig
kamen auch in diesem Falle äußere Ereignisse dem
inneren Verlauf der Dinge zur rechten Zeit entgegen:
ein großer Teil der Residenzschlösser wurde nach der
Staatsumwälzung zu Museen hergerichtet, meist unter
Aufnahme der kunstgewerblichen Sammlungen des
Ortes. Dadurch wurde diesen letzteren die Möglichkeit
gewährt, in einer völlig anderen, teilweise stilistisch
übereinstimmenden Umgebung sich neu zu entfalten.
In dem Falle des Berliner Schlosses ist diese Wendung
noch besonders merkwürdig, wei'l der ursprüngliche
und teilweise wertvollste Bestand des in dasselbe über-
gesiedelten Kunstgewerbemuseums früher der Inhalt
der kgl. Kunstkammer im Schlosse selbst gewesen war.
Noch jetzt sind in dem obersten Mezzaningeschoß über
den Paradekammern unseres Schlosse's die im Barock-
geschmack Schlüters ausgestatteten Räume der ebe-
maligen Kunstkammer erhalten; für die Geschichte des
Sammlungswesens eiitbehrt die Wanddekoration bei-
läufig nicht eines gewissen Interesses, da sie die frühere
Verbindung der Kunstsachen mit den geologischen und
naturgeschichtlichen Merkwürdigkeiten noch vor Au-
gen führt, die für die Kunstkabinette des Barock so be-
zeichnend war.
In vielen Fällen ist somit d i e e n g e V e r b i n -
d u n g d e r K u n s t g e w e r b e m u s e e n m i t den
214
(1506, durch Übermalung zur Unkenntlichkeit entstellt)
und 'im Kunsthistorischen Museum zu Wien (1507) ge-
hören, wird es in -der Freudigkeit des Schaffens von
keinem der späteren tibertroffen, ja überhaupt erreicht.
Nur die wohl erhaltenen Teile des Hauptwerks dieser
Zeit, ’des „Rosenkranzfestes“, heute im Stift Strahow zu
Prag, lassen sich in der farbigen Wirkung damit ver-
gleichen. Überraschend wird es imrner bleiben, daß
Ilürer gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Venedig mit
einem solchen Wunderwerk der Malerei auftritt. Frei-
lich war es sicherlich seine bestimmte Absicht, sich den
großen Malern von Venedig vor allem als M a 1 e r zu
zeigen.
Kunffgeiöeübemuleum und KunffgemeübLtcbe
tebrfammtungen
oon
Hetmann Scbmtts
Seit Kurzem ist un-ter den Künstler- und Kunsthand-
werkervefbänden, unter den kunstgewerblichen iLehrern
und kunstindustriellen Firmen eine Beweg.ung im Gange
- vor Allem in iMünchen, in Dresden und iBerlin aber
auch anderwärts —, die Kunstgewerbescliulen stärker in
der 'Richtung auf die handwerfcliche Erziehung der Ju-
g-end als Fachschulen fiir das Kunsthan.dwerk aus-
.zubauen. Damit steht im Zusammen.han.ge der aus den
Kreisen der Lehrerschaft und der Praxis hervorgetre-
tene Wunsch, den Kunstgewerbeschulen für ihre unmittel-
.baren 'Bedürfnisse geeignetere F a c h s a m m 1 u n g e n
zu sch'affen. .Professor Dr. Herimann. Sch.mitz vom
Schloßmuseum in Berlin äußert sich dazu in folgender
Weise. -Die iRedafction.
ekanntlich Tst eine der 1 lauptauf.gaben, die den nach
der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten Kunst-
gewerbemuseum gestellt wurde, di e gewesen: durcli
Vorführung alter Vorbilder die Verbindung zwischen
Handwerk und Kunst wieder herzustellen, die durch
die Industrialisierung und andere Zeitumstände zer-
rissen war. Es sollten dem Handwerker aller Kunst-
zweige einwandfreie Muster geboten werden, an denen
er seinen Formen- und Farbensinn, seine ornamentalen
und technischen Kenntnise wieder beleben konnte. Ist
doch geradezu in einigen Fällen, wie aucli in dem des
Berliner Kunstgewerbemuseums, die erste Gründung
dieser Vorbildersammlungen von Handwerkerverbän-
den ausgegangen. Eine zusanimenfassende durcli-
schlagende Formung des Programms hatte zuerst der
Architekt Semper in seinen Schriften gegeben. Sein
Hauptwerk: „Der Stil in den technischen uud tekto-
nischen Künsten versucht in einer höchst ideenreichen
Weise die historische Architektur und angewandte
Kunst unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkung auf die
Formenbildung des praktischen Künstlers zu betrach-
ten. Noch heute. ist dieses Werk — wenn auc'h darin
dem Reichtum des kunstgeschichtlichen Geschehens zu
Gunsten weniger Grundgedanken, wie der Bedeutung
der textilen W'anddekoration, zuweilen Gewalt ange-
tan wird, mit dem größten Nutzen von Gelehrten und
Ktinstlern zu studiereu.
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß die
Kunstgewerbemuseen die ihnen zugedachte
Rolle als Vorbildersammlungen für das mo-
derne Kunsthandwerk fast gänzlich ausgespielt haben.
Erfreulicherweise, ist doch dies ein Zcichen dafür, daß
das zeitgenössische Kunsthandwerk aus den oft so
schädiichen Fesseln der Stilnachahmung sich befreit
und seine eigenen Wege gefunden hat. Damit ist das
Interesse großer Kreise an den reinen Kunstgewerbe-
museen Schritt für Schritt Zurückgegangen, und weit-
sic'htige Museumsleiter haben längst durch Einführung
kult'ur- und zeitgeschichtlicher oder neuer ästhetischer
Gesichtspunkte die Teilnähme des kunstlfebenden
Publikums neu zu wecken gesucht. Wie so häufig
kamen auch in diesem Falle äußere Ereignisse dem
inneren Verlauf der Dinge zur rechten Zeit entgegen:
ein großer Teil der Residenzschlösser wurde nach der
Staatsumwälzung zu Museen hergerichtet, meist unter
Aufnahme der kunstgewerblichen Sammlungen des
Ortes. Dadurch wurde diesen letzteren die Möglichkeit
gewährt, in einer völlig anderen, teilweise stilistisch
übereinstimmenden Umgebung sich neu zu entfalten.
In dem Falle des Berliner Schlosses ist diese Wendung
noch besonders merkwürdig, wei'l der ursprüngliche
und teilweise wertvollste Bestand des in dasselbe über-
gesiedelten Kunstgewerbemuseums früher der Inhalt
der kgl. Kunstkammer im Schlosse selbst gewesen war.
Noch jetzt sind in dem obersten Mezzaningeschoß über
den Paradekammern unseres Schlosse's die im Barock-
geschmack Schlüters ausgestatteten Räume der ebe-
maligen Kunstkammer erhalten; für die Geschichte des
Sammlungswesens eiitbehrt die Wanddekoration bei-
läufig nicht eines gewissen Interesses, da sie die frühere
Verbindung der Kunstsachen mit den geologischen und
naturgeschichtlichen Merkwürdigkeiten noch vor Au-
gen führt, die für die Kunstkabinette des Barock so be-
zeichnend war.
In vielen Fällen ist somit d i e e n g e V e r b i n -
d u n g d e r K u n s t g e w e r b e m u s e e n m i t den
214