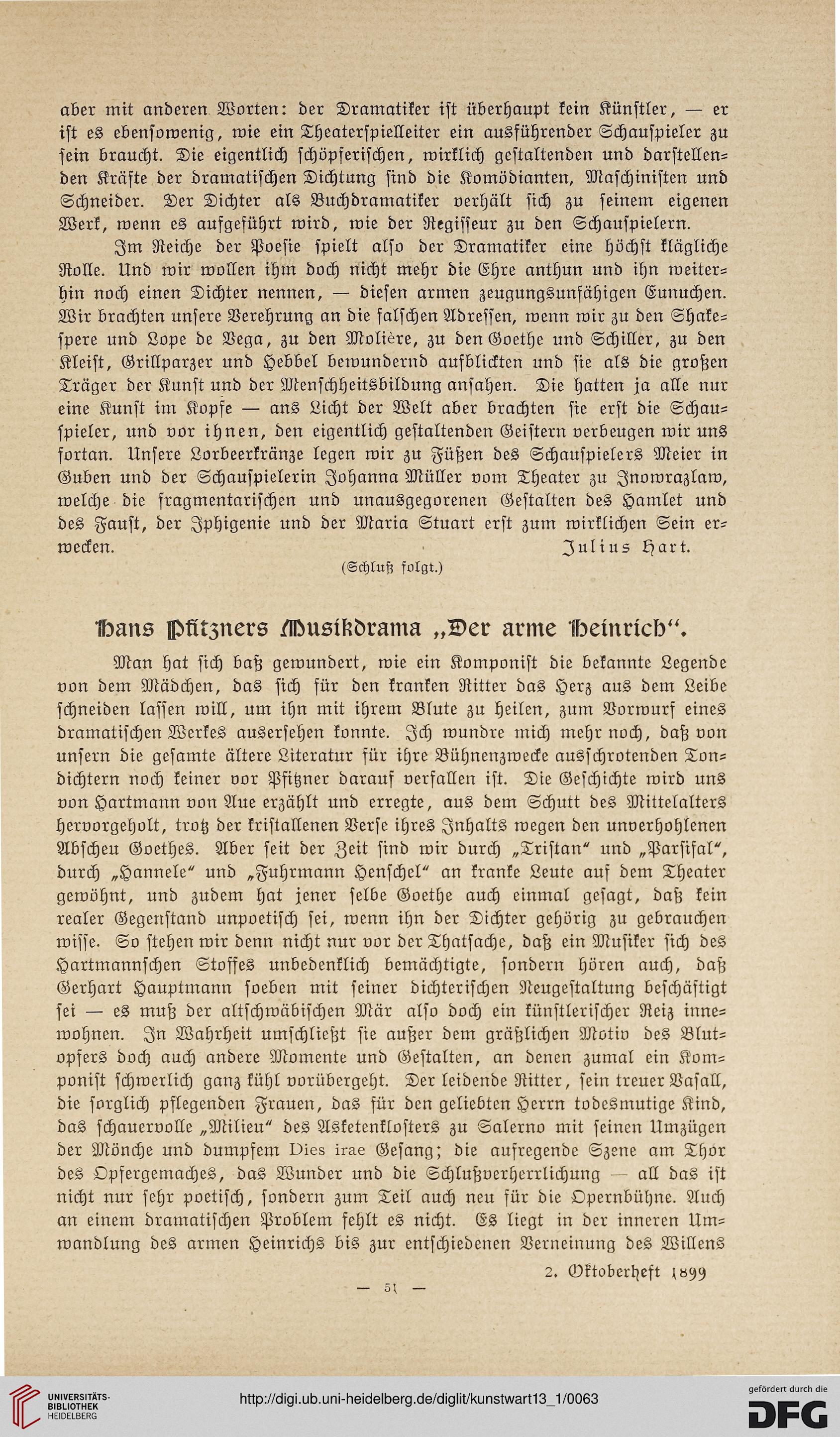aber mit anderen Worten: der Dramatiker ist überhaupt kein Künftler, — er
ist es ebensowenig, wie ein Theaterspielleiter ein ausführender Schauspieler zu
sein braucht. Die eigentlich schöpferischen, wirklich gestaltenden und darstellen-
den Kräfte der Lramatischen Dichtung sind die Komödianten, Maschinisten und
Schneider. Der Dichter als Buchdramatiker verhält sich zu seinem eigenen
Werk, wenn es aufgesührt wird, wie der Regisseur zu den Schauspielern.
Jm Reiche der Poesie spielt also der Dramatiker eine höchst klägliche
Rolle. Und wir wollen ihm doch nicht mehr die Ehre anthun und ihn weiter-
hin noch einen Dichter nennen, — diesen armen zeugungsunfähigen Eunuchen.
Wir brachten unsere Verehrung an die falschen Adressen, wenn wir zu den Shake-
spere und Lope de Vega, zu den Moliere, zu den Goethe und Schiller, zu den
Kleist, Grillparzer und Hebbel bewundernd aufblickten und sie als die großen
Träger der Kunst und der Menschheitsbildung ansahen. Die hatten ja alle nur
eine Kunst im Kopfe — ans Licht der Welt aber brachten sie erst die Schau-
spieler, und vor ihnen, den eigentlich gestaltenden Geistern verbeugen wir uns
sortan. Unsere Lorbeerkränze legen wir zu Füßen des Schauspielers Meier in
Guben und der Schauspielerin Johanna Müller vom Theater zu Jnowrazlaw,
welche die fragmentarischen und unausgegorenen Gestalten des Hamlet und
des Faust, der Jphigenie und der Maria Stuart erst zum wirklichen Sein er-
wecken. Iulius Lsart.
(Schluß folgt.)
Dans Mtzners /DusLkdrnma „Der urme Deinricb".
Man hat sich baß gewundert, wie ein Komponist die bekannte Legende
von dem Mädchen, das sich sür den kranken Ritter das Herz aus dem Leibe
schneiden lassen will, um ihn mit ihrem Blute zu heilen, zum Vorwurf eines
dramatischen Werkes ausersehen konnte. Jch wundre mich mehr noch, daß von
unsern die gesamte ältere Literatur sür ihre Bühnenzwecke ausschrotenden Ton-
dichtern noch keiner vor Pfitzner darauf verfallen ist. Die Geschichte wird uns
von Hartmann von Aue erzählt und erregte, aus dem Schutt des Mittelalters
hervorgeholt, trotz der kristallenen Verse ihres Jnhalts wegen den unverhohlenen
Abscheu Goethes. Aber seit der Zeit sind wir durch „Tristan" und „Parsifal",
durch „Hannele" und „Fuhrmann Henschel" an kranke Leute auf dem Theater
gewöhnt, und zudem hat jener selbe Goethe auch einmal gesagt, daß kein
realer Gegenstand unpoetisch sei, wenn ihn der Dichter gehörig zu gebrauchen
wisse. So stehen wir denn nicht nur vor der Thatsache, daß ein Musiker sich des
Hartmannschen Stoffes unbedenklich bemächtigte, sondern hören auch, daß
Gerhart Hauptmann soeben mit seiner dichterischen Neugestaltung beschäftigt
sei — es muß der altschwäbischen Mär also doch ein künstlerischer Reiz inne-
wohnen. Jn Wahrheit umschließt sie außer dem gräßlichen Motiv des Blut-
opfers doch auch andere Momente und Gestalten, an denen zumal ein Kom-
ponist schwerlich ganz kühl vorübergeht. Der leidende Ritter, sein treuer Vasall,
die sorglich pslegenden Frauen, das sür den geliebten Herrn todesmutige Kind,
das schauervolle „Milieu" des Asketenklosters zu Salerno mit seinen Umzügen
der Mönche und dumpfem Vle8 irLs Gesang; die aufregende Szene am Thor
des Opfergemaches, das Wunder und die Schlußverherrlichung — all das ist
nicht nur sehr poetisch, sondern zum Teil auch neu für die Opernbühne. Auch
an einem dramatischen Problem fehlt es nicht. Es liegt in der inneren Um-
wandlung des armen Heinrichs bis zur entschiedenen Verneinung des Willens
2. Gktoberheft (8(19
ist es ebensowenig, wie ein Theaterspielleiter ein ausführender Schauspieler zu
sein braucht. Die eigentlich schöpferischen, wirklich gestaltenden und darstellen-
den Kräfte der Lramatischen Dichtung sind die Komödianten, Maschinisten und
Schneider. Der Dichter als Buchdramatiker verhält sich zu seinem eigenen
Werk, wenn es aufgesührt wird, wie der Regisseur zu den Schauspielern.
Jm Reiche der Poesie spielt also der Dramatiker eine höchst klägliche
Rolle. Und wir wollen ihm doch nicht mehr die Ehre anthun und ihn weiter-
hin noch einen Dichter nennen, — diesen armen zeugungsunfähigen Eunuchen.
Wir brachten unsere Verehrung an die falschen Adressen, wenn wir zu den Shake-
spere und Lope de Vega, zu den Moliere, zu den Goethe und Schiller, zu den
Kleist, Grillparzer und Hebbel bewundernd aufblickten und sie als die großen
Träger der Kunst und der Menschheitsbildung ansahen. Die hatten ja alle nur
eine Kunst im Kopfe — ans Licht der Welt aber brachten sie erst die Schau-
spieler, und vor ihnen, den eigentlich gestaltenden Geistern verbeugen wir uns
sortan. Unsere Lorbeerkränze legen wir zu Füßen des Schauspielers Meier in
Guben und der Schauspielerin Johanna Müller vom Theater zu Jnowrazlaw,
welche die fragmentarischen und unausgegorenen Gestalten des Hamlet und
des Faust, der Jphigenie und der Maria Stuart erst zum wirklichen Sein er-
wecken. Iulius Lsart.
(Schluß folgt.)
Dans Mtzners /DusLkdrnma „Der urme Deinricb".
Man hat sich baß gewundert, wie ein Komponist die bekannte Legende
von dem Mädchen, das sich sür den kranken Ritter das Herz aus dem Leibe
schneiden lassen will, um ihn mit ihrem Blute zu heilen, zum Vorwurf eines
dramatischen Werkes ausersehen konnte. Jch wundre mich mehr noch, daß von
unsern die gesamte ältere Literatur sür ihre Bühnenzwecke ausschrotenden Ton-
dichtern noch keiner vor Pfitzner darauf verfallen ist. Die Geschichte wird uns
von Hartmann von Aue erzählt und erregte, aus dem Schutt des Mittelalters
hervorgeholt, trotz der kristallenen Verse ihres Jnhalts wegen den unverhohlenen
Abscheu Goethes. Aber seit der Zeit sind wir durch „Tristan" und „Parsifal",
durch „Hannele" und „Fuhrmann Henschel" an kranke Leute auf dem Theater
gewöhnt, und zudem hat jener selbe Goethe auch einmal gesagt, daß kein
realer Gegenstand unpoetisch sei, wenn ihn der Dichter gehörig zu gebrauchen
wisse. So stehen wir denn nicht nur vor der Thatsache, daß ein Musiker sich des
Hartmannschen Stoffes unbedenklich bemächtigte, sondern hören auch, daß
Gerhart Hauptmann soeben mit seiner dichterischen Neugestaltung beschäftigt
sei — es muß der altschwäbischen Mär also doch ein künstlerischer Reiz inne-
wohnen. Jn Wahrheit umschließt sie außer dem gräßlichen Motiv des Blut-
opfers doch auch andere Momente und Gestalten, an denen zumal ein Kom-
ponist schwerlich ganz kühl vorübergeht. Der leidende Ritter, sein treuer Vasall,
die sorglich pslegenden Frauen, das sür den geliebten Herrn todesmutige Kind,
das schauervolle „Milieu" des Asketenklosters zu Salerno mit seinen Umzügen
der Mönche und dumpfem Vle8 irLs Gesang; die aufregende Szene am Thor
des Opfergemaches, das Wunder und die Schlußverherrlichung — all das ist
nicht nur sehr poetisch, sondern zum Teil auch neu für die Opernbühne. Auch
an einem dramatischen Problem fehlt es nicht. Es liegt in der inneren Um-
wandlung des armen Heinrichs bis zur entschiedenen Verneinung des Willens
2. Gktoberheft (8(19