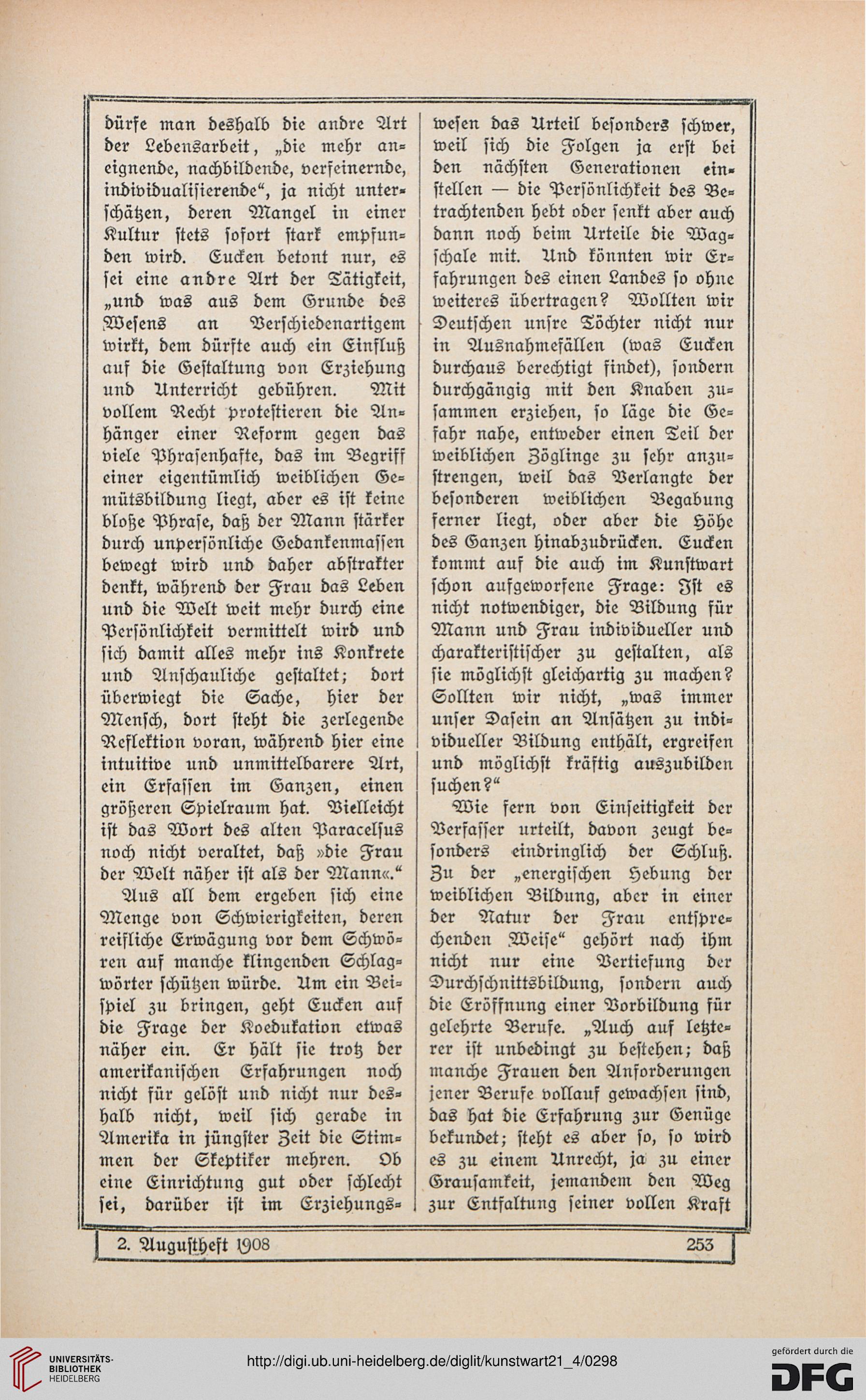dürfe man deshalb die andre Art
der Lebensarbeit, „die mehr an-
eignende, nachbildende, verfeinernde,
individualisierende", ja nicht unter-
schätzen, deren Mangel in einer
Knltur stets sofort stark empfun-
den wird. Eucken betont nur, es
sei eine andre Art der Tätigkeit,
„und was aus dem Grunde des
Mesens an Verschiedenartigem
wirkt, dem dürfte auch ein Einfluß
auf die Gestaltung von Erziehung
und Unterricht gebühren. Mit
vollem Recht protestieren die An°
hänger einer Reform gegen das
viele Phrasenhafte, das im Vegriff
einer eigentümlich weiblichen Ge°
mütsbildung liegt, aber es ist keine
bloße Phrase, daß der Mann stärker
durch unpersönliche Gedankenmassen
bewegt wird unü daher abstrakter
denkt, während der Frau das Leben
und die Welt weit mehr durch eine
Persönlichkeit vermittelt wird und
sich damit alles mehr ins Konkrete
und Anschauliche gcstaltet; dort
überwiegt die Sache, hier der
Mensch, dort steht die zerlegende
Reflektion voran, während hier eine
intuitive und unmittelbarere Art,
ein Erfassen im Ganzen, einen
größeren Spielraum hat. Vielleicht
ist das Wort des alten Paracelsus
noch nicht veraltet, daß »die Frau
der Wclt näher ist als der Mann«."
Aus all dem ergebcn sich cine
Mcnge von Schwierigkeiten, deren
reifliche Erwägung vor dem Schwö-
ren auf manche klingcnden Schlag-
wörter schützen würde. Um ein Bei-
spiel zu bringen, geht Eucken auf
die Frage der Koedukation etwas
näher ein. Er hält sie trotz der
amerikanischen Lrfahrungen noch
nicht für gelöst und nicht nur des-
halb nicht, weil sich gerade in
Amerika in jüngster Zeit die Stim-
men der Skeptiker mehren. Ob
eine Linrichtung gut oder schlecht
sei, darüber ist im Erziehungs-
2. Augustheft lZ08
wesen das Arteil besonders schwer,
weil sich die Folgen ja erst bei
den nächsten Generationen «in-
stellen — die Persönlichkeit des Be-
trachtenden hebt oder senkt aber auch
dann noch beim Urteile die Wag-
schale mit. Und könnten wir Lr-
fahrungen des einen Landes so ohne
weiteres übertragcn? Wollten wir
Deutschen unsre Töchter nicht nur
in Ausnahmefällen (was Eucken
durchaus berechtigt findet), sondern
durchgängig mit den Knaben zu-
sammen erziehen, so läge die Ge-
fahr nahe, entweder einen Teil der
weiblichen Zöglinge zu sehr anzu-
strengen, weil das Verlangte der
besonderen weiblichcn Begabung
ferner liegt, oder aber die Höhe
des Ganzen hinabzudrücken. Eucken
kommt auf die auch im Kunstwart
schon aufgeworfene Frage: Ist es
nicht notwendiger, die Bildung für
Mann und Frau nrdividueller und
charakteristischer zu gestalten, als
sie möglichst gleichartig zu machen?
Sollten wir nicht, „was immer
unser Dasein an Ansätzen zu indi-
vidueller Bildung enthält, ergreifen
und möglichst kräftig auszubilden
suchen?"
Wie fern von Einseitigkeit dcr
Verfasser urteilt, davon zeugt be°
sonders eindringlich der Schluß.
Zu der „energischen Hebung dcr
weiblichen Bildung, abcr in einer
der Natur der Frau entspre-
chcnden Weise" gehört nach ihm
nicht nur eine Vertiefung der
Durchschnittsbildung, sondern auch
die Eröffnung einer Vorbildung für
gelehrte Berufe. „Auch auf letzte-
rer ist unbedingt zu bestehen; daß
manche Frauen den Anforderungen
jener Berufe vollauf gewachsen sind,
das hat die Erfahrung zur Genüge
bekundet; steht es aber so, so wird
es zu einem Unrecht, ja zu einer
Grausamkeit, jemandem den Weg
zur Entfaltung seiner vollen Kraft
253
der Lebensarbeit, „die mehr an-
eignende, nachbildende, verfeinernde,
individualisierende", ja nicht unter-
schätzen, deren Mangel in einer
Knltur stets sofort stark empfun-
den wird. Eucken betont nur, es
sei eine andre Art der Tätigkeit,
„und was aus dem Grunde des
Mesens an Verschiedenartigem
wirkt, dem dürfte auch ein Einfluß
auf die Gestaltung von Erziehung
und Unterricht gebühren. Mit
vollem Recht protestieren die An°
hänger einer Reform gegen das
viele Phrasenhafte, das im Vegriff
einer eigentümlich weiblichen Ge°
mütsbildung liegt, aber es ist keine
bloße Phrase, daß der Mann stärker
durch unpersönliche Gedankenmassen
bewegt wird unü daher abstrakter
denkt, während der Frau das Leben
und die Welt weit mehr durch eine
Persönlichkeit vermittelt wird und
sich damit alles mehr ins Konkrete
und Anschauliche gcstaltet; dort
überwiegt die Sache, hier der
Mensch, dort steht die zerlegende
Reflektion voran, während hier eine
intuitive und unmittelbarere Art,
ein Erfassen im Ganzen, einen
größeren Spielraum hat. Vielleicht
ist das Wort des alten Paracelsus
noch nicht veraltet, daß »die Frau
der Wclt näher ist als der Mann«."
Aus all dem ergebcn sich cine
Mcnge von Schwierigkeiten, deren
reifliche Erwägung vor dem Schwö-
ren auf manche klingcnden Schlag-
wörter schützen würde. Um ein Bei-
spiel zu bringen, geht Eucken auf
die Frage der Koedukation etwas
näher ein. Er hält sie trotz der
amerikanischen Lrfahrungen noch
nicht für gelöst und nicht nur des-
halb nicht, weil sich gerade in
Amerika in jüngster Zeit die Stim-
men der Skeptiker mehren. Ob
eine Linrichtung gut oder schlecht
sei, darüber ist im Erziehungs-
2. Augustheft lZ08
wesen das Arteil besonders schwer,
weil sich die Folgen ja erst bei
den nächsten Generationen «in-
stellen — die Persönlichkeit des Be-
trachtenden hebt oder senkt aber auch
dann noch beim Urteile die Wag-
schale mit. Und könnten wir Lr-
fahrungen des einen Landes so ohne
weiteres übertragcn? Wollten wir
Deutschen unsre Töchter nicht nur
in Ausnahmefällen (was Eucken
durchaus berechtigt findet), sondern
durchgängig mit den Knaben zu-
sammen erziehen, so läge die Ge-
fahr nahe, entweder einen Teil der
weiblichen Zöglinge zu sehr anzu-
strengen, weil das Verlangte der
besonderen weiblichcn Begabung
ferner liegt, oder aber die Höhe
des Ganzen hinabzudrücken. Eucken
kommt auf die auch im Kunstwart
schon aufgeworfene Frage: Ist es
nicht notwendiger, die Bildung für
Mann und Frau nrdividueller und
charakteristischer zu gestalten, als
sie möglichst gleichartig zu machen?
Sollten wir nicht, „was immer
unser Dasein an Ansätzen zu indi-
vidueller Bildung enthält, ergreifen
und möglichst kräftig auszubilden
suchen?"
Wie fern von Einseitigkeit dcr
Verfasser urteilt, davon zeugt be°
sonders eindringlich der Schluß.
Zu der „energischen Hebung dcr
weiblichen Bildung, abcr in einer
der Natur der Frau entspre-
chcnden Weise" gehört nach ihm
nicht nur eine Vertiefung der
Durchschnittsbildung, sondern auch
die Eröffnung einer Vorbildung für
gelehrte Berufe. „Auch auf letzte-
rer ist unbedingt zu bestehen; daß
manche Frauen den Anforderungen
jener Berufe vollauf gewachsen sind,
das hat die Erfahrung zur Genüge
bekundet; steht es aber so, so wird
es zu einem Unrecht, ja zu einer
Grausamkeit, jemandem den Weg
zur Entfaltung seiner vollen Kraft
253