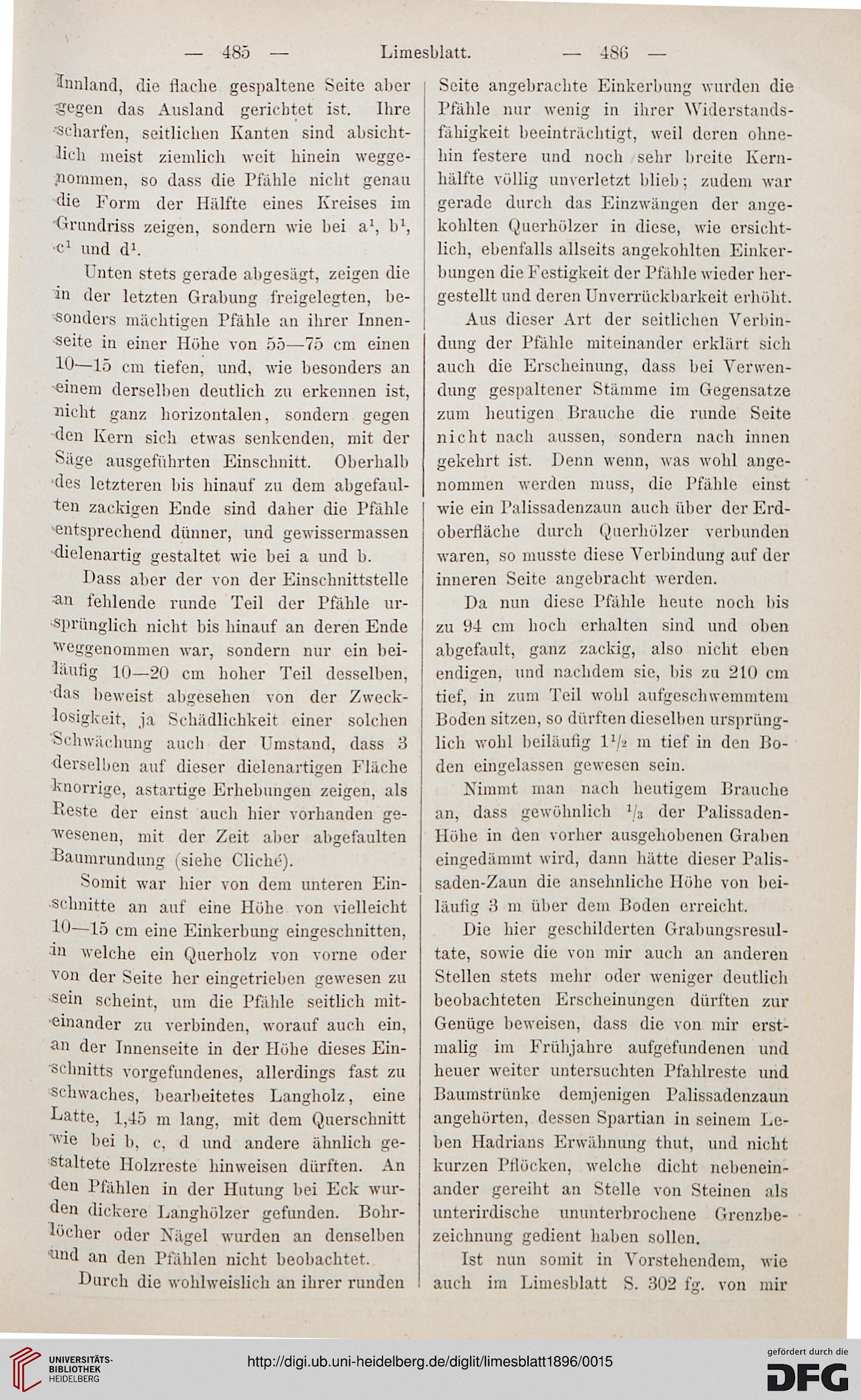— 485 — Limesblatt.
Innland, die flache gespaltene Seite aber
Segen das Ausland gerichtet ist. Ihre
'Scharfen, seitlichen Kanten sind absicht-
lich meist ziemlich weit hinein wegge-
kommen, so dass die Pfahle nicht genau
die Form der Hälfte eines Kreises im
Gnindriss zeigen, sondern wie hei a1, bl,
c1 und d1.
Unten stets gerade abgesägt, zeigen die
m der letzten Grabung freigelegten, be-
sonders mächtigen Pfähle an ihrer Innen-
seite in einer Höhe von 55—75 cm einen
10—15 cm tiefen, und, wie besonders an
einem derselben deutlich zu erkennen ist,
nicht ganz horizontalen, sondern gegen
den Kern sich etwas senkenden, mit der
Säge ausgeführten Einschnitt. Oberhalb
des letzteren bis hinauf zu dem abgefaul-
ten zackigen Ende sind daher die Pfähle
entsprechend dünner, und gewissermassen
dielenartig gestaltet wie bei a und b.
Bass aber der von der Einschnittstelle
an fehlende runde Teil der Pfähle ur-
sprünglich nicht bis hinauf an deren Ende
weggenommen war, sondern nur ein bei-
läufig 10—20 cm hoher Teil desselben,
das beweist abgesehen von der Zweck-
losigkeit, ja Schädlichkeit einer solchen
Schwächung auch der Umstand, dass 3
derselben auf dieser dielenartigen Fläche
knorrige, astartige Erhebungen zeigen, als
Reste der einst auch hier vorhanden ge-
wesenen, mit der Zeit aber abgefaulten
Baumrundung (siehe Cliche").
Somit war hier von dem unteren Ein-
schnitte an auf eine Höhe von vielleicht
10—15 cm eine Einkerbung eingeschnitten,
in welche ein Querholz von vorne oder
von der Seite her eingetrieben gewesen zu
sein scheint, um die Pfähle seitlich mit-
einander zu verbinden, worauf auch ein,
an der Innenseite in der Höhe dieses Ein-
schnitts vorgefundenes, allerdings fast zu
schwaches, bearbeitetes Langholz, eine
Latte, 1,45 m lang, mit dem Querschnitt
wie bei b, c, d und andere ähnlich ge-
staltete Holzreste hinweisen dürften. An
den Pfählen in der Hutung bei Eck wur-
den dickere Langhölzer gefunden. Bohr-
locher oder Nägel wurden an denselben
«nd an den Pfählen nicht beobachtet.
Durch die wohlweislich an ihrer runden
— 486
Seite angebrachte Einkerbung wurden die
Pfähle nur wenig in ihrer Widerstands-
fähigkeit beeinträchtigt, weil deren ohne-
hin festere und noch sehr breite Kern-
hälfte völlig unverletzt blieb; zudem war
gerade durch das Einzwängen der ange-
kohlten QaerhOlzei in diese, wie ersicht-
lich, ebenfalls allseits angekohlten Einker-
bungen die Festigkeit der Pfähle wieder her-
gestellt und deren Unverrückbarkeit erhöht.
Aus dieser Art der seitlichen Verbin-
dung der Pfähle miteinander erklärt sich
auch die Erscheinung, dass bei Verwen-
dung gespaltener Stämme im Gegensatze
zum heutigen Brauche die runde Seite
nicht nach aussen, sondern nach innen
gekehrt ist. Denn wenn, was wohl ange-
nommen werden muss, die Pfähle einst
wie ein Palissadenzaun auch über der Erd-
oberfläche durch Querhölzer verbunden
waren, so musste diese Verbindung auf der
inneren Seite angebracht werden.
Da nun diese Pfähle heute noch bis
zu 94 cm hoch erhalten sind und oben
abgefault, ganz zackig, also nicht eben
endigen, und nachdem sie, bis zu 210 cm
tief, in zum Teil wohl aufgeschwemmtem
Boden sitzen, so dürften dieselben ursprüng-
lich wohl beiläufig l1/- m tief in den Bo-
den eingelassen gewesen sein.
Nimmt man nach heutigem Brauche
an, dass gewöhnlich '/i der Palissaden-
Höhe in den vorher ausgehobenen Graben
eingedämmt wird, dann hätte dieser Palis-
saden-Zaun die ansehnliche Höhe von hei-
läufig 3 m über dem Boden erreicht.
Die hier geschilderten Grabungsresul-
tate, sowie die von mir auch an anderen
Stellen stets mehr oder weniger deutlich
beobachteten Erscheinungen dürften zur
Genüge beweisen, dass die von mir erst-
malig im Frühjahre aufgefundenen und
heuer weiter untersuchten Pfahlreste und
Baumstrünke demjenigen Palissadenzaun
angehörten, dessen Spartian in seinem Le-
ben Hadrians Erwähnung thut, und nicht
kurzen Pflöcken, welche dicht nebenein-
ander gereiht an Stelle von Steinen als
unterirdische ununterbrochene Grenzbe-
zeichnung gedient haben sollen.
Ist nun somit in Vorstehendem, wie
auch im Limesblatt S. 302 fg. von mir
Innland, die flache gespaltene Seite aber
Segen das Ausland gerichtet ist. Ihre
'Scharfen, seitlichen Kanten sind absicht-
lich meist ziemlich weit hinein wegge-
kommen, so dass die Pfahle nicht genau
die Form der Hälfte eines Kreises im
Gnindriss zeigen, sondern wie hei a1, bl,
c1 und d1.
Unten stets gerade abgesägt, zeigen die
m der letzten Grabung freigelegten, be-
sonders mächtigen Pfähle an ihrer Innen-
seite in einer Höhe von 55—75 cm einen
10—15 cm tiefen, und, wie besonders an
einem derselben deutlich zu erkennen ist,
nicht ganz horizontalen, sondern gegen
den Kern sich etwas senkenden, mit der
Säge ausgeführten Einschnitt. Oberhalb
des letzteren bis hinauf zu dem abgefaul-
ten zackigen Ende sind daher die Pfähle
entsprechend dünner, und gewissermassen
dielenartig gestaltet wie bei a und b.
Bass aber der von der Einschnittstelle
an fehlende runde Teil der Pfähle ur-
sprünglich nicht bis hinauf an deren Ende
weggenommen war, sondern nur ein bei-
läufig 10—20 cm hoher Teil desselben,
das beweist abgesehen von der Zweck-
losigkeit, ja Schädlichkeit einer solchen
Schwächung auch der Umstand, dass 3
derselben auf dieser dielenartigen Fläche
knorrige, astartige Erhebungen zeigen, als
Reste der einst auch hier vorhanden ge-
wesenen, mit der Zeit aber abgefaulten
Baumrundung (siehe Cliche").
Somit war hier von dem unteren Ein-
schnitte an auf eine Höhe von vielleicht
10—15 cm eine Einkerbung eingeschnitten,
in welche ein Querholz von vorne oder
von der Seite her eingetrieben gewesen zu
sein scheint, um die Pfähle seitlich mit-
einander zu verbinden, worauf auch ein,
an der Innenseite in der Höhe dieses Ein-
schnitts vorgefundenes, allerdings fast zu
schwaches, bearbeitetes Langholz, eine
Latte, 1,45 m lang, mit dem Querschnitt
wie bei b, c, d und andere ähnlich ge-
staltete Holzreste hinweisen dürften. An
den Pfählen in der Hutung bei Eck wur-
den dickere Langhölzer gefunden. Bohr-
locher oder Nägel wurden an denselben
«nd an den Pfählen nicht beobachtet.
Durch die wohlweislich an ihrer runden
— 486
Seite angebrachte Einkerbung wurden die
Pfähle nur wenig in ihrer Widerstands-
fähigkeit beeinträchtigt, weil deren ohne-
hin festere und noch sehr breite Kern-
hälfte völlig unverletzt blieb; zudem war
gerade durch das Einzwängen der ange-
kohlten QaerhOlzei in diese, wie ersicht-
lich, ebenfalls allseits angekohlten Einker-
bungen die Festigkeit der Pfähle wieder her-
gestellt und deren Unverrückbarkeit erhöht.
Aus dieser Art der seitlichen Verbin-
dung der Pfähle miteinander erklärt sich
auch die Erscheinung, dass bei Verwen-
dung gespaltener Stämme im Gegensatze
zum heutigen Brauche die runde Seite
nicht nach aussen, sondern nach innen
gekehrt ist. Denn wenn, was wohl ange-
nommen werden muss, die Pfähle einst
wie ein Palissadenzaun auch über der Erd-
oberfläche durch Querhölzer verbunden
waren, so musste diese Verbindung auf der
inneren Seite angebracht werden.
Da nun diese Pfähle heute noch bis
zu 94 cm hoch erhalten sind und oben
abgefault, ganz zackig, also nicht eben
endigen, und nachdem sie, bis zu 210 cm
tief, in zum Teil wohl aufgeschwemmtem
Boden sitzen, so dürften dieselben ursprüng-
lich wohl beiläufig l1/- m tief in den Bo-
den eingelassen gewesen sein.
Nimmt man nach heutigem Brauche
an, dass gewöhnlich '/i der Palissaden-
Höhe in den vorher ausgehobenen Graben
eingedämmt wird, dann hätte dieser Palis-
saden-Zaun die ansehnliche Höhe von hei-
läufig 3 m über dem Boden erreicht.
Die hier geschilderten Grabungsresul-
tate, sowie die von mir auch an anderen
Stellen stets mehr oder weniger deutlich
beobachteten Erscheinungen dürften zur
Genüge beweisen, dass die von mir erst-
malig im Frühjahre aufgefundenen und
heuer weiter untersuchten Pfahlreste und
Baumstrünke demjenigen Palissadenzaun
angehörten, dessen Spartian in seinem Le-
ben Hadrians Erwähnung thut, und nicht
kurzen Pflöcken, welche dicht nebenein-
ander gereiht an Stelle von Steinen als
unterirdische ununterbrochene Grenzbe-
zeichnung gedient haben sollen.
Ist nun somit in Vorstehendem, wie
auch im Limesblatt S. 302 fg. von mir