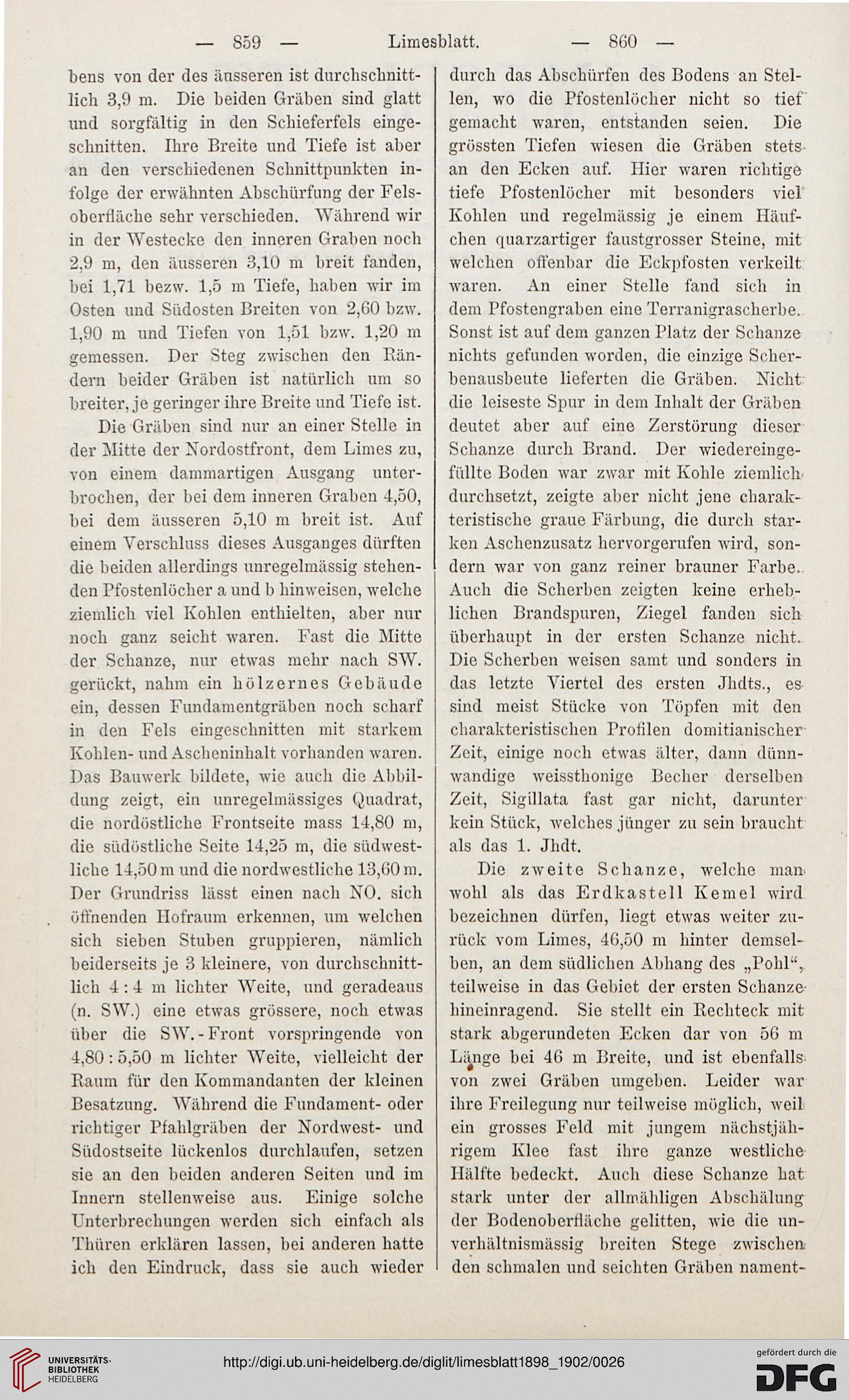— 859 —
Limesblatt.
— 860 —
bens von der des änsseren ist durchschnitt-
lich 3,9 m. Die beiden Gräben sind glatt
und sorgfaltig in den Schieferfels einge-
schnitten. Ihre Breite und Tiefe ist aber
an den verschiedenen Schnittpunkten in-
folge der erwähnten Abschürfung der Fels-
obertläche sehr verschieden. Während wir
in der Westecke den inneren Graben noch
2,9 m, den äusseren 3,10 m breit fanden,
bei 1,71 bezw. 1,5 m Tiefe, haben wir im
Osten und Südosten Breiten von 2,00 bzw.
1,90 m und Tiefen von 1,51 bzw. 1,20 m
gemessen. Der Steg zwischen den Bän-
dern beider Gräben ist natürlich um so
breiter, je geringer ihre Breite und Tiefe ist.
Die Gräben sind nur an einer Stelle in
der Mitte der Nordostfront, dem Limes zu,
von einem dammartigen Ausgang unter-
brochen, der bei dem inneren Graben 4,50,
bei dem äusseren 5,10 m breit ist. Auf
einem Verschluss dieses Ausganges dürften
die beiden allerdings unregelmässig stehen-
den Pfostenlücher a und b hinweisen, welche
ziemlich viel Kohlen enthielten, aber nur
noch ganz seicht waren. Fast die Mitte
der Schanze, nur etwas mehr nach SW.
gerückt, nahm ein hölzernes Gebäude
ein, dessen Fundamentgräben noch scharf
in den Fels eingeschnitten mit starkem
Kohlen- und Ascheninhalt vorhanden waren.
Das Bauwerk bildete, wie auch die Abbil-
dung zeigt, ein unregelmässiges Quadrat,
die nordöstliche Frontseite mass 14,80 m,
die südöstliche Seite 14,25 m, die südwest-
liche 14,50 m und die nordwestliche 13,60 m.
Der Grundriss lässt einen nach NO. sich
öffnenden Hofraum erkennen, um welchen
sich sieben Stuben gruppieren, nämlich
beiderseits je 3 kleinere, von durchschnitt-
lich 4 : 4 m lichter Weite, und geradeaus
(n. SW.) eine etwas grössere, noch etwas
über die SW. - Front vorspringende von
4,80 :5,50 m lichter Weite, vielleicht der
Baum für den Kommandanten der kleinen
Besatzung. Während die Fundament- oder
richtiger Pfahlgräben der Nordwest- und
Südostseite lückenlos durchlaufen, setzen
sie an den beiden anderen Seiten und im
Innern stellenweise aus. Einige solche
Unterbrechungen werden sich einfach als
Thüren erklären lassen, bei anderen hatte
ich den Eindruck, dass sie auch wieder
durch das Abschürfen des Bodens an Stel-
len, wo die Pfostenlücher nicht so tief
gemacht waren, entstanden seien. Die
grüssten Tiefen wiesen die Gräben stets-
an den Ecken auf. Hier waren richtige
tiefe Pfostenlücher mit besonders viel
Kohlen und regelmässig je einem Häuf-
chen quarzartiger faustgrosser Steine, mit
welchen offenbar die Eckpfosten verkeilt
waren. An einer Stelle fand sich in
dem Pfostengraben eine Terranigrascherbe.
Sonst ist auf dem ganzen Platz der Schanze
nichts gefunden worden, die einzige Scher-
benausbeute lieferten die Gräben. Nicht
die leiseste Spur in dem Inhalt der Gräben
deutet aber auf eine Zerstörung dieser
Schanze durch Brand. Der wiedereinge-
füllte Boden war zwar mit Kohle ziemlich
durchsetzt, zeigte aber nicht jene charak-
teristische graue Färbung, die durch star-
ken Aschenzusatz hervorgerufen wird, son-
dern war von ganz reiner brauner Farbe.
Auch die Scherben zeigten keine erheb-
lichen Brandspuren, Ziegel fanden sich
überhaupt in der ersten Schanze nicht.
Die Scherben weisen samt und sonders in
das letzte Viertel des ersten Jhdts., es
sind meist Stücke von Töpfen mit den
charakteristischen Proiilen domitianischer
Zeit, einige noch etwas älter, dann dünn-
wandige weissthonige Becher derselben
Zeit, Sigillata fast gar nicht, darunter
kein Stück, welches jünger zu sein braucht
als das 1. Jhdt.
Die zweite Schanze, welche man.
wohl als das Erdkastell Kemel wird
bezeichnen dürfen, liegt etwas weiter zu-
rück vom Limes, 46,50 m hinter demsel-
ben, an dem südlichen Abhang des „Pohl",
teilweise in das Gebiet der ersten Schanze
hineinragend. Sie stellt ein Bechteck mit
stark abgerundeten Ecken dar von 56 m
Lä^nge bei 46 m Breite, und ist ebenfalls
von zwei Gräben umgeben. Leider war
ihre Freilegung nur teilweise möglich, weil
ein grosses Feld mit jungem nächstjäh-
rigem Klee fast ihre ganze westliche
Hälfte bedeckt. Auch diese Schanze hat
stark unter der allmähligen Abschälung
der Bodenobcrtläche gelitten, wie die un-
verhältnismässig breiten Stege zwischen
den schmalen und seichten Gräben nament-
Limesblatt.
— 860 —
bens von der des änsseren ist durchschnitt-
lich 3,9 m. Die beiden Gräben sind glatt
und sorgfaltig in den Schieferfels einge-
schnitten. Ihre Breite und Tiefe ist aber
an den verschiedenen Schnittpunkten in-
folge der erwähnten Abschürfung der Fels-
obertläche sehr verschieden. Während wir
in der Westecke den inneren Graben noch
2,9 m, den äusseren 3,10 m breit fanden,
bei 1,71 bezw. 1,5 m Tiefe, haben wir im
Osten und Südosten Breiten von 2,00 bzw.
1,90 m und Tiefen von 1,51 bzw. 1,20 m
gemessen. Der Steg zwischen den Bän-
dern beider Gräben ist natürlich um so
breiter, je geringer ihre Breite und Tiefe ist.
Die Gräben sind nur an einer Stelle in
der Mitte der Nordostfront, dem Limes zu,
von einem dammartigen Ausgang unter-
brochen, der bei dem inneren Graben 4,50,
bei dem äusseren 5,10 m breit ist. Auf
einem Verschluss dieses Ausganges dürften
die beiden allerdings unregelmässig stehen-
den Pfostenlücher a und b hinweisen, welche
ziemlich viel Kohlen enthielten, aber nur
noch ganz seicht waren. Fast die Mitte
der Schanze, nur etwas mehr nach SW.
gerückt, nahm ein hölzernes Gebäude
ein, dessen Fundamentgräben noch scharf
in den Fels eingeschnitten mit starkem
Kohlen- und Ascheninhalt vorhanden waren.
Das Bauwerk bildete, wie auch die Abbil-
dung zeigt, ein unregelmässiges Quadrat,
die nordöstliche Frontseite mass 14,80 m,
die südöstliche Seite 14,25 m, die südwest-
liche 14,50 m und die nordwestliche 13,60 m.
Der Grundriss lässt einen nach NO. sich
öffnenden Hofraum erkennen, um welchen
sich sieben Stuben gruppieren, nämlich
beiderseits je 3 kleinere, von durchschnitt-
lich 4 : 4 m lichter Weite, und geradeaus
(n. SW.) eine etwas grössere, noch etwas
über die SW. - Front vorspringende von
4,80 :5,50 m lichter Weite, vielleicht der
Baum für den Kommandanten der kleinen
Besatzung. Während die Fundament- oder
richtiger Pfahlgräben der Nordwest- und
Südostseite lückenlos durchlaufen, setzen
sie an den beiden anderen Seiten und im
Innern stellenweise aus. Einige solche
Unterbrechungen werden sich einfach als
Thüren erklären lassen, bei anderen hatte
ich den Eindruck, dass sie auch wieder
durch das Abschürfen des Bodens an Stel-
len, wo die Pfostenlücher nicht so tief
gemacht waren, entstanden seien. Die
grüssten Tiefen wiesen die Gräben stets-
an den Ecken auf. Hier waren richtige
tiefe Pfostenlücher mit besonders viel
Kohlen und regelmässig je einem Häuf-
chen quarzartiger faustgrosser Steine, mit
welchen offenbar die Eckpfosten verkeilt
waren. An einer Stelle fand sich in
dem Pfostengraben eine Terranigrascherbe.
Sonst ist auf dem ganzen Platz der Schanze
nichts gefunden worden, die einzige Scher-
benausbeute lieferten die Gräben. Nicht
die leiseste Spur in dem Inhalt der Gräben
deutet aber auf eine Zerstörung dieser
Schanze durch Brand. Der wiedereinge-
füllte Boden war zwar mit Kohle ziemlich
durchsetzt, zeigte aber nicht jene charak-
teristische graue Färbung, die durch star-
ken Aschenzusatz hervorgerufen wird, son-
dern war von ganz reiner brauner Farbe.
Auch die Scherben zeigten keine erheb-
lichen Brandspuren, Ziegel fanden sich
überhaupt in der ersten Schanze nicht.
Die Scherben weisen samt und sonders in
das letzte Viertel des ersten Jhdts., es
sind meist Stücke von Töpfen mit den
charakteristischen Proiilen domitianischer
Zeit, einige noch etwas älter, dann dünn-
wandige weissthonige Becher derselben
Zeit, Sigillata fast gar nicht, darunter
kein Stück, welches jünger zu sein braucht
als das 1. Jhdt.
Die zweite Schanze, welche man.
wohl als das Erdkastell Kemel wird
bezeichnen dürfen, liegt etwas weiter zu-
rück vom Limes, 46,50 m hinter demsel-
ben, an dem südlichen Abhang des „Pohl",
teilweise in das Gebiet der ersten Schanze
hineinragend. Sie stellt ein Bechteck mit
stark abgerundeten Ecken dar von 56 m
Lä^nge bei 46 m Breite, und ist ebenfalls
von zwei Gräben umgeben. Leider war
ihre Freilegung nur teilweise möglich, weil
ein grosses Feld mit jungem nächstjäh-
rigem Klee fast ihre ganze westliche
Hälfte bedeckt. Auch diese Schanze hat
stark unter der allmähligen Abschälung
der Bodenobcrtläche gelitten, wie die un-
verhältnismässig breiten Stege zwischen
den schmalen und seichten Gräben nament-