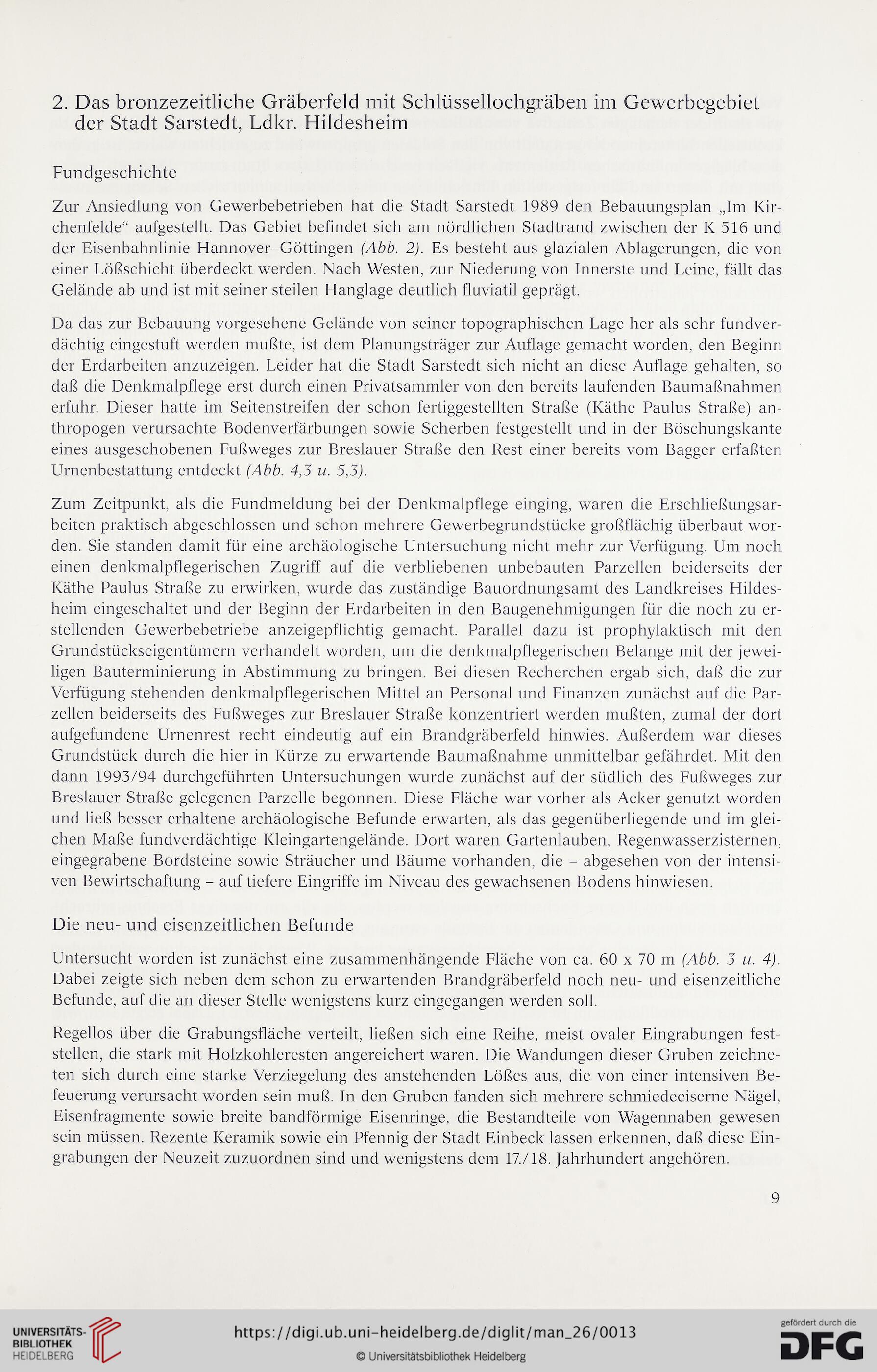2. Das bronzezeitliche Gräberfeld mit Schlüssellochgräben im Gewerbegebiet
der Stadt Sarstedt, Ldkr. Hildesheim
Fundgeschichte
Zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben hat die Stadt Sarstedt 1989 den Bebauungsplan „Im Kir-
chenfelde“ aufgestellt. Das Gebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand zwischen der K 516 und
der Eisenbahnlinie Hannover-Göttingen (Abb. 2). Es besteht aus glazialen Ablagerungen, die von
einer Lößschicht überdeckt werden. Nach Westen, zur Niederung von Innerste und Leine, fällt das
Gelände ab und ist mit seiner steilen Hanglage deutlich fluviatil geprägt.
Da das zur Bebauung vorgesehene Gelände von seiner topographischen Lage her als sehr fundver-
dächtig eingestuft werden mußte, ist dem Planungsträger zur Auflage gemacht worden, den Beginn
der Erdarbeiten anzuzeigen. Leider hat die Stadt Sarstedt sich nicht an diese Auflage gehalten, so
daß die Denkmalpflege erst durch einen Privatsammler von den bereits laufenden Baumaßnahmen
erfuhr. Dieser hatte im Seitenstreifen der schon fertiggestellten Straße (Käthe Paulus Straße) an-
thropogen verursachte Bodenverfärbungen sowie Scherben festgestellt und in der Böschungskante
eines ausgeschobenen Fußweges zur Breslauer Straße den Rest einer bereits vom Bagger erfaßten
Urnenbestattung entdeckt (Abb. 4,3 u. 5,3).
Zum Zeitpunkt, als die Fundmeldung bei der Denkmalpflege einging, waren die Erschließungsar-
beiten praktisch abgeschlossen und schon mehrere Gewerbegrundstücke großflächig überbaut wor-
den. Sie standen damit für eine archäologische Untersuchung nicht mehr zur Verfügung. Um noch
einen denkmalpflegerischen Zugriff auf die verbliebenen unbebauten Parzellen beiderseits der
Käthe Paulus Straße zu erwirken, wurde das zuständige Bauordnungsamt des Landkreises Hildes-
heim eingeschaltet und der Beginn der Erdarbeiten in den Baugenehmigungen für die noch zu er-
stellenden Gewerbebetriebe anzeigepflichtig gemacht. Parallel dazu ist prophylaktisch mit den
Grundstückseigentümern verhandelt worden, um die denkmalpflegerischen Belange mit der jewei-
ligen Bauterminierung in Abstimmung zu bringen. Bei diesen Recherchen ergab sich, daß die zur
Verfügung stehenden denkmalpflegerischen Mittel an Personal und Finanzen zunächst auf die Par-
zellen beiderseits des Fußweges zur Breslauer Straße konzentriert werden mußten, zumal der dort
aufgefundene Urnenrest recht eindeutig auf ein Brandgräberfeld hinwies. Außerdem war dieses
Grundstück durch die hier in Kürze zu erwartende Baumaßnahme unmittelbar gefährdet. Mit den
dann 1993/94 durchgeführten Untersuchungen wurde zunächst auf der südlich des Fußweges zur
Breslauer Straße gelegenen Parzelle begonnen. Diese Fläche war vorher als Acker genutzt worden
und ließ besser erhaltene archäologische Befunde erwarten, als das gegenüberliegende und im glei-
chen Maße fundverdächtige Kleingartengelände. Dort waren Gartenlauben, Regenwasserzisternen,
eingegrabene Bordsteine sowie Sträucher und Bäume vorhanden, die - abgesehen von der intensi-
ven Bewirtschaftung - auf tiefere Eingriffe im Niveau des gewachsenen Bodens hinwiesen.
Die neu- und eisenzeitlichen Befunde
Untersucht worden ist zunächst eine zusammenhängende Fläche von ca. 60 x 70 m (Abb. 3 u. 4).
Dabei zeigte sich neben dem schon zu erwartenden Brandgräberfeld noch neu- und eisenzeitliche
Befunde, auf die an dieser Stelle wenigstens kurz eingegangen werden soll.
Regellos über die Grabungsfläche verteilt, ließen sich eine Reihe, meist ovaler Eingrabungen fest-
stellen, die stark mit Holzkohleresten angereichert waren. Die Wandungen dieser Gruben zeichne-
ten sich durch eine starke Verziegelung des anstehenden Lößes aus, die von einer intensiven Be-
feuerung verursacht worden sein muß. In den Gruben fanden sich mehrere schmiedeeiserne Nägel,
Eisenfragmente sowie breite bandförmige Eisenringe, die Bestandteile von Wagennaben gewesen
sein müssen. Rezente Keramik sowie ein Pfennig der Stadt Einbeck lassen erkennen, daß diese Ein-
grabungen der Neuzeit zuzuordnen sind und wenigstens dem 17./18. Jahrhundert angehören.
9
der Stadt Sarstedt, Ldkr. Hildesheim
Fundgeschichte
Zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben hat die Stadt Sarstedt 1989 den Bebauungsplan „Im Kir-
chenfelde“ aufgestellt. Das Gebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand zwischen der K 516 und
der Eisenbahnlinie Hannover-Göttingen (Abb. 2). Es besteht aus glazialen Ablagerungen, die von
einer Lößschicht überdeckt werden. Nach Westen, zur Niederung von Innerste und Leine, fällt das
Gelände ab und ist mit seiner steilen Hanglage deutlich fluviatil geprägt.
Da das zur Bebauung vorgesehene Gelände von seiner topographischen Lage her als sehr fundver-
dächtig eingestuft werden mußte, ist dem Planungsträger zur Auflage gemacht worden, den Beginn
der Erdarbeiten anzuzeigen. Leider hat die Stadt Sarstedt sich nicht an diese Auflage gehalten, so
daß die Denkmalpflege erst durch einen Privatsammler von den bereits laufenden Baumaßnahmen
erfuhr. Dieser hatte im Seitenstreifen der schon fertiggestellten Straße (Käthe Paulus Straße) an-
thropogen verursachte Bodenverfärbungen sowie Scherben festgestellt und in der Böschungskante
eines ausgeschobenen Fußweges zur Breslauer Straße den Rest einer bereits vom Bagger erfaßten
Urnenbestattung entdeckt (Abb. 4,3 u. 5,3).
Zum Zeitpunkt, als die Fundmeldung bei der Denkmalpflege einging, waren die Erschließungsar-
beiten praktisch abgeschlossen und schon mehrere Gewerbegrundstücke großflächig überbaut wor-
den. Sie standen damit für eine archäologische Untersuchung nicht mehr zur Verfügung. Um noch
einen denkmalpflegerischen Zugriff auf die verbliebenen unbebauten Parzellen beiderseits der
Käthe Paulus Straße zu erwirken, wurde das zuständige Bauordnungsamt des Landkreises Hildes-
heim eingeschaltet und der Beginn der Erdarbeiten in den Baugenehmigungen für die noch zu er-
stellenden Gewerbebetriebe anzeigepflichtig gemacht. Parallel dazu ist prophylaktisch mit den
Grundstückseigentümern verhandelt worden, um die denkmalpflegerischen Belange mit der jewei-
ligen Bauterminierung in Abstimmung zu bringen. Bei diesen Recherchen ergab sich, daß die zur
Verfügung stehenden denkmalpflegerischen Mittel an Personal und Finanzen zunächst auf die Par-
zellen beiderseits des Fußweges zur Breslauer Straße konzentriert werden mußten, zumal der dort
aufgefundene Urnenrest recht eindeutig auf ein Brandgräberfeld hinwies. Außerdem war dieses
Grundstück durch die hier in Kürze zu erwartende Baumaßnahme unmittelbar gefährdet. Mit den
dann 1993/94 durchgeführten Untersuchungen wurde zunächst auf der südlich des Fußweges zur
Breslauer Straße gelegenen Parzelle begonnen. Diese Fläche war vorher als Acker genutzt worden
und ließ besser erhaltene archäologische Befunde erwarten, als das gegenüberliegende und im glei-
chen Maße fundverdächtige Kleingartengelände. Dort waren Gartenlauben, Regenwasserzisternen,
eingegrabene Bordsteine sowie Sträucher und Bäume vorhanden, die - abgesehen von der intensi-
ven Bewirtschaftung - auf tiefere Eingriffe im Niveau des gewachsenen Bodens hinwiesen.
Die neu- und eisenzeitlichen Befunde
Untersucht worden ist zunächst eine zusammenhängende Fläche von ca. 60 x 70 m (Abb. 3 u. 4).
Dabei zeigte sich neben dem schon zu erwartenden Brandgräberfeld noch neu- und eisenzeitliche
Befunde, auf die an dieser Stelle wenigstens kurz eingegangen werden soll.
Regellos über die Grabungsfläche verteilt, ließen sich eine Reihe, meist ovaler Eingrabungen fest-
stellen, die stark mit Holzkohleresten angereichert waren. Die Wandungen dieser Gruben zeichne-
ten sich durch eine starke Verziegelung des anstehenden Lößes aus, die von einer intensiven Be-
feuerung verursacht worden sein muß. In den Gruben fanden sich mehrere schmiedeeiserne Nägel,
Eisenfragmente sowie breite bandförmige Eisenringe, die Bestandteile von Wagennaben gewesen
sein müssen. Rezente Keramik sowie ein Pfennig der Stadt Einbeck lassen erkennen, daß diese Ein-
grabungen der Neuzeit zuzuordnen sind und wenigstens dem 17./18. Jahrhundert angehören.
9